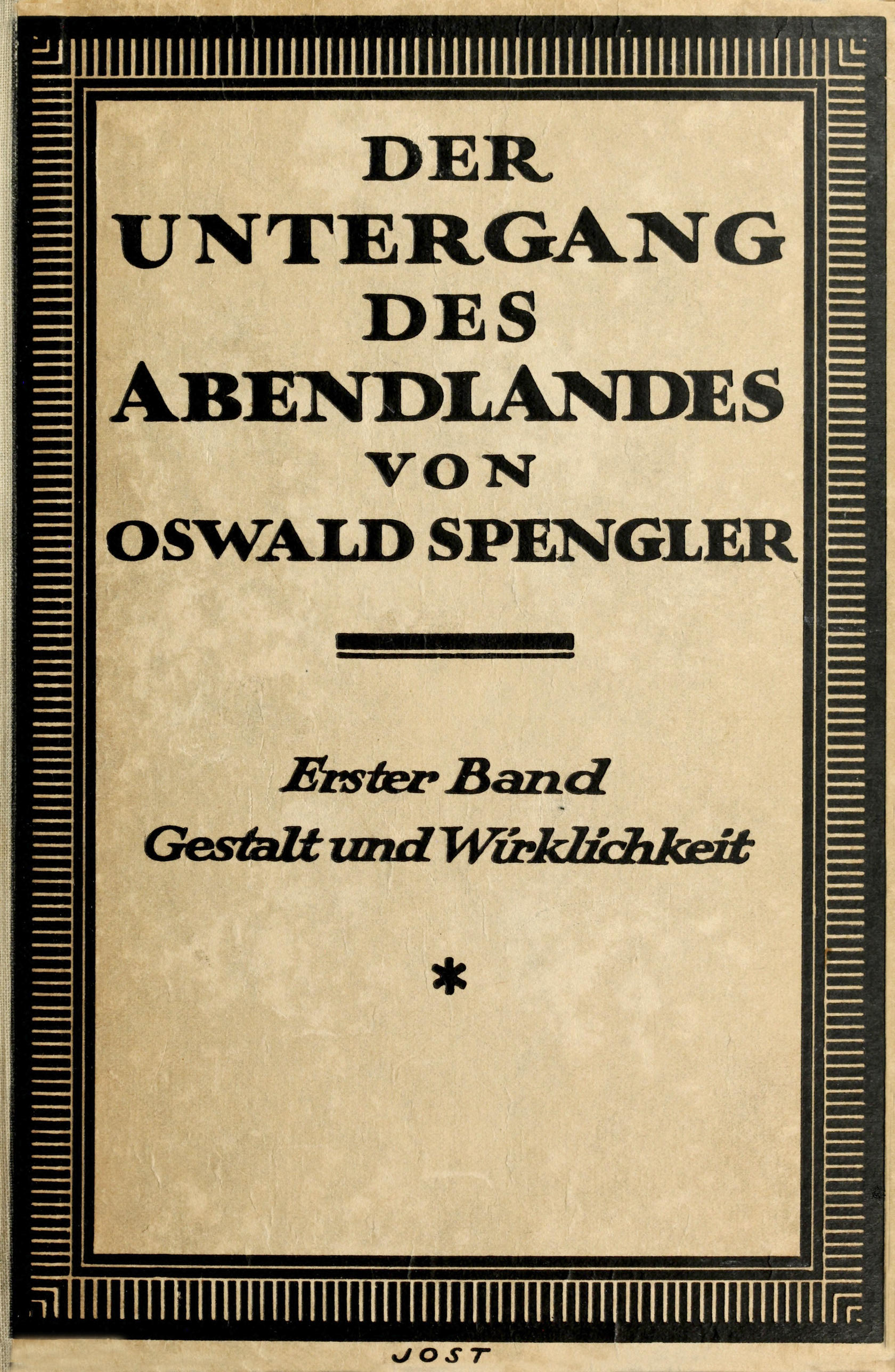
Title: Der Untergang des Abendlandes, Erster Band
Author: Oswald Spengler
Release date: October 13, 2025 [eBook #77042]
Language: German
Original publication: München: C.H. Beck, 1919
Credits: Peter Becker and the Online Distributed Proofreading Team at https://www.pgdp.net (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)
Anmerkungen zur Transkription
Der vorliegende Text wurde anhand der Buchausgabe von 1920 so weit wie möglich originalgetreu wiedergegeben. Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Ungewöhnliche und heute nicht mehr verwendete Schreibweisen bleiben gegenüber dem Original unverändert; fremdsprachliche Ausdrücke wurden nicht korrigiert.
Fußnoten wurden am Ende des jeweiligen Abschnitts zusammengefasst.
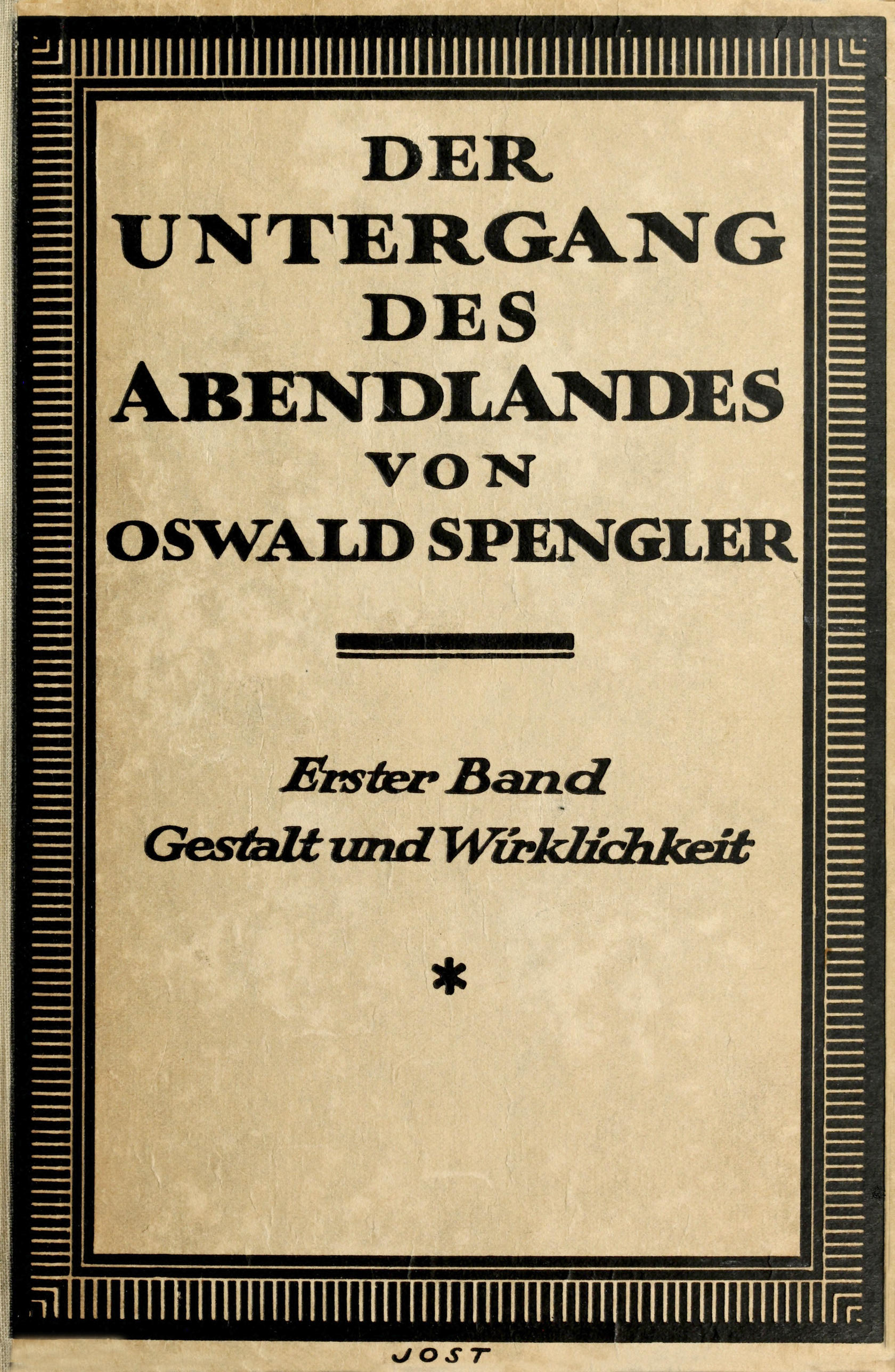
DER UNTERGANG DES ABENDLANDES
ERSTER BAND: GESTALT UND WIRKLICHKEIT
UMRISSE EINER MORPHOLOGIE
DER WELTGESCHICHTE
VON
OSWALD SPENGLER
ERSTER BAND
GESTALT UND WIRKLICHKEIT
23.–32., UNVERÄNDERTE AUFLAGE
37.–50. TAUSEND

Copr. München 1919. C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung
Alle Rechte, insbesondere das Übersetzungsrecht, vorbehalten
[S. vii]
Dies Buch, das Ergebnis dreier Jahre, war in der ersten Niederschrift vollendet, als der große Krieg ausbrach. Es ist bis zum Frühling 1917 noch einmal durchgearbeitet und in Einzelheiten ergänzt und verdeutlicht worden. Die außerordentlichen Verhältnisse haben sein Erscheinen weiterhin verzögert.
Obwohl mit einer allgemeinen Philosophie der Geschichte beschäftigt, bildet es doch in tieferem Sinne einen Kommentar zu der großen Epoche, unter deren Vorzeichen die leitenden Ideen sich gestaltet haben.
Der Titel, seit 1912 feststehend, bezeichnet in strengster Wortbedeutung und im Hinblick auf den Untergang der Antike eine welthistorische Phase vom Umfang mehrerer Jahrhunderte, in deren Anfang wir gegenwärtig stehen.
Die Ereignisse haben vieles bestätigt und nichts widerlegt. Es zeigte sich, daß diese Gedanken eben jetzt und zwar in Deutschland hervortreten mußten, daß der Krieg selbst aber noch zu den Voraussetzungen gehörte, unter welchen die letzten Züge des neuen Weltbildes bestimmt werden konnten.
Denn es handelt sich nach meiner Überzeugung nicht um eine neben andern mögliche und nur logisch gerechtfertigte, sondern um die, gewissermaßen natürliche, von allen dunkel vorgefühlte Philosophie der Zeit. Das darf ohne Anmaßung gesagt werden. Ein Gedanke von historischer Notwendigkeit, ein Gedanke also, der nicht in eine Epoche fällt, sondern der Epoche macht, ist nur in beschränktem Sinne das Eigentum dessen, dem seine Urheberschaft zuteil wird. Er gehört der[S. viii] ganzen Zeit; er ist im Denken aller unbewußt wirksam und allein die zufällige private Fassung, ohne die es keine Philosophie gibt, ist mit ihren Schwächen und Vorzügen das Schicksal — und das Glück — eines Einzelnen.
Ich habe nur den Wunsch beizufügen, daß dies Buch neben den militärischen Leistungen Deutschlands nicht ganz unwürdig dastehen möge.
München, im Dezember 1917
Oswald Spengler
[S. ix]
|
Seite |
|
|
Vorwort |
|
|
Inhaltsverzeichnis |
|
|
Einleitung |
|
|
Das Thema. Vorausbestimmung der Geschichte. Der historische Vergleich. Morphologie der Weltgeschichte — eine neue Philosophie. Für wen gibt es Geschichte? Der antike Mensch ahistorisch. Sein Verhältnis zur Chronologie und Astronomie. Das Weltbild des indischen und ägyptischen Menschen. Mumie und Totenverbrennung als Zeitsymbole. Der westeuropäische Mensch extrem historisch veranlagt. |
|
|
Die Form der Weltgeschichte. „Altertum-Mittelalter-Neuzeit.“ Flachheit des Schemas, Mangel an Proportion. Das Linienförmige. Herkunft aus dem Orient; Addition einer „Neuzeit“ im Abendlande. Zunehmende Zersetzung des Bildes. Westeuropa kein Schwerpunkt. Vollkommener Relativismus. Goethes Methode die einzig historische. „Weltgeschichte“ als Geschichte einer Gruppe hoher Kulturen. Kulturen als Organismen. |
|
|
Das Römertum als Schlüssel zum Verständnis der westeuropäischen Zukunft. Unser bisheriges Verhältnis zur Antike ideologisch oder materialistisch (Nietzsche und Mommsen). Enge beider Standpunkte. „Untergang des Abendlandes“: Das Problem der Zivilisation. Zivilisation als das Ende jeder Kultur. Griechentum und Römertum: Kultur und Zivilisation. Weltstadt und Provinz. Das Imperium Romanum: der normale Endzustand jeder Zivilisation. Gegenwart und Imperialismus. |
|
|
Notwendigkeit des Grundgedankens. Seine Tragweite. Verhältnis zur Philosophie. Inferiorität des heutigen Philosophierens: kein lebendiges Verhältnis zur Zeit. Gibt es noch eine echte Möglichkeit? Nach der systematischen und der ethischen Periode eine letzte, skeptische (historisch-relativistische). Statt des Erkenntnis- und des Wertproblems das Formproblem als Schwerpunkt. Erweiterung der historischen Morphologie zu einer universellen Symbolik. |
|
|
Entstehung des Buches. Anlaß. Inhalt. Ordnung. |
|
|
Tafeln zur vergleichenden Morphologie der Weltgeschichte |
|
|
I. Kapitel: Vom Sinn der Zahlen |
|
|
Grundbegriffe. Richtung und Ausdehnung: chronologische und mathematische Zahl. Die Zahl als Prinzip der Grenzsetzung.[S. x] Keine „Zahl an sich“. Mehrere Mathematiken. Kants Begriff des a priori. Die Form des Erkennens weder konstant noch allgemeingültig: eine Funktion der jeweiligen Kultur. Stile des Erkennens. Innere Verwandtschaft jeder Mathematik mit der Formensprache der gleichzeitigen Künste: euklidische Geometrie und Statuenplastik, Analysis und Kontrapunkt. |
|
|
Die antike Zahl als Größe (Maß). Körperliche, nicht räumliche Ausgedehntheit. Fehlen irrationaler und negativer Zahlen. Weltsystem des Aristarch. Mathematik und Religion. Zahl und Tod. Diophant und die arabische Zahl (Algebra). Descartes und die Analysis des Unendlichen. Die abendländische Zahl als Funktion. Die Geschichte der abendländischen Mathematik eine fortschreitende Emanzipation vom Größenbegriff. Das Irrationale antihellenisch. |
|
|
Weltangst und Weltsehnsucht. Ursprung der mathematischen, religiösen, künstlerischen Formensprache: Ausdruck der Angst vor dem Unbekannten. |
|
|
Geometrie und Arithmetik (Messung und Zählung) veraltete Namen. Die Quadratur des Kreises das klassische antike Grenzproblem. Die Mathematik des Kleinen (der antike Staat). Konstruktion und Operation. Das klassische abendländische Grenzproblem: der Grenzwert der Infinitesimalrechnung (Beziehung zum Barockstil). Überschreitung der Grenze des Sehsinnes durch die Analysis. Das antike Parallelenaxiom und die nichteuklidischen Geometrien. Mehrdimensionale Räume (Punktmannigfaltigkeiten). Letzte Fassung des faustischen Zahlendenkens: Transformations- und Invariantenlehre. Erschöpfung der formalen Möglichkeiten und Ende der westeuropäischen Mathematik. |
|
|
II. Kapitel: Das Problem der Weltgeschichte |
|
|
I. Physiognomik und Systematik |
|
|
Notwendigkeit einer neuen historischen Methode. Ausschaltung der Ideale und Moralen als Wertmesser der Entwicklung. Geschichte und Natur = Gestalt und Gesetz = Richtung und Ausdehnung. Physiognomik und Systematik als die beiden Arten morphologischer Weltbetrachtung. |
|
|
Was ist eine Kultur? Aufbau der höheren Geschichte. Goethes Urphänomen. Tempo, Lebensdauer, Stil, Tod hoher Kulturen. Wiederholung des Kulturganges im zugehörigen Einzeldasein. Begriff der Homologie von Epochen. Gleichartiger Bau aller Kulturen. Möglichkeit morphologischer Vorausbestimmung und Rekonstruktion historischer Perioden. |
|
|
II. Schicksalsidee und Kausalitätsprinzip |
|
|
Zwei Formen kosmischer Notwendigkeit: organische und anorganische Logik = Schicksal und Kausalität (Lebensgefühl und Erkenntnisform). Beziehung zu Weltsehnsucht und Weltangst.[S. xi] Die kausale Weltform als Versuch des Verstandes, das Schicksal zu überwinden. Schicksal als Daseinsart des Urphänomens. |
|
|
Das Zeitproblem. Mißverständnisse der Systematiker: „Zeit und Raum“. Zeit (Nichtumkehrbarkeit) als Schicksal. Zeit kein Begriff, wissenschaftlich nicht zugänglich. Raumrechnung und Zeitrechnung (das Was und das Wann): die naturhafte und die historische Weltfrage. Mathematik und Chronologie. |
|
|
Zeit, Schicksal und Tragödie. Euklidische und analytische Tragik (Situations- und Entwicklungstragik). Jede Kultur eine eigne Schicksalsidee. Grenzen der Möglichkeit, die „Weltgeschichte der andern“ zu verstehen. Die großen Zeitsymbole als einzige Hilfsmittel: Die Uhr. Bestattungsformen. Kalender. Erotik. Staatsform und Zeitgefühl: der antike, ägyptische und abendländische Staatsgedanke. Stoizismus und Sozialismus: Beziehung zu Plastik und Musik. |
|
|
Schicksal und Zufall. Kausalität und Prädestination. Tragik des Zufälligen (Shakespeare). Tyche und der Stil des antiken Daseins. Astrologie und Orakel. Die antike Schicksalstragödie. Logik der Geschichte: Kolumbus und das spanische Jahrhundert. „Epoche“ und „Episode“. Anonyme und persönliche Form der Geschichte. Das Schicksal Napoleons. Luther. |
|
|
Gibt es eine wirkliche Geschichtswissenschaft? Verwechslung physikalisch-kausaler und historisch-physiognomischer Methoden. Geschichte als „Prozeß“. „Hunger und Liebe.“ Das soziale Drama als Seitenstück zur materialistischen Geschichtsauffassung. Mangel an Skepsis. Letzte Aufgaben. |
|
|
III. Kapitel: Makrokosmos |
|
|
I. Die Symbolik des Weltbildes und das Raumproblem |
|
|
Was ist ein Symbol? Idee des Makrokosmos. Die Welt als Inbegriff von Symbolen in bezug auf eine Seele. Jeder Mensch hat eine eigne Umwelt. Raum und Tod. „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.“ Das Raumproblem. Nur die Tiefe („dritte Dimension“) raumbildend. Kants Theorie. Unabhängigkeit der Mathematik von der Anschauung. Variabilität des Sehbildes. Mehrzahl möglicher Raumarten. Raumtiefe = Richtung (Zeit). Identität des Tiefenerlebnisses mit dem Erwachen des Innenlebens. Idealtypus der Ausdehnung: jede Kultur besitzt ein eignes Ursymbol. Das abendländische Ursymbol: der unendliche Raum. Kants Problem für die Griechen gar nicht vorhanden. Der Parallelensatz Euklids und die Vielzahl der Raumstrukturen in der westeuropäischen Mathematik. Das antike Ursymbol: der stoffliche Einzelkörper. |
|
|
II. Apollinische, faustische, magische Seele |
|
|
Olymp und Walhall. Magisches und faustisches Christentum. Der antike Polytheismus (Gott als Körper) und der abendländische Monotheismus (Gott als Raum). Das ägyptische Ursymbol der Weg. Sinn der Pyramidenarchitektur. |
|
|
[S. xii]
Doppelsinn der Kunst: Imitation und Symbolik (Weltsehnsucht und Weltangst). Jede Frühkunst Architektur: Stein und Ursymbol. Staatsform und Architekturform; Ausdruck des Willens, der Sorge, der Dauer. Hohenstaufen und Pharaonen. Außenarchitektur und Innenräume. Das Problem des Stils. Einheit und Lebensdauer innerhalb einer Kultur. Der ägyptische Stil als Musterbeispiel einer Stilgeschichte. Koinzidenz seiner Phasen mit denen des abendländischen Stils. Stileinheit von der Romantik bis zum Empire. Verlagerung des Schwepunkts der Stilbildung von der frühen Architektur in eine der bildenden Künste. Dorik und Ionik, Gotik und Barock als Jugend- und Altersphase desselben Stils. Aufgabe der Kunstwissenschaft: vergleichende Biographien der großen Stile. Psychologie der Kunsttechnik. Der wahre Umfang der arabischen Kunst: die altchristlich-„spätantike“ Kunst als Frühzeit, die islamische als Spätzeit. Mosaikmalerei, Arabeske. Verbindung von Rundbogen und Säule arabische Motive. |
|
|
IV. Kapitel: Musik und Plastik |
|
|
I. Die bildenden Künste |
|
|
Unmöglichkeit einer Einteilung der Künste nach stationären technischen Prinzipien. Musik eine bildende Kunst. Auswahl der innerhalb einer Kultur möglichen Künste. Tendenz aller antiken Künste zur Rundplastik (650–350). Beziehung zur euklidischen Geometrie. Die Freskomalerei als Vorstufe. Dementsprechend 1500 bis 1800 Ausbildung der Instrumentalmusik. Kontrapunkt und Analysis: Sieg der Musik über Malerei und Baukunst: Rokoko. |
|
|
Charakter der Renaissance als antigotischer (antimusikalischer) Bewegung. Fresko und Statue in Florenz vom gotischen Formgefühl bestimmt (Bildraum). Linear- und Luftperspektive. Der Park. Die historische Landschaft. |
|
|
Symbolik der Farben. Farben der Nähe und Ferne. Das hellenische Vierfarbenfresko. Blau und Grün Raumfarben. Behandlung des Bildhintergrundes: Verneinung im antiken Fresko, Goldgrund im Mosaik, Tiefenperspektive in der Ölmalerei. Der sichtbare Pinselstrich der Venezianer als Ausdruck des historischen Gefühls. Das Rembrandtbraun. |
|
|
II. Akt und Porträt |
|
|
Das antike und das abendländische Menschenideal: der Körper nach Grenzflächen oder physiognomisch behandelt. Köpfe antiker Statuen. Faustische Akte ein Widerspruch. Das Porträt in Florenz und Venedig. Michelangelo und das Ende der abendländischen Plastik. Lionardo frei von Renaissanceidealen; der Entdecker; Physiologie statt Anatomie. Raffaels sixtinische Madonna die letzte große Linie in der abendländischen Kunst. |
|
|
In jeder Kultur eine Gruppe großer Künste. In der faustischen die Instrumentalmusik, in der apollinischen die Aktplastik[S. xiii] als Mitte. Gleichzeitigkeit der Ausbildung; identische Dauer. Begriff des Impressionismus: Physiognomik des Pinselstrichs. Parallele zur chinesischen Kunst: Park, Musik. Perspektive. Das Freilichtproblem; sein Gegensatz zum Impressionismus von Lionardo bis Rembrandt: Kultur und Zivilisation. Ausgang der westeuropäischen Malerei. |
|
|
Mit Tristan und Parzifal die faustische Musik zu Ende. Bayreuth und Pergamon: Ende der antiken Skulptur. Unmöglichkeit einer organischen Fortentwicklung. Alexandrinismus. Letzte Stadien der ägyptischen und antiken Kunst. |
|
|
V. Kapitel: Seelenbild und Lebensgefühl |
|
|
I. Die Form der Seele |
|
|
Unmöglichkeit einer Wissenschaft von der Seele. Das Bild der Seele in jeder Kultur eine Funktion des Weltbildes. „Seelenkörper“ und „Seelenraum“ der antiken und abendländischen Psychologie. Der „Wille“ als Repräsentant des historischen Gefühls. Der Wille zur Macht: seelische Dynamik. Wille und „Charakter“ (Porträt, Biographie). Antik die „Haltung“ (Statue). Apollinische und faustische Tragik: Attitüdendrama und Charakterdrama (anekdotisch und biographisch). Der Held als Dulder oder Täter. Der Begriff der Katharsis und der Stoizismus. Die drei Einheiten: Formideal der Statue. Tages- und Nachtkunst. |
|
|
Popularität und Esoterik, Hingabe und Überwindung. „Kenner und Laie“ als Ausdruck der Distanzenergie. Steigende Esoterik der westeuropäischen Geistigkeit. Verhältnis des Kunstwerkes zum Betrachter: arabische, chinesische, abendländische Malperspektive. Das astronomische Weltbild. Raumerweiternde Kraft des Fernrohrs. Segelschiffahrt. Kolumbus. Die Antike und die Umschiffung Afrikas. Antikes und nordisches Heimatgefühl. Der apollinische und faustische Staatsgedanke. Zwei Arten von Kolonisation. Weltmachtpläne unantik. |
|
|
II. Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus |
|
|
„Du sollst“ die spezifisch faustische Form der Moral (Wille zur Macht, Tat, Raum). Antik die Interesselosigkeit an einer Umwandlung der Welt (Ataraxia). Moral die unveränderliche Struktur des lebendigen Seins. Jede Kultur besitzt eine eigne und einzige Grundform. Beziehung zur Mathematik: „euklidische“ (Haltungs-) und „analytische“ (Willens-)ethik. Katharsis und Nirwana. Moralische Theorie und Praxis. Nicht Mitleids-, sondern „Herrenmoral“ faustisch: praktische Dynamik. Verhältnis von Ethik und Logik. |
|
|
Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus. Verwandlung von Kultur in Zivilisation. Buddha, Sokrates, Rousseau die Wortführer anbrechender Zivilisationen. Tragische und Plebejermoral: Äschylus und die Stoa, Shakespeare und die Gegenwart. [S. xiv]Der Kulturbegriff der Tat und der zivilisierte Begriff der Arbeit. „Rückkehr zur Natur“ in allen drei Fällen. Der ursprüngliche Buddhismus keine Religion, dem Christentum nicht verwandt. Kultur und Religion, Zivilisation und Irreligion. Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus formverwandte praktische Weltstimmungen. Die metaphysisch-systematische und die sozialethische Periode jeder Philosophie (Indien, Antike, Abendland). Der Weltstadtmensch Objekt der neuen Denkweise. Rhetorik und Journalismus. Die buddhistische Agitation. Paulus gegen Bonifacius. |
|
|
Zwei richtige Auffassungen des Sozialismus: als Form der Zukunft und als Form des Niedergangs. Der unbewußte Sozialismus. Alle Römer unbewußte Stoiker. Ausgang des Sozialismus von Kant: der kategorische Imperativ auf das Politische, Soziale, Wirtschaftliche angewandt. Das Recht auf Arbeit als faustisches Gegenstück des antiken „panem et circenses“. Praktische Statik und Dynamik. Der Wille zur Zukunft und das „dritte Reich“ (Ibsen). Ursprung des abendländischen Bildes der Weltgeschichte: Altertum — Mittelalter — Neuzeit: Richtungsenergie. |
|
|
Geschichte der Philosophie ein morphologisches Problem. Kulturphilosophie und zivilisierte Philosophie. Die ethische Periode der „Philosophie ohne Mathematik“. Wachsende Bedeutungslosigkeit metaphysischer Fragen seit Aristoteles und Kant. Der nationalökonomische Charakter der westeuropäischen Ethik: die Schule Hegels. Schopenhauers System eine Antizipation des Darwinismus. Darwins Theorie nationalökonomischer Herkunft. Der Übermensch. Nietzsche und Shaw: die Züchtungsidee als letzte Konsequenz der ethischen Dynamik des „Du sollst“. Gang der Philosophie des 19. Jahrhunderts. Letzte Möglichkeit: der historisch-psychologische Skeptizismus. |
|
|
VI. Kapitel: Faustische und apollinische Naturerkenntnis |
|
|
Das Ziel der Naturwissenschaft, reine Mechanik zu werden: eine Illusion. Jedes Naturgesetz Zahl und Bild. Alle Grundbegriffe der modernen Physik rein faustischer Natur. Jedes „Wissen“ von der Natur von einer voraufgegangenen Religion abhängig. Die antike Physik Statik, die arabische Alchymie, die abendländische Dynamik. Alchymie und Chemie. Antike und westeuropäische Atomtheorie: Miniaturformen und Minimalquanta (Gestalteinheit und Wirkungseinheit) Stoizismus und Sozialismus der Atome; Beziehung zu politischen Formen. |
|
|
Das Bewegungsproblem Mittelpunkt jeder Physik. Seine Unlösbarkeit. Die Eleaten. Die Mechanik von Hertz. Der physikalische Begriff der Notwendigkeit. Kausalität (Naturgesetz) eine spezifisch westeuropäische Fassung. Andre Möglichkeiten. Das Bedingte in unserm Begriff der Erfahrung. |
|
|
Gottgefühl und Naturerkenntnis. „Kraft und Masse“ und der[S. xv] Barockstil. Die Bewegung Ausgangspunkt für Religion und Physik. Die Theorie als Mythus. „Stoff und Form“ — „Kraft und Masse“: Gott als höchste Gestalt oder als höchste Kraft. Entstehung des großen Mythus in der Frühzeit jeder Kultur. Der faustische Mythus 900–1200 entstanden: Identität katholischer, heidnisch-nordischer und ritterlich-epischer Vorstellungen. Der olympische Mythus und die Körpergeometrie. Apollinische und faustische Naturwesen: beseelte Dinge (Nymphen) und seelenerfüllte Räume (Elfen). Altrömische Gottheiten. Der Kaiserkult die letzte religiöse Schöpfung der Antike. Die spätantiken Kulte als magischer Monotheismus: Auflösung aller Gestalten in ein Prinzip. |
|
|
Der Atheismus als Negation einer bestimmten Form von Religiosität. Das Christentum vom antiken Standpunkt atheistisch. Antike Intoleranz gegen Kultfrevel, abendländische gegen dogmatische Abweichungen (Scheiterhaufen, Guillotine), Kultfreiheit und Gewissensfreiheit. |
|
|
Die faustische Physik als Dogma von der Kraft. Der Kraftbegriff religiösen Ursprungs. Seine Entwicklung. Galileis Übergang von der Renaissancestatik zur Dynamik. |
|
|
Die moderne Physik an der Grenze ihrer formalen Möglichkeiten. Steigende Zweifel an allen Grundbegriffen. Bedeutung der Relativitätstheorie: Zerstörung des newtonischen Weltbildes. Die Entropielehre: Mit dem Phänomen der Nichtumkehrbarkeit der Kreisprozesse dringt ein historisches Motiv in das Naturbild. Dementsprechend Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung statt exakter Mathematik. Die Atomzerfallhypothese und die Schicksalsidee. Die Entropie und der Mythus der Götterdämmerung. |
|
|
Ausgang der westeuropäischen Wissenschaft: Selbstvernichtung durch intellektuelle Verfeinerung. Wachsende Konvergenz von Physik, Chemie, Mathematik und Erkenntnistheorie. Endziel: Auflösung der gesamten wissenschaftlichen Substanz in einen Komplex von Funktionen. Reine Morphologie mathematisch-logischer Erkenntnisformen. Rückkehr der Erkenntnis zum Ausgangspunkt: Skeptizismus. |
[S. 1]
[S. 3]
In diesem Buche wird zum ersten Male der Versuch gewagt, Geschichte vorauszubestimmen. Es handelt sich darum, das Schicksal einer Kultur, und zwar der einzigen, die heute auf der Erde in Vollendung begriffen ist, derjenigen Westeuropas, in den noch nicht abgelaufenen Stadien zu verfolgen.
Die Möglichkeit, eine Aufgabe von so ungeheurer Tragweite zu lösen, ist bis heute offenbar nicht ins Auge gefaßt und wenn dies der Fall war, die Mittel, sie zu behandeln, nicht erkannt oder in unzulänglicher Weise gehandhabt worden.
Gibt es eine Logik der Geschichte? Gibt es jenseits von allem Zufälligen und Unberechenbaren der singulären Ereignisse eine sozusagen metaphysische Struktur der historischen Menschheit, die von den weithin sichtbaren, populären, geistig-politischen Gebilden der Oberfläche wesentlich unabhängig ist? Die diese Wirklichkeit geringeren Ranges vielmehr erst hervorruft? Erscheinen die großen Momente der Weltgeschichte dem verstehenden Auge vielleicht immer wieder in einer Gestalt, die Schlüsse zuläßt? Und wenn — wo liegen die Grenzen derartiger Folgerungen? Ist es möglich, im Leben selbst — denn menschliche Geschichte ist der Inbegriff von ungeheuren Lebensläufen, als deren Ich und Person schon der Sprachgebrauch unwillkürlich Individuen höherer Ordnung wie „die Antike“, „die chinesische Kultur“ oder „die moderne Zivilisation“ denkend und handelnd einführt — die Stufen aufzufinden, die durchschritten werden müssen und in einer Ordnung, die keine Ausnahme zuläßt? Haben die für alles Organische grundlegenden Begriffe Geburt, Tod, Jugend, Alter, Lebensdauer in diesem Kreise vielleicht einen strengen Sinn, den noch niemand erschlossen hat? Liegen, kurz gesagt, allem Historischen allgemeine biographische Urformen zugrunde?
[S. 4]
Der Untergang des Abendlandes, zunächst ein örtlich und zeitlich beschränktes Phänomen wie das ihm entsprechende des Unterganges der Antike, ist, wie man sieht, ein philosophisches Thema, das, in seiner ganzen Schwere begriffen, alle großen Fragen des Seins in sich schließt.
Will man erfahren, in welcher Gestalt das Erlöschen der abendländischen Kultur vor sich geht, so muß man zuvor erkannt haben, was Kultur ist, in welchem Verhältnis sie zur sichtbaren Geschichte, zum Leben, zur Seele, zur Natur, zum Geiste steht, unter welchen Formen sie in Erscheinung tritt und inwiefern diese Formen — Völker, Sprachen und Epochen, Schlachten und Ideen, Staaten und Götter, Künste und Kunstwerke, Wissenschaften, Rechte, Wirtschaftsformen und Weltanschauungen, große Menschen und große Ereignisse — Symbole und als solche zu deuten sind.
Das Mittel, tote Formen zu begreifen, ist das mathematische Gesetz. Das Mittel lebendige Formen zu verstehen, ist die Analogie. Auf diese Weise unterscheiden sich Polarität und Periodizität der Welt.
Das Bewußtsein davon, daß die Zahl der historischen Erscheinungsformen eine begrenzte ist, daß Zeitalter, Epochen, Situationen, Personen sich dem Typus nach wiederholen, war immer vorhanden. Man hat das Auftreten Napoleons kaum je ohne einen Seitenblick auf Cäsar und Alexander behandelt, von denen der erste, wie man sehen wird, morphologisch unzulässig, der zweite richtig war. Napoleon selbst fand die Verwandtschaft seiner Lage mit der Karls des Großen heraus. Der Konvent sprach von Karthago, wenn er England meinte, und die Jakobiner nannten sich Römer. Man hat, mit sehr verschiedenem Recht, Florenz mit Athen, Buddha mit Christus, das Urchristentum mit dem modernen Sozialismus, die römischen Finanzgrößen der Zeit Cäsars mit den Yankees verglichen. Petrarka, der erste leidenschaftliche Archäologe — die Archäologie ist selbst ein Ausdruck des Gefühls, daß Geschichte sich wiederholt — dachte in bezug auf sich an Cicero und erst[S. 5] vor kurzem noch Cecil Rhodes, der Organisator des englischen Südafrika, der die antiken Cäsarenbiographien in eigens für ihn angefertigten Übersetzungen in seiner Bibliothek besaß, an Kaiser Hadrian. Es war das Verderben Karls XII. von Schweden, daß er von Jugend auf das Leben Alexanders von Curtius Rufus in der Tasche trug und diesen Eroberer kopieren wollte.
Friedrich der Große bewegt sich in seinen politischen Denkschriften — wie den Considerations von 1738 — mit vollkommener Sicherheit in Analogien, um seine Auffassung der weltpolitischen Situation zu kennzeichnen, so wenn er die Franzosen mit den Makedoniern unter Philipp den Griechen — Deutschen — gegenüber vergleicht. „Schon sind die Thermopylen Deutschlands, Elsaß und Lothringen, in Philipps Hand.“ Damit war die Politik des Kardinals Fleury vorzüglich getroffen. Hier findet sich weiterhin der Vergleich zwischen der Politik der Häuser Habsburg und Bourbon und den Proskriptionen des Antonius und Oktavian.
Aber das alles blieb fragmentarisch und willkürlich und entsprach in der Regel mehr einem augenblicklichen Hange, sich dichterisch und geistreich auszudrücken, als einem tieferen historischen Formgefühl.
So sind die Vergleiche Rankes, eines Meisters der kunstvollen Analogie, zwischen Kyaxares und Heinrich I., den Einfällen der Kimmerier und Magyaren morphologisch bedeutungslos, nicht viel weniger der oft wiederholte zwischen den hellenischen Stadtstaaten und den Renaissancerepubliken, von tiefer, aber zufälliger Richtigkeit dagegen der zwischen Alkibiades und Napoleon. Sie sind bei ihm wie bei andern aus einem plutarchischen, d. h. volkstümlich romantischen Geschmack vollzogen worden, der lediglich die Ähnlichkeit der Szene auf der Weltbühne ins Auge faßt, nicht im strengen Sinne des Mathematikers, der die innere Verwandtschaft zweier Gruppen von Differentialgleichungen erkennt, an denen der Laie nichts als Differenzen sieht.
Man bemerkt leicht, daß im Grunde die Laune, nicht eine Idee, nicht das Gefühl einer Notwendigkeit die Wahl der Bilder bestimmt. Von einer Technik des Vergleichens blieben wir[S. 6] weit entfernt. Sie treten, gerade heute, massenhaft auf, aber planlos und ohne Zusammenhang und wenn sie einmal in einem tiefen, noch festzustellenden Sinne treffend sind, so verdankt man es dem Glück, seltener dem Instinkt, nie einem Prinzip. Noch hat niemand daran gedacht, hier eine Methode auszubilden. Man hat nicht im entferntesten geahnt, daß hier eine Wurzel, und zwar die einzige liegt, aus der eine große Lösung des Problems der Geschichte hervorgehen kann.
Die Vergleiche könnten das Glück des historischen Denkens sein, insofern sie die organische Struktur des Geschehens bloßlegen. Ihre Technik müßte unter der Einwirkung einer umfassenden Idee und also bis zur wahllosen Notwendigkeit, bis zur logischen Meisterschaft ausgebildet werden. Sie waren bisher ein Unglück, weil sie als eine bloße Angelegenheit des Geschmackes den Historiker der Einsicht und der Mühe überhoben, die Formensprache der Geschichte und ihre Analyse als seine schwerste und nächste, heute noch nicht einmal begriffene, geschweige denn gelöste Aufgabe zu betrachten. Sie waren teils oberflächlich, wenn man z. B. Cäsar den Begründer einer römischen Staatszeitung nannte, oder, noch schlimmer, entlegene, höchst komplexe und uns innerlich sehr fremde Phänomene des antiken Daseins mit Modeworten wie Sozialismus, Impressionismus, Kapitalismus, Klerikalismus belegte, teils von einer bizarren Verkehrtheit wie der Brutuskult, den man im Jakobinerklub trieb — den jenes Millionärs und Wucherers Brutus, der als Führer des römischen Uradels unter dem Beifall des patrizischen Senats den Mann der Demokratie erstach.
Und so erweitert sich die Aufgabe, die ursprünglich ein begrenztes Problem der modernen Zivilisation umfaßte, zu einer völlig neuen Philosophie, der Philosophie der Zukunft, wenn aus dem metaphysisch erschöpften Boden des Abendlandes überhaupt noch eine hervorgehen kann, der einzigen, die wenigstens zu den Möglichkeiten des westeuropäischen Geistes in seinen[S. 7] letzten Stadien gehört: zur Idee einer Morphologie der Weltgeschichte, der Welt als Geschichte, die im Gegensatz zur Morphologie der Natur, bisher dem einzigen Thema der Philosophie, alle Gestalten und Bewegungen der Welt in ihrer tiefsten und letzten Bedeutung noch einmal, aber in einer ganz andern Ordnung, nicht zum Gesamtbilde alles Erkannten, sondern zu einem Bilde des Lebens, nicht des Gewordenen, sondern des Werdens, zusammenfaßt.
Die Welt als Geschichte, aus ihrem Gegensatz, der Welt als Natur, begriffen, geschaut, gestaltet — das ist ein neuer Aspekt des Daseins, der bis heute nie angewandt, vielleicht dunkel gefühlt, oft geahnt, nie mit allen seinen Konsequenzen gewagt worden ist. Hier liegen zwei mögliche Arten vor, wie der Mensch seine Umwelt besitzen, erleben kann. Ich trenne der Form, nicht der Substanz nach mit vollster Schärfe den organischen vom mechanischen Welteindruck, den Inbegriff der Gestalten von dem der Gesetze, das Bild und Symbol von der Formel und dem System, das Einmalig-Wirkliche vom Beständig-Möglichen, das Ziel der planvoll ordnenden Einbildungskraft von dem der zweckmäßig zergliedernden Erfahrung oder, um einen noch nie bemerkten, sehr bedeutungsvollen Gegensatz schon hier zu nennen, den Geltungsbereich der chronologischen von dem der mathematischen Zahl.[1]
Es kann sich demnach in einer Untersuchung wie der vorliegenden nicht darum handeln, die an der Oberfläche des Tages sichtbar werdenden Ereignisse geistig-politischer Art als solche hinzunehmen, nach Ursache und Wirkung zu ordnen und in[S. 8] ihrer scheinbaren, verstandesmäßig faßlichen Tendenz zu verfolgen. Eine derartige — „pragmatische“ — Behandlung der Historie würde nichts als ein Stück verkappter Naturwissenschaft sein, woraus die Anhänger der materialistischen Geschichtsauffassung kein Hehl machen, während ihre Gegner sich nur der Identität des beiderseitigen Verfahrens nicht hinreichend bewußt sind. Es handelt sich nicht um das, was die greifbaren Tatsachen der Geschichte an und für sich, als Erscheinungen zu irgend einer Zeit sind, sondern um das, was sie durch ihre Erscheinung bedeuten, andeuten. Die Historiker der Gegenwart glauben ein übriges zu tun, wenn sie religiöse, soziale und allenfalls kunsthistorische Einzelheiten heranziehen, um den politischen Sinn einer Epoche zu „illustrieren“. Aber sie vergessen das Entscheidende — entscheidend nämlich, insofern sichtliche Geschichte Ausdruck, Zeichen, formgewordenes Seelentum ist. Ich habe noch keinen gefunden, der mit dem Studium dieser morphologischen Verwandtschaften Ernst gemacht hätte, der über den Bereich politischer Tatsachen hinaus die letzten und tiefsten Gedanken der Mathematik der Hellenen, Araber, Inder, Westeuropäer, den Sinn ihrer frühen Ornamentik, ihrer architektonischen, metaphysischen, dramatischen, lyrischen Urformen, die Auswahl und Richtung ihrer großen Künste, die Einzelheiten ihrer künstlerischen Technik und Stoffwahl eingehend gekannt, geschweige denn in ihrer entscheidenden Bedeutung für die Formprobleme des Historischen erkannt hätte. Wer weiß es, daß zwischen der Differentialrechnung und dem dynastischen Staatsprinzip der Zeit Ludwigs XIV., zwischen der antiken Staatsform der Polis und der euklidischen Geometrie, zwischen der Raumperspektive der abendländischen Ölmalerei und der Überwindung des Raumes durch Bahnen, Fernsprecher und Fernwaffen, zwischen der kontrapunktischen Instrumentalmusik und dem wirtschaftlichen Kreditsystem ein tiefer Zusammenhang der Form besteht? Selbst die realsten Faktoren der Politik nehmen, aus dieser Perspektive betrachtet, einen höchst transzendenten Charakter an und es geschieht vielleicht zum ersten Male, daß Dinge wie das ägyptische Verwaltungssystem, das antike Münzwesen, die analytische Geometrie, der Scheck,[S. 9] der Suezkanal, der chinesische Buchdruck, das preußische Heer und die römische Straßenbautechnik gleichmäßig als Symbole aufgefaßt und als solche gedeutet werden.
An diesem Punkte stellt es sich heraus, daß es eine spezifisch historische Art des Erkennens noch gar nicht gibt. Was man so nennt, zieht seine Methoden fast ausschließlich aus dem Gebiete des Wissens, auf welchem allein Methoden der Erkenntnis zur strengen Ausbildung gelangt sind, aus der Physik. Man glaubt Geschichtsforschung zu treiben, wenn man den gegenständlichen Zusammenhang von Ursache und Wirkung verfolgt. Es ist eine merkwürdige Tatsache, daß die Philosophie alten Stils an eine andre Möglichkeit der Beziehung des Geistes auf die Welt nie gedacht hat. Kant, der in seinem Hauptwerk die formalen Regeln der Erkenntnis feststellte, zog, ohne daß weder er noch irgend ein anderer es bemerkt hätte, allein die Natur als Objekt der Verstandestätigkeit in Betracht. Wissen ist für ihn mathematisches Wissen. Wenn er von angebornen Formen der Anschauung und Kategorien des Verstandes spricht, so denkt er nie an das ganz andersgeartete Begreifen historischer Phänomene, und Schopenhauer, der von Kants Kategorien bezeichnenderweise nur die der Kausalität gelten läßt, redet nur mit Verachtung von der Geschichte.[2] Daß außer der Notwendigkeit von Ursache und Wirkung — ich möchte sie die Logik des Raumes nennen — im Leben auch noch die organische Notwendigkeit des Schicksals — die Logik der Zeit — eine Tatsache von tiefster innerster Gewißheit ist, eine Tatsache, welche das gesamte mythologische, religiöse und künstlerische Denken ausfüllt, die das Wesen und den Kern aller Geschichte im Gegensatz zur Natur ausmacht, die aber den Erkenntnisformen, welche die „Kritik der reinen Vernunft“ untersucht, unzugänglich ist, das ist noch nicht in den Bereich intellektueller Formulierung gedrungen. Die Philosophie ist,[S. 10] wie Galilei an einer berühmten Stelle seines Saggiatore sagt, im großen Buche der Natur „scritta in lingua matematica“. Aber wir warten heute noch auf die Antwort eines Philosophen, in welcher Sprache die Geschichte geschrieben und wie diese zu lesen ist.
Die Mathematik und das Kausalitätsprinzip führen zu einer naturhaften, die Chronologie und die Schicksalsidee zu einer historischen Ordnung der Erscheinung. Beide Ordnungen umfassen die ganze Welt. Nur das Auge, in dem und durch das sich diese Welt verwirklicht, ist ein anderes.
Natur ist die Gestalt, unter welcher der Mensch hoher Kulturen den unmittelbaren Eindrücken seiner Sinne Einheit und Bedeutung gibt. Geschichte ist diejenige, aus welcher seine Einbildungskraft das lebendige Dasein der Welt in bezug auf das eigene Leben zu begreifen und diesem damit eine vertiefte Wirklichkeit zu verleihen sucht. Ob er dieser Gestaltungen fähig ist und welche von ihnen sein waches Bewußtsein beherrscht, das ist eine Urfrage aller menschlichen Existenz.
Hier liegen zwei Möglichkeiten der Weltbildung durch den Menschen vor. Damit ist schon gesagt, daß es nicht notwendig Wirklichkeiten sind. Fragen wir also im folgenden nach dem Sinn aller Geschichte, so ist zuerst eine Frage zu erledigen, die bisher nie gestellt worden ist. Für wen gibt es Geschichte? Eine paradoxe Frage, wie es scheint. Ohne Zweifel für jeden, insofern jeder Glied und Element der Geschichte ist. Aber man bedenke, daß die Gesamtheit der Geschichte wie das Ganze der Natur — das eine wie das andere ein Erscheinungsbild — einen Geist voraussetzt, in dem und durch den es Wirklichkeit ist. Ohne Subjekt gibt es kein Objekt. Sehen wir von aller Theorie ab, der die Philosophen tausend Fassungen gegeben haben, so steht es doch fest, daß Erde und Sonne, die Natur, der Raum, das Weltall ein persönliches Erlebnis und in ihrem So-und-nicht-anders-sein abhängig vom menschlichen Bewußtsein sind. Aber dasselbe gilt vom[S. 11] Weltbilde der Geschichte, dem werdenden, nicht dem ruhenden All, und selbst wenn man wüßte, was sie ist, so weiß man noch nicht, für wen sie es ist. Sicher nicht für „die Menschheit“. Das ist unsre, die westeuropäische Empfindung, aber wir sind nicht die „Menschheit“. Sicherlich gab es nicht nur für den Urmenschen, sondern auch für den Menschen gewisser hoher Kulturen keine Weltgeschichte, keine Welt als Geschichte. Wir wissen alle, daß in unserem kindlichen Weltbewußtsein zunächst nur naturhafte und kausale Züge und erst sehr viel später solche historischer Art, z. B. ein bestimmtes Zeitgefühl, hervortreten. Das Wort Ferne gewinnt für uns viel eher einen greifbaren Inhalt als das Wort Zukunft. Aber wie, wenn eine ganze Kultur, ein hohes Seelentum auf diesem ahistorischen Geiste beruht? Wie muß ihr die Wirklichkeit erscheinen? Die Welt? Das Leben? Bedenken wir, daß sich im Weltbewußtsein der Hellenen alles Erlebte, nicht nur die eigne persönliche, sondern die allgemeine Vergangenheit sofort in Mythus, d. h. in Natur, in zeitlose, unbewegliche, entwicklungslose Gegenwart verwandelte, dergestalt, daß die Geschichte Alexanders des Großen noch vor seinem Tode für das antike Gefühl mit der Dionysoslegende zu verschwimmen begann und daß Cäsar seine Abstammung von Venus mindestens nicht als widersinnig empfand, so müssen wir zugestehen, daß uns Menschen des Abendlandes mit dem starken Gefühl für zeitliche Distanzen ein Nacherleben solcher Seelenzustände beinahe unmöglich ist, daß wir aber nicht das Recht haben, dem Problem der Geschichte gegenüber von dieser Tatsache einfach abzusehen.
Was Tagebücher, Selbstbiographien, Bekenntnisse für den einzelnen, das bedeutet Geschichtsforschung im weitesten Umfange, wo sie auch alle Arten psychologischer Analyse fremder Völker, Zeiten, Sitten einschließt, für die Seele ganzer Kulturen. Aber die antike Kultur besaß kein Gedächtnis in diesem spezifischen Sinne, kein historisches Organ. Das Gedächtnis des antiken Menschen — wobei wir allerdings einen aus unserem seelischen Habitus abgeleiteten Begriff ohne weiteres einer fremden Seele aufprägen — ist etwas ganz anderes, weil hier Vergangenheit und Zukunft als ordnende[S. 12] Perspektiven im Bewußtsein fehlen und die reine „Gegenwart“, die Goethe an allen Äußerungen antiken Lebens, an der Plastik insbesondere so oft bewunderte, es mit einer uns ganz unbekannten Mächtigkeit ausfüllt. Diese reine Gegenwart, deren größtes Symbol die dorische Säule ist, stellt in der Tat eine Verneinung der Zeit (der Richtung) dar. Für Herodot und Sophokles wie für Themistokles und für einen römischen Konsul verflüchtigt sich die Vergangenheit alsbald in einen zeitlos ruhenden Eindruck von polarer, nicht periodischer Struktur, — denn das ist der letzte Sinn durchgeistigter Mythenbildung — während sie für unser Weltgefühl und inneres Auge ein periodisch klar gegliederter, zielvoll gerichteter Organismus von Jahrhunderten oder Jahrtausenden ist. Dieser Hintergrund aber gibt dem Leben, dem antiken wie dem abendländischen, erst seine besondere Farbe. Was der Grieche Kosmos nannte, war das Bild einer Welt, die nicht wird, sondern ist. Folglich war der Grieche selbst ein Mensch, der niemals wurde, sondern immer war.
Deshalb hat der antike Mensch, obwohl er die strenge Chronologie, die Kalenderrechnung und damit das starke, in großartiger Beobachtung der Gestirne und in der exakten Messung gewaltiger Zeiträume sich offenbarende Gefühl für die Ewigkeit und die Nichtigkeit des gegenwärtigen Augenblicks in der babylonischen und ägyptischen Kultur sehr wohl kannte, sich innerlich nichts davon zu eigen gemacht. Was seine Philosophen gelegentlich erwähnen, haben sie nur gehört, nicht geprüft. Weder Plato noch Aristoteles besaßen eine Sternwarte. In den letzten Jahren des Perikles wurde in Athen ein Volksbeschluß gefaßt, der jeden mit der schweren Klageform der Eisangelie bedrohte, der astronomische Theorien verbreitete. Es war ein Akt von tiefster Symbolik, in dem sich der Wille der antiken Seele aussprach, die Ferne in jedem Sinne aus ihrem Weltbewußtsein zu streichen.
Deshalb begannen die Hellenen erst dann — in der Person des Thukydides — ernsthaft über ihre Geschichte nachzudenken, als sie innerlich so gut wie abgeschlossen war. Aber selbst Thukydides, dessen methodische Grundsätze in der Einleitung seines Werkes sich sehr westeuropäisch ausnehmen,[S. 13] faßte sie doch so auf, daß er geschichtliche Einzelheiten erdichtet, sobald es ihm angemessen erscheint. Das wirkt bei ihm als künstlerisches Prinzip, aber gerade das nennen wir Mythenbildung. Von einem echten Sinn für die Bedeutung chronologischer Zahlen ist nicht die Rede. Im 3. Jahrhundert schrieben Manetho und Berossos — also Nichtgriechen — gründliche Quellenwerke über Ägypten und Babylon, zwei Länder, die sich auf Astronomie und also auch auf Historie verstanden. Aber der gebildete Grieche und Römer kümmerte sich wenig darum und zog weiterhin die romanhaften Phantastereien eines Hekataios und Ktesias vor.[3]
Infolgedessen ist die antike Geschichte bis auf die Perserkriege herab, aber auch noch die Struktur sehr viel späterer Perioden das Produkt wesentlich mythischen Denkens. Die Verfassungsgeschichte Spartas — Lykurg, dessen Biographie mit allen Einzelheiten erzählt wird, war vermutlich eine unbedeutende Waldgottheit des Taygetos — ist eine Dichtung der hellenistischen Zeit und die Erfindung der römischen Geschichte vor Hannibal war noch zur Zeit Cäsars nicht zum Stillstand gekommen. Es kennzeichnet den antiken Sinn des Wortes Geschichte, daß die alexandrinische Romanliteratur stofflich den stärksten Einfluß auf die ernsthafte politische und religiöse Historik ausübte. Man dachte gar nicht daran, ihren Inhalt von aktenmäßigen Daten grundsätzlich zu unterscheiden. Als Varro[S. 14] gegen Ende der Republik daran ging, die aus dem Bewußtsein des Volkes rasch schwindende römische Religion zu fixieren, teilte er die Gottheiten, deren Dienst vom Staate aufs peinlichste ausgeübt wurde, in di certi und di incerti ein — solche, von denen man noch etwas wußte, und solche, von denen trotz des fortdauernden öffentlichen Kultes nur der Name geblieben war. In der Tat war die Religion der römischen Gesellschaft seiner Zeit — wie sie nicht nur Goethe, sondern selbst Nietzsche ohne Argwohn aus den römischen Dichtern hinnahmen — größtenteils ein Erzeugnis der hellenisierenden Literatur und fast ohne Zusammenhang mit dem alten Kultus, den niemand mehr verstand.
Mommsen hat den westeuropäischen Standpunkt klar formuliert, als er die römischen Historiker — Tacitus ist vor allem gemeint — Leute nannte, „die das sagen, was verschwiegen zu werden verdiente, und das verschweigen, was notwendig war zu sagen“.
Die indische Kultur, deren Idee vom (bramanischen) Nirwana der entschiedenste Ausdruck einer vollkommen ahistorischen Seele ist, den es geben kann, hat nie das geringste Gefühl für das „Wann“ in irgend einem Sinne besessen. Es gibt keine indische Astronomie, keinen indischen Kalender, keine indische Historie also, insofern man darunter das Bewußtsein einer lebendigen Entwicklung versteht. Wir wissen vom sichtbaren Verlaufe dieser Kultur, deren organischer Teil vor der Entstehung des Buddhismus abgeschlossen war, noch viel weniger, als von der antiken, sicherlich an großen Ereignissen reichen Geschichte zwischen dem 12. und 8. Jahrhundert. Beide sind lediglich in traumhaft-mythischer Gestalt konserviert worden. Erst ein volles Jahrtausend nach Buddha, um 500 n. Chr., entstand auf Ceylon im „Mahavansa“ etwas, das entfernt an Geschichtsschreibung erinnert.
Das Bewußtsein des indischen Menschen war so ahistorisch angelegt, daß er nicht einmal das Phänomen des von einem Autor verfaßten Buches als zeitlich fixiertes Ereignis kannte. Statt einer organischen Reihe persönlich abgegrenzter Schriften entstand allmählich eine vage Textmasse, in die jeder hineinschrieb, was er wollte, ohne daß die Begriffe des individuellen[S. 15] geistigen Eigentums, der Entwicklung eines Gedankens, der geistigen Epoche eine Rolle gespielt hätten. In dieser anonymen Gestalt — der der gesamten indischen Geschichte — liegt uns die indische Philosophie vor. Mit ihr vergleiche man die durch Bücher und Personen physiognomisch aufs schärfste herausgearbeitete Philosophiegeschichte des Abendlandes.
Der indische Mensch vergaß alles, der ägyptische konnte nichts vergessen. Eine indische Kunst des Porträts — der Biographie in nuce — hat es nie gegeben; die ägyptische Plastik kannte kaum ein anderes Thema.
Die ägyptische Seele, eminent historisch veranlagt und mit urweltlicher Leidenschaft nach dem Unendlichen drängend, empfand die Vergangenheit und Zukunft als ihre ganze Welt und die Gegenwart, die mit dem wachen Bewußtsein identisch ist, erschien ihr lediglich als die schmale Grenze zwischen zwei unermeßlichen Fernen. Die ägyptische Kultur ist eine Inkarnation der Sorge — dem seelischen Korrelat der Ferne — der Sorge um das Künftige, wie sie sich in der Wahl von Granit und Basalt als plastischem Material,[4] in den gemeißelten Urkunden, in der Ausbildung eines meisterhaften Verwaltungssystems und dem Netz von Bewässerungsanlagen ausspricht,[5] und der notwendig damit verknüpften Sorge um das Vergangene. Die ägyptische Mumie ist ein Symbol höchsten Ranges. Man verewigte den Leib der Toten, wie man deren Persönlichkeit, dem „Ka“, durch die oft in vielen Exemplaren ausgeführten Bildnisstatuen, an deren in einem sehr hohen Sinne aufgefaßte Ähnlichkeit sie gebunden[S. 16] war, ewige Dauer verlieh. Bekanntlich waren in der besten Zeit der griechischen Plastik Bildnisstatuen ausdrücklich verpönt.
Es besteht eine tiefe Beziehung zwischen dem Verhalten gegen die historische Vergangenheit und der Auffassung des Todes, wie sie sich in der Form der Bestattung ausspricht. Der Ägypter verneint die Vergänglichkeit, der antike Mensch bejaht sie durch die gesamte Formensprache seiner Kultur. Die Ägypter konservierten auch die Mumie ihrer Geschichte: die chronologischen Daten und Zahlen. Während von der vorsolonischen Geschichte der Griechen nichts überliefert ist, keine Jahreszahl, kein echter Name, kein greifbares Ereignis — was dem uns allein bekannten Rest einen übertriebenen Akzent gibt — kennen wir aus dem 3. Jahrtausend beinahe alle Namen und Regierungszahlen der ägyptischen Könige und die späteren Ägypter kannten sie natürlich ohne Ausnahme. Als ein grauenvolles Symbol dieses Willens zur Dauer liegen noch heute die Körper der großen Pharaonen mit kenntlichen Gesichtszügen in unseren Museen. Auf der leuchtend polierten Granitspitze der Pyramide Amenemhets III. liest man noch jetzt die Worte: „Amenemhet schaut die Schönheit der Sonne“ und auf der andern Seite: „Höher ist die Seele Amenemhets als die Höhe des Orion und sie verbindet sich mit der Unterwelt.“ Das ist Überwindung der Vergänglichkeit, der Gegenwart und unantik im höchsten Maße.
Gegenüber dieser mächtigen Gruppe ägyptischer Lebenssymbole erscheint an der Schwelle der antiken Kultur, der Vergessenheit[S. 17] entsprechend, die sie über jedes Stück ihrer äußern und innern Vergangenheit breitet, die Verbrennung der Toten. Der mykenischen Zeit war die sakrale Heraushebung dieser Bestattungsform aus den übrigen, die von primitiven Völkern in der Regel nebeneinander ausgeübt werden, durchaus fremd. Die Königsgräber sprechen sogar für den Vorrang der Erdbestattung. Aber in der homerischen Zeit so gut wie in der vedischen erfolgt der plötzliche, materiell nicht zu motivierende Schritt vom Begräbnis zur Verbrennung, die, wie die Ilias zeigt, mit dem vollen Pathos eines sinnbildlichen Aktes — der feierlichen Vernichtung, der Verneinung der historischen Dauer — vollzogen wurde.
Von diesem Augenblick an ist auch die Plastizität der individuellen seelischen Entwicklung zu Ende. So wenig das antike Drama echt historische Motive gestattet, so wenig läßt es das Thema der innern Entwicklung zu und man weiß, wie entschieden sich der hellenische Instinkt gegen das Porträt in der bildenden Kunst auflehnte. Bis in die Kaiserzeit kennt die antike Kunst nur einen ihr gewissermaßen natürlichen Stoff: den Mythus.[6] Auch die idealen Bildnisse der hellenistischen Plastik sind mythisch, so gut es die typischen Biographien von der Art Plutarchs sind. Kein großer Grieche hat je Erinnerungen niedergeschrieben, die eine überwundene Epoche vor seinem geistigen Auge fixiert hätten. Nicht einmal Sokrates hat über sein Innenleben etwas in unserm Sinne Bedeutendes gesagt. Es fragt sich, ob in einer antiken Seele dergleichen überhaupt möglich war, wie es der Entwurf des Parzeval, Hamlet, Werther voraussetzt. Wir vermissen bei Plato jedes Bewußtsein einer Entwicklung seiner Lehre. Seine einzelnen Schriften sind lediglich[S. 18] Formulierungen sehr verschiedener Standpunkte, die er zu verschiedenen Zeiten einnahm. Ihr genetischer Zusammenhang war kein Gegenstand seiner Reflexion. Der einzige — flache — Versuch einer Selbstanalyse, der antiken Kultur kaum noch angehörend, findet sich in Ciceros Brutus. Aber schon am Anfang der abendländischen Geistesgeschichte steht ein Stück tiefster Selbsterforschung, Dantes Vita Nuova. Allein daraus folgt, wie wenig Antikes, d. h. rein Gegenwärtiges, Goethe in sich hatte, der nichts vergaß, dessen Werke seinen eigenen Worten nach nur Bruchstücke einer großen Konfession waren.
Nach der Zerstörung Athens durch die Perser warf man alle Werke der älteren Kunst in den Schutt — aus dem wir sie heute wieder hervorziehen — und man hat nie gehört, daß jemand in Hellas sich um die Ruinen von Mykene oder Phaistos gekümmert hätte. Man las seinen Homer, aber man dachte nicht daran, wie Schliemann den Hügel von Troja aufzugraben. Man wollte den Mythus, nicht die Geschichte. Von den Werken des Aischylos und der vorsokratischen Philosophen war schon in hellenistischer Zeit ein Teil verloren gegangen. Aber schon Petrarca sammelte Altertümer, Münzen, Manuskripte mit einer nur dieser Kultur eigenen Pietät und Innerlichkeit der Betrachtung, als historisch fühlender, auf entlegene Welten zurückschauender, nach dem Fernen sich sehnender Mensch — er war der erste, der die Besteigung eines Alpengipfels unternahm —, der im Grunde ein Fremder in seiner Zeit war. Erst aus dieser Verknüpfung mit dem Zeitproblem entwickelt sich die Psychologie des Sammlers. Man fühlt, weshalb dieser Kultus des Vergangenen, der ihm Unvergänglichkeit erteilen möchte, dem antiken Menschen völlig unbekannt bleiben mußte, während die ägyptische Landschaft sich schon zur Zeit des großen Thutmosis in ein einziges ungeheures Museum von Tradition und Architektur verwandelt hatte.
Unter den Völkern des Abendlandes waren es die Deutschen, welche die mechanischen Uhren erfanden, schauerliche Symbole der rinnenden Zeit, deren Tag und Nacht von zahllosen Türmen über Westeuropa hin hallende Schläge vielleicht der ungeheuerste Ausdruck sind, dessen ein historisches[S. 19] Weltgefühl überhaupt fähig ist.[7] Nichts davon begegnet uns in den zeitlosen antiken Landschaften und Städten. In Babylon und Ägypten waren die Wasser- und Sonnenuhren erfunden worden, aber erst Plato führte die Klepsydra — wiederum erst gegen Ende des blühenden Griechentums — in Athen ein und noch später übernahm man die Sonnenuhren, lediglich als unwesentliches Gerät des Alltags, ohne daß sie das antike Lebensgefühl im geringsten verändert hätten.
Hier ist noch der entsprechende, sehr tiefe und nie hinreichend gewürdigte Unterschied zwischen antiker und abendländischer Mathematik zu erwähnen. Das antike Zahlendenken faßt die Dinge auf, wie sie sind, als Größen, zeitlos, rein gegenwärtig. Das führte zur euklidischen Geometrie, zur mathematischen Statik und zum Abschluß des geistigen Systems durch die Lehre von den Kegelschnitten. Wir fassen die Dinge auf, wie sie werden und sich verhalten, als Funktionen. Das führte zur Dynamik, zur analytischen Geometrie und von ihr zur Differentialrechnung.[8] Die moderne Funktionentheorie ist die riesenhafte Ordnung dieser ganzen Gedankenmasse. Es ist eine bizarre, aber seelisch streng begründete Tatsache, daß die griechische Physik — als Statik im Gegensatz zur Dynamik — den Gebrauch der Uhr nicht kennt und nicht vermissen läßt und, während wir mit Tausendsteln von Sekunden rechnen, von Zeitmessungen vollständig absieht. Die Entelechie des Aristoteles ist der einzige zeitlose — ahistorische — Entwicklungsbegriff, den es gibt.
Damit ist unsere Aufgabe festgelegt, insofern Leben die Verwirklichung von seelisch Möglichem ist und der neue Begriff[S. 20] des seelisch Unmöglichen den Aspekt der Dinge anders gestaltet. Wir Menschen der westeuropäischen Kultur — einem genau abgrenzbaren Phänomen zwischen 1000 und 2000 n. Chr. — sind die Ausnahme und nicht die Regel. „Weltgeschichte“ ist unser Weltbild, nicht das „der Menschheit“. Für den indischen und den antiken Menschen gab es kein Bild der werdenden Welt als Art und Form der Anschauung und vielleicht wird es, wenn die Zivilisation des Abendlandes, deren Träger wir Heutigen sind, erloschen ist, nie wieder eine Kultur und also einen menschlichen Typus geben, für den „Weltgeschichte“ eine Form, ein Inhalt des kosmischen Bewußtseins ist.
Ja — was ist Weltgeschichte? Eine geistige Möglichkeit, ein inneres Postulat, der Ausdruck eines Formgefühls, gewiß. Aber ein noch so bestimmtes Gefühl ist keine vollendete Form, und so sicher wir alle Weltgeschichte fühlen, erleben, mit vollster Gewißheit ihrer Gestalt nach zu übersehen glauben, so sicher ist es, daß wir noch heute Formen von ihr, aber nicht die Form kennen.
Sicherlich wird jeder, den man fragt, überzeugt sein, daß er die periodische Struktur der Geschichte klar und deutlich durchschaut. Diese Illusion beruht darauf, daß niemand ernsthaft über sie nachgedacht hat und daß man noch viel weniger an seinem Wissen zweifelt, weil niemand ahnt, an was allem hier gezweifelt werden könnte. In der Tat ist die Gestalt der Weltgeschichte ein ungeprüfter geistiger Besitz, der sich, auch unter Historikern von Beruf, von Generation zu Generation unberührt vererbt und dem ein kleiner Teil der Skepsis, welche seit Galilei das uns angeborne Naturbild zergliedert und vertieft hat, sehr not täte.
Altertum — Mittelalter — Neuzeit: das ist das unglaubwürdig dürftige und sinnlose Schema, dessen absolute Herrschaft über unser historisches Bewußtsein uns immer wieder gehindert hat, die eigentliche Stellung der kleinen[S. 21] Teilwelt, wie sie sich seit der deutschen Kaiserzeit auf dem Boden des westlichen Europa entfaltet hat, in ihrem Verhältnis zur Weltgeschichte — zur Gesamtgeschichte des höhern Menschentums also — nach ihrem Range, ihrer Gestalt, ihrer Lebensdauer vor allem richtig aufzufassen. Es wird künftigen Kulturen kaum glaublich erscheinen, daß dieser Grundriß mit seinem einfältigen geradlinigen Ablauf, seinen unsinnigen Proportionen, der von Jahrhundert zu Jahrhundert sinnloser wird und eine natürliche Eingliederung der neu in das Licht unsres historischen Bewußtseins tretenden Gebiete gar nicht zuläßt, gleichwohl in seiner Gültigkeit niemals angezweifelt worden ist. Selbst die Kritik, die an ihm geübt, und die weitgehenden Modifikationen, denen er notgedrungen unterworfen wurde — z. B. die Verlagerung des Anfangspunktes der „Neuzeit“ von den Kreuzzügen zur Renaissance und von dort zum Anfang des 19. Jahrhunderts —, beweisen nur, daß man ihn selbst für unerschütterlich, beinahe für das Resultat einer göttlichen Erleuchtung, mindestens für selbstverständlich hielt, sozusagen für eine apriorische Form der historischen Anschauung, wie sie Kant beschreibt.
Aber diese schlechthin geltende Form ließ keinerlei Vertiefung zu, und da man auf sie nicht verzichtete, so verzichtete man auf ein eigentliches Begreifen weltgeschichtlicher Zusammenhänge. Ihr hat man es zu verdanken, daß die großen morphologischen Probleme der Geschichte gar nicht in Erscheinung treten konnten. Sie hat die formale Betrachtung der Historie auf einem Niveau gehalten, dessen man sich in andern Wissenschaften geschämt hätte.
Es genügt, darauf hinzuweisen, daß dieser Grundriß einen oberflächlichen Anfang und ein Ende dort setzt, wo in tieferem Sinne von Anfang und Ende nicht die Rede sein kann. Hier bildet die Landschaft des westlichen Europa[9] den ruhenden[S. 22] Pol (mathematisch gesprochen einen singulären Punkt auf einer Kugeloberfläche) — man weiß nicht warum, wenn nicht dies der Grund ist, daß wir, die Konstruktoren dieses Geschichtsbildes, gerade hier zu Hause sind — um den sich Jahrtausende gewaltigster Geschichte und fernab gelagerte ungeheure Kulturen in aller Bescheidenheit drehen. Das ist ein Planetensystem von höchst eigenartiger Erfindung. Man wählt einen einzelnen Fleck zum Schwerpunkt eines historischen Systems. Hier ist die Zentralsonne. Von hier aus erhalten die Ereignisse der Geschichte das rechte Licht. Von hier aus wird ihre Bedeutung perspektivisch abgemessen. Aber hier redet in Wirklichkeit die durch keine Skepsis gezügelte Eitelkeit des westeuropäischen Menschen, in dessen Geiste sich dies Phantom „Weltgeschichte“ entrollt. Ihr verdankt man die uns längst zur Gewohnheit gewordene ungeheure optische Täuschung, wonach der historische Stoff von Jahrtausenden in einiger Entfernung, etwa in Altägypten und China, zu Miniaturen zusammenschrumpft, während die Jahrzehnte in der Nähe des eignen Standortes, seit Luther und besonders seit[S. 23] Napoleon, gespensterhaft anschwellen. Wir wissen, daß nur scheinbar eine Wolke um so langsamer wandert, je höher sie steht und ein Zug durch eine ferne Landschaft nur scheinbar schleicht, aber wir glauben, daß das Tempo der frühen indischen, babylonischen, ägyptischen Geschichte wirklich langsamer war als das unsrer nächsten Vergangenheit. Und wir finden ihre Substanz dünner, ihre Formen gedämpfter und gestreckter, weil wir nicht gelernt haben, die — innere und äußere — Entfernung in Rechnung zu stellen. Nirgends wird der Mangel an geistiger Freiheit, an Selbstkritik, der die historische Methode heute von jeder andern zu ihrem Nachteil unterscheidet, deutlicher als hier.
Daß für die Kultur des Abendlandes, die — sagen wir seit Napoleon — für absehbare Zeit der Welt wenigstens oberflächlich ihre Formen aufprägt, das Dasein von Athen, Florenz, Paris wichtiger ist als vieles andre, versteht sich von selbst. Aber diesen Umstand, weil gerade wir im Zusammenhange dieser Kultur leben, zum struktiven Prinzip einer Universalgeschichte zu machen, verrät den Horizont eines Provinzialen. Es würde den chinesischen Historiker berechtigen, seinerseits eine Weltgeschichte zu entwerfen, in der die Kreuzzüge und die Renaissance, Cäsar und Friedrich der Große als belanglos mit Stillschweigen übergangen werden. Es steht dem Tagespolitiker und dem Sozialkritiker frei, in der Bewertung andrer Zeiten seinen privaten Geschmack walten zu lassen, so wie es dem chemischen Techniker freisteht, praktisch das Gebiet der Benzolderivate als das wichtigste Kapitel der Naturwissenschaften zu behandeln und etwa die Elektrodynamik unbeachtet zu lassen, aber der Denker hat seine Person aus seinen Kombinationen auszuschalten. Warum ist, morphologisch betrachtet, das 18. Jahrhundert wichtiger zu nehmen als eins der sechzig voraufgehenden? Ist es nicht lächerlich, eine „Neuzeit“ vom Umfang einiger Jahrhunderte, noch dazu wesentlich in Westeuropa lokalisiert, einem „Altertum“ gegenüberzustellen, das ebensoviel Jahrtausende umfaßt und dem die Masse aller vorgriechischen Kulturen ohne den Versuch einer tiefern Gliederung einfach als Anhang zugerechnet wird? Hat man nicht, um das verjährte Schema zu retten, Ägypten und Babylon, deren in sich geschlossene Historien, jede für sich, allein die angebliche[S. 24] „Weltgeschichte“ von Karl dem Großen bis zum Weltkriege und weit darüber hinaus aufwiegt, als Vorspiel zur Antike abgetan, die mächtigen Komplexe der indischen und chinesischen mit einer Miene der Verlegenheit in eine Anmerkung verwiesen und die großen amerikanischen Kulturen, weil ihnen der „Zusammenhang“ (womit?) fehlt, überhaupt ignoriert? Das ist unsre „Weltgeschichte“. So denkt der Neger, der die Welt in sein Dorf, seinen Stamm und den „Rest“ einteilt und der den Mond für viel kleiner ansieht als die Wolken, die ihn verschlingen.
Ich nenne dies dem Westeuropäer geläufige Schema, in dem die hohen Kulturen ihre Bahnen um uns als den vermeintlichen Mittelpunkt alles Weltgeschehens ziehen, das ptolemäische System der Geschichte und ich betrachte es als die kopernikanische Entdeckung im Bereich der Historie, daß in diesem Buche ein neues System, das System an seine Stelle tritt, in dem als wechselnde Erscheinungen und Ausdrücke des einen, in der Mitte ruhenden Lebens Antike und Abendland neben Indien, Babylon, China, Ägypten, dem Arabertum und der Mayakultur — Einzelwelten des Werdens, die im Gesamtbilde der Geschichte ebenso schwer wiegen, die an Großartigkeit der seelischen Konzeption, an Gewalt des Aufstiegs das Hellenentum vielfach übertreffen — eine in keiner Weise bevorzugte Stellung einnehmen.
Das Schema Altertum — Mittelalter — Neuzeit ist eine durch die Kirche übermittelte Schöpfung der Gnosis — also des semitischen, insbesondere syrisch-jüdischen Weltgefühls während der römischen Kaiserzeit.
Innerhalb der sehr engen Grenzen, welche die geistige Voraussetzung dieser bedeutenden Konzeption bilden, bestand sie durchaus zu Recht. Hier fällt weder die indische noch selbst die ägyptische Geschichte in den Kreis der Betrachtung. Das Wort Weltgeschichte bezeichnet im Munde dieser Denker einen einmaligen, höchst dramatischen Akt, dessen Schauplatz die Landschaft[S. 25] zwischen Hellas und Persien war. In ihm gelangt das streng dualistische Weltgefühl des Morgenländers zum Ausdruck, nicht polar wie in der gleichzeitigen Metaphysik durch den Gegensatz von Seele und Geist, sondern periodisch,[10] als Katastrophe gesehen, als Wende zweier Zeitalter zwischen Weltschöpfung und Weltuntergang, unter Absehen von allen Elementen, die nicht einerseits durch die antike Literatur, andrerseits durch die Bibel fixiert waren. In diesem Weltbilde erscheint als „Altertum“ und „Neuzeit“ der damals handgreifliche Gegensatz von heidnisch und christlich, antik und orientalisch, Statue und Dogma, Natur und Geist in zeitlicher Fassung, als Prozeß der Überwindung des einen durch das andre. Der historische Übergang trägt die religiösen Merkmale einer Erlösung. Ohne Zweifel ein auf engen, durchaus provinzialen Ansichten beruhender, aber logischer und in sich vollkommener Aspekt, der indessen an dieser Landschaft und diesem Menschentum haftete und keiner natürlichen Erweiterung fähig war.
Erst durch die additive Hinzufügung eines dritten Zeitalters — unsrer „Neuzeit“ — auf abendländischem Boden ist in das Bild eine Bewegungstendenz gekommen. Das orientalische Gegenbild war ruhend, eine geschlossene, im Gleichgewicht verharrende Antithese, mit einer einmaligen göttlichen Aktion als Mitte. Das so sterilisierte Fragment der Geschichte, von einer ganz neuen Art Mensch aufgenommen und getragen, wurde nun plötzlich, ohne daß man sich des Bizarren einer solchen Änderung bewußt worden wäre, in Gestalt einer Linie fortgesponnen, die von Homer oder Adam — die Möglichkeiten sind heute durch die Indogermanen, die Steinzeit und den Affenmenschen bereichert — über Jerusalem, Rom, Florenz und Paris hinauf oder hinab führte, je nach dem persönlichen Geschmack des Historikers, Denkers oder Künstlers, der das dreiteilige Bild mit schrankenloser Freiheit interpretierte.
[S. 26]
Man fügte also den komplementären Begriffen Heidentum und Christentum — beide sukzessiv, als Weltalter gefaßt — den abschließenden einer „Neuzeit“ hinzu, die scherzhafterweise ihrerseits eine Fortsetzung des Verfahrens nicht gestattet und, nachdem sie seit den Kreuzzügen wiederholt „gestreckt“ worden ist, einer weiteren Dehnung nicht fähig erscheint. Man war, ohne es auszusprechen, der Meinung, daß hier jenseits von Altertum und Mittelalter etwas Endgültiges beginne, ein drittes Reich, in dem irgendwie eine Erfüllung lag, ein Höhepunkt, ein Ziel, das erkannt zu haben von den Scholastikern an bis zu den Sozialisten unserer Tage jeder sich allein zuschrieb. Es war das eine ebenso bequeme als für ihren Urheber schmeichelhafte Einsicht in den Lauf der Dinge. Man hatte ganz einfach den Geist des Abendlandes mit dem Sinn der Welt verwechselt. Aus einer geistigen Not haben dann große Denker eine metaphysische Tugend gemacht, indem sie das durch den consensus omnium geheiligte Schema, ohne es einer ernsthaften Kritik zu unterwerfen, zur Basis einer Philosophie machten und als Urheber ihres jeweiligen „Weltplanes“ Gott bemühten. Die mystische Dreizahl der Weltalter hatte für den metaphysischen Geschmack ohnehin etwas höchst Verführerisches. Herder nannte die Geschichte eine Erziehung des Menschengeschlechts, Kant eine Entwicklung des Begriffs der Freiheit, Hegel eine Selbstentfaltung des Weltgeistes, andre anders. In Entwürfen dieser Art hat sich die historische Gestaltungskraft aber bereits erschöpft.
Die Idee eines dritten Reiches kannte schon der Abt Joachim von Floris († 1202), der die drei Phasen mit den Symbolen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes in Verbindung brachte. Lessing, der seine Zeit im Hinblick auf die Antike mehrmals geradezu als Nachwelt bezeichnet, hat den Gedanken für seine „Erziehung des Menschengeschlechts“ (mit den Stufen des Kindes, Jünglings und Mannes) aus den Lehren der Mystiker des 14. Jahrhunderts übernommen, und Ibsen, der ihn in seinem Drama „Kaiser und Galiläer“ (wo das gnostische Weltdenken in der Gestalt des Zauberers Maximos unmittelbar hineinragt) gründlich behandelte, ist in seiner bekannten[S. 27] Stockholmer Rede von 1887 keinen Schritt darüber hinausgekommen. Augenscheinlich ist es eine Forderung des westeuropäischen Selbstgefühls, mit der eignen Erscheinung eine Art Abschluß zu statuieren.
Aber es ist eine völlig unhaltbare Manier, Weltgeschichte zu deuten, indem man seiner politischen, religiösen oder sozialen Oberzeugung die Zügel schießen und den drei Phasen, an denen man nicht zu rütteln wagt, eine Richtung angedeihen läßt, die genau dem eignen Standort zuführt, und je nachdem die Reife des Verstandes, die Humanität, das Glück der Meisten, die wirtschaftliche Evolution, die Aufklärung, die Freiheit der Völker, die Unterwerfung der Natur, die wissenschaftliche Weltanschauung und dergleichen als absoluten Maßstab an Jahrtausende anlegt, von denen man beweist, daß sie das Richtige nicht begriffen oder nicht erreicht haben, während sie in Wirklichkeit nur etwas andres wollten als wir. „Es kommt offenbar im Leben aufs Leben und nicht auf ein Resultat desselben an“ — das ist ein Wort Goethes, das man allen törichten Versuchen, das Geheimnis der historischen Form durch ein Programm zu enträtseln, entgegenstellen sollte.
Das gleiche Bild wird von den Historikern jeder einzelnen Kunst und Wissenschaft, Nationalökonomie und Philosophie nicht zu vergessen, gezeichnet. Da sehen wir „die“ Malerei von den Ägyptern (oder den Höhlenmenschen) bis zu den Impressionisten, „die“ Musik vom blinden Sänger Homers bis nach Bayreuth, „die“ Gesellschaftsordnung von den Pfahlbaubewohnern bis zum Sozialismus in linienhaftem Aufstieg begriffen, dem irgendeine gleichbleibende Tendenz zugrunde gelegt wird, ohne daß man die Möglichkeit ins Auge faßt, daß Künste eine gemessene Lebensdauer besitzen, daß sie an eine Landschaft und eine bestimmte Art Mensch als dessen Ausdruck gebunden sind, daß also diese Gesamtgeschichten lediglich eine äußerliche Summierung einer Anzahl von Einzelphänomenen, von Sonderkünsten sind, die nichts als den Namen und einiges der handwerklichen Technik gemein haben.
Dieser Weltblick ist nicht ohne Komik. Auf jedem andern Gebiete der lebendigen Natur nehmen wir das Recht in Anspruch, aus der Erscheinung selbst, sei es durch Erfahrung, sei[S. 28] es durch intuitives Erfassen des innern Wesens, die Gestalt abzuleiten, welche ihrem Dasein zugrunde liegt. Wir wissen, daß die Lebensphänomene eines Tieres, einer Pflanze auf die der verwandten Arten schließen lassen, daß alles Lebende eine geheimnisvolle Ordnung, die mit Gesetz, Kausalität, Zahl nichts zu tun hat, in sich trägt und wir ziehen daraus die morphologischen Folgerungen. Nur hier, wo es sich um den Menschen selbst handelt, lassen wir die historische Form seines Daseins, die irgendwann einmal behauptet worden ist, ohne Nachprüfung gelten und zwingen die Tatsachen, so gut oder schlecht es geht, in das vorgefaßte Schema. Geht es nicht — um so schlimmer für die Tatsachen. Wir behandeln sie mit Verachtung wie die Geschichte der Chinesen oder würdigen sie überhaupt keines Blickes wie die Kultur der Maya. Sie haben „zum Bau der Weltgeschichte nichts beigetragen“ — ein köstlicher Ausspruch.
Von jedem Organismus wissen wir, daß Tempo, Gestalt und Dauer seines Lebens und jeder einzelnen Lebensäußerung bestimmt sind. Niemand wird von einer tausendjährigen Eiche erwarten, daß sie eben jetzt im Begriff ist, mit dem eigentlichen Lauf ihrer Entwicklung zu beginnen. Niemand erwartet von einer Raupe, die er täglich wachsen sieht, daß sie möglicherweise ein paar Jahre damit fortfährt. Hier hat jeder mit unbedingter Gewißheit das Gefühl einer Grenze, das mit einem Gefühl für organische Formen identisch ist. Der Geschichte des höhern Menschentums gegenüber aber herrscht ein grenzenlos trivialer Optimismus in bezug auf die Zukunft. Hier schweigt alle psychologische und physiologische Erfahrung, so daß jedermann im zufällig Gegenwärtigen die „Ansätze“ zu einer ganz besonders hervorragenden linienhaften „Weiterentwicklung“ feststellt, weil er sie wünscht. Hier wird mit schrankenlosen Möglichkeiten — nie mit einem natürlichen Ende — gerechnet und aus der Lage jedes Augenblicks heraus eine höchst naive Konstruktion der Fortsetzung entworfen.
Aber „die Menschheit“ hat kein Ziel, keine Idee, keinen Plan, so wenig die Gattung der Schmetterlinge oder der Orchideen ein Ziel hat. „Die Menschheit“ ist ein leeres Wort. Man lasse dies Phantom aus dem Umkreis der historischen Formprobleme[S. 29] schwinden und man wird einen überraschenden Reichtum wirklicher Formen auftauchen sehen. Hier ist eine unermeßliche Fülle, Tiefe und Bewegtheit des Lebendigen, die bis jetzt durch eine Phrase, durch ein dürres Schema, durch persönliche „Ideale“ verdeckt wurde. Ich sehe statt des monotonen Bildes einer linienförmigen Weltgeschichte, das man nur aufrecht erhält, wenn man vor der überwiegenden Zahl der Tatsachen das Auge schließt, das Phänomen einer Vielzahl mächtiger Kulturen, die mit urweltlicher Kraft aus dem Schoße einer mütterlichen Landschaft, an die jede von ihnen im ganzen Verlauf ihres Daseins streng gebunden ist, aufblühen, von denen jede ihrem Stoff, dem Menschentum, ihre eigne Form aufprägt, von denen jede ihre eigne Idee, ihre eignen Leidenschaften, ihr eignes Leben, Wollen, Fühlen, ihren eignen Tod hat. Hier gibt es Farben, Lichter, Bewegungen, die noch kein geistiges Auge entdeckt hat. Es gibt aufblühende und alternde Kulturen, Völker, Sprachen, Wahrheiten, Götter, Landschaften, wie es junge und alte Eichen und Pinien, Blüten, Zweige, Blätter gibt, aber es gibt keine alternde „Menschheit“. Jede Kultur hat ihre eignen Möglichkeiten des Ausdrucks, die erscheinen, reifen, verwelken und nie wiederkehren. Es gibt viele, im tiefsten Wesen völlig voneinander verschiedene Plastiken, Malereien, Mathematiken, Physiken, jede von begrenzter Lebensdauer, jede in sich selbst geschlossen, wie jede Pflanzenart ihre eignen Blüten und Früchte, ihren eignen Typus von Wachstum und Niedergang hat. Diese Kulturen, Lebewesen höchsten Ranges, wachsen in einer erhabenen Zwecklosigkeit auf, wie die Blumen auf dem Felde. Sie gehören, wie Pflanzen und Tiere, der lebendigen Natur Goethes, nicht der toten Natur Newtons an. Ich sehe in der Weltgeschichte das Bild einer ewigen Gestaltung und Umgestaltung, eines wunderbaren Werdens und Vergehens organischer Formen. Der zünftige Historiker aber sieht sie in der Gestalt eines Bandwurms, der unermüdlich Epochen „ansetzt“.
Indessen hat die Kombination „Altertum — Mittelalter — Neuzeit“ endlich ihre Wirkung erschöpft. So winkelhaft eng und flach sie war, so stellte sie doch die einzige nicht ganz unphilosophische Fassung dar, die wir besaßen, und was als Weltgeschichte[S. 30] literarisch geordnet wurde, hat ihr den Rest von philosophischem Gehalt zu verdanken; aber die Zahl von Jahrhunderten, die durch dies Schema höchstens zusammengehalten werden konnte, ist längst erreicht. Das traditionelle Bild beginnt sich bei rascher Zunahme des historischen Stoffes, namentlich des außerhalb dieser Ordnung liegenden, in ein unübersehbares Chaos aufzulösen. Jeder nicht ganz blinde Historiker weiß und fühlt das und nur um nicht ganz zu versinken, hält er um jeden Preis das einzige ihm bekannte Schema fest. Das Wort Mittelalter, 1667 von Professor Horn in Leyden geprägt, muß heute eine formlose, sich beständig ausdehnende Masse decken, die rein negativ durch das begrenzt wird, was sich unter keinem Vorwand den beiden andern, leidlich geordneten Komplexen zurechnen läßt. Die unsichere Behandlung und Wertung der neupersischen, arabischen und russischen Geschichte sind Beispiele dafür. Vor allem läßt sich der Umstand nicht länger verhehlen, daß diese angebliche Geschichte der Welt sich anfangs tatsächlich auf die Region des östlichen Mittelmeeres und später, seit der Völkerwanderung, einem nur für uns wichtigen und deshalb stark vergrößerten, in Wirklichkeit rein lokalen Ereignis, das schon die arabische Kultur nichts angeht, mit einem plötzlichen Wechsel des Schauplatzes auf das mittlere Westeuropa beschränkt. Hegel hatte in aller Naivität erklärt, daß er die Völker, die in sein System der Geschichte nicht paßten, ignorieren werde. Aber das war nur ein ehrliches Eingeständnis von methodischen Voraussetzungen, ohne die kein Historiker zum Ziele kam. Man kann die Disposition sämtlicher Geschichtswerke daraufhin prüfen. Es ist heute in der Tat eine Frage des wissenschaftlichen Taktes, welche der historischen Phänomene man ernsthaft mitzählt und welche nicht. Ranke ist ein gutes Beispiel dafür.
Wir denken heute in Erdteilen. Nur unsere Philosophen und Historiker haben das noch nicht gelernt. Was können uns da Gedanken und Perspektiven bedeuten, die mit dem Anspruch[S. 31] auf universale Gültigkeit hervortreten und deren Horizont über die geistige Atmosphäre des westeuropäischen Menschen nicht hinausreicht?
Man sehe sich daraufhin unsre besten Bücher an. Wenn Plato von der Menschheit redet, so meint er den Hellenen im Gegensatz zum Barbaren. Das entspricht durchaus dem ahistorischen Stil des antiken Lebens und Denkens und führt unter dieser Voraussetzung zu folgerichtigen Resultaten. Wenn aber Kant philosophiert, über ethische Ideale zum Beispiel, so behauptet er die Gültigkeit seiner Sätze für die Menschen aller Arten und Zeiten. Er spricht das nur nicht aus, weil es für ihn und seine Leser allzu selbstverständlich ist. Er formuliert in seiner Ästhetik nicht das Prinzip der Kunst des Phidias oder der Kunst Rembrandts, sondern gleich das der Kunst überhaupt. Aber was er an notwendigen Formen des Denkens feststellt, sind doch nur die notwendigen Formen des abendländischen Denkens. Ein Blick auf Aristoteles und dessen wesentlich andre Resultate hätte lehren sollen, daß hier nicht ein weniger klarer, sondern ein anders angelegter Geist über sich reflektiert. Russischen Philosophen wie Solovjeff ist der kosmische Solipsismus,[11] der Kants Vernunftkritik zugrunde liegt (jede noch so abstrakte Theorie ist der Ausdruck eines Weltgefühls) und sie für den westeuropäischen Menschen zum wahrsten aller Systeme macht, unverständlich und für den modernen Chinesen und Araber mit ihren ganz anders gearteten Intellekten hat die Lehre Kants lediglich den Wert einer Kuriosität.
Das ist es, was dem abendländischen Denker fehlt und gerade ihm nicht fehlen sollte: die Einsicht in den historisch-relativen Charakter seiner Resultate, die selbst Ausdruck eines und nur dieses einen Daseins sind, das Wissen um die notwendigen Grenzen der Gültigkeit, die Überzeugung, daß seine „unumstößlichen Wahrheiten“ und „ewigen Einsichten“ eben nur für ihn wahr und in seinem Weltaspekte ewig sind und daß es Pflicht ist, darüber hinaus nach denen zu suchen, die der Mensch anderer Kulturen mit derselben[S. 32] Gewißheit aus sich heraus ausgesprochen hat. Das gehört zur Vollständigkeit einer Philosophie der Zukunft. Das erst heißt die Formensprache der Geschichte, der lebendigen Welt verstehen. Es gibt hier nichts Bleibendes und Allgemeines. Man rede nicht mehr von den Formen des Denkens, dem Prinzip des Tragischen, der Aufgabe des Staates. Allgemeingültigkeit ist immer der Fehlschluß von sich auf andre.
Sehr viel bedenklicher wird das Bild, wenn wir uns den Denkern der westeuropäischen Modernität von Schopenhauer an zuwenden, dort, wo der Schwerpunkt des Philosophierens aus dem Abstrakt-Systematischen ins Praktisch-Ethische rückt und an Stelle des Problems der Erkenntnis das Problem des Lebens (des Willens zum Leben, zur Macht, zur Tat) tritt. Hier wird nicht mehr das ideale Abstraktum „Mensch“ wie bei Kant, sondern der wirkliche Mensch, wie er in historischer Zeit, als primitiver oder als Kulturmensch völkerhaft gruppiert, die Erdoberfläche bewohnt, der Betrachtung unterworfen, und es ist lächerlich, wenn auch da noch das Format der höchsten Begriffe durch das Schema Altertum — Mittelalter — Neuzeit und die damit verbundene örtliche Beschränkung bestimmt wird. Aber das ist der Fall.
Betrachten wir den historischen Horizont Nietzsches. Seine Begriffe der Dekadence, des Nihilismus, der Umwertung aller Werte, Konzeptionen, die tief im Wesen der abendländischen Zivilisation begründet liegen und für ihre Analyse schlechthin entscheidend sind — welches war die Basis ihrer Formulierung? Römer und Griechen, Renaissance und europäische Gegenwart, einen flüchtigen Seitenblick auf die (mißverstandene) indische Philosophie eingerechnet, kurz: Altertum — Mittelalter — Neuzeit. Darüber ist er, streng genommen, nie hinausgegangen und die andern Denker der Epoche so wenig wie er. Aber ist das die Grundlage einer Philosophie der Welt? Heißt das, menschliche Geschichte überhaupt betrachten? Ist es ein Wunder, daß Nietzsche, wenn er, ohne von Ägypten und Babylon, Rußland und China etwas zu wissen, von einzelnen Beobachtungen zu allgemeinen Zusammenfassungen übergeht — hierher gehören die Gedanken über die Herrenmoral,[S. 33] die blonde Bestie, den Übermenschen — alsbald zu summarischen, vermeintlich weltumfassenden Konstruktionen gelangt, die in Wirklichkeit recht provinzial, völlig willkürlich, zuletzt komisch sind?
In welcher Beziehung steht denn sein Begriff des Dionysischen — zum Innenleben der hochzivilisierten Chinesen aus der Zeit des Konfucius oder eines modernen Amerikaners? Was bedeutet der Typus des Übermenschen — für die Welt des Islam? Oder was sollen die Begriffe Natur und Geist, heidnisch und christlich, antik und modern als gestaltende Antithese im Seelentum des Inders und Russen bedeuten? Was hat Tolstoi, der aus seiner tiefsten Menschlichkeit heraus die ganze Ideenwelt des Westens als etwas Fremdes und Fernes ablehnte, mit dem „Mittelalter“, mit Dante, mit Luther, was hat ein Japaner mit dem Parzifal und dem Zarathustra, was ein Inder mit Sophokles zu schaffen? Und ist die Gedankenwelt Schopenhauers, Comtes, Feuerbachs, Hebbels, Strindbergs etwa weiträumiger? Ist ihre gesamte Psychologie trotz aller kosmischen Aspirationen nicht von rein abendländischer Bedeutung? Wie komisch wirken Ibsens Frauenprobleme, die ebenfalls mit dem Anspruch auf die Aufmerksamkeit der ganzen „Menschheit“ auftreten, wenn man an Stelle der berühmten Nora, einer nordwesteuropäischen Großstadtdame, deren Gesichtskreis etwa einer Mietwohnung von 2000 bis 6000 Mark und einer protestantischen Erziehung entspricht, Cäsars Frau, Madame de Sévigné, eine Japanerin oder eine Tiroler Bäuerin setzt? Aber Ibsen selbst besitzt den Gesichtskreis der großstädtischen Mittelklasse von gestern und heute. Seine Konflikte, deren psychische Voraussetzungen etwa seit 1850 vorhanden sind und 1950 kaum überdauern werden, sind bereits nicht mehr die der großen Welt und der untern Masse, geschweige denn die von Städten mit nichteuropäischer Bevölkerung.
Alles das sind episodische und lokale, meist sogar auf die augenblickliche Intelligenz der Großstädte von westeuropäischem Typus beschränkte, nichts weniger als welthistorische und ewige Werte, und wenn sie der Generation Ibsens und Nietzsches noch so wesentlich sind, so heißt es eben doch den Sinn des Wortes Weltgeschichte — die keine Auswahl, sondern eine Totalität[S. 34] darstellt — mißverstehen, wenn man die außerhalb des modernen Interesses liegenden Faktoren ihm unterordnet, sie unterschätzt oder übersieht. Und das ist in einem ungewöhnlich hohen Grade der Fall. Was im Abendlande bisher über die Probleme des Raumes, der Zeit, der Bewegung, der Zahl, des Willens, der Ehe, des Eigentums, des Tragischen, der Wissenschaft gesagt und gedacht worden ist, blieb eng und zweifelhaft, weil man immer darauf aus war, die Lösung der Frage zu finden, statt einzusehen, daß zu vielen Fragenden viele Antworten gehören, daß eine philosophische Frage nur der verhüllte Wunsch ist, eine bestimmte Antwort zu erhalten, die in der Frage schon beschlossen liegt, daß man die großen Fragen einer Zeit gar nicht ephemer genug fassen kann und daß demnach eine Gruppe historisch bedingter Lösungen angenommen werden muß, deren Übersicht erst — unter Ausschaltung aller eignen Überzeugungen — die letzten Geheimnisse aufschließt. Für den Denker — den echten — gibt es keine absolut richtigen oder falschen Standpunkte. Es genügt nicht, angesichts so schwerer Probleme wie dem der Zeit oder der Ehe die persönliche Erfahrung, die innere Stimme, die Vernunft, die Meinung der Vorgänger oder Zeitgenossen zu befragen. So erfährt man, was für einen selbst, für die eigne Zeit wahr ist, aber das ist nicht alles. Die Erscheinung anderer Kulturen redet eine andre Sprache. Für andre Menschen gibt es andre Wahrheiten. Für den Denker sind sie alle gültig oder keine.
Man begreift, welcher Erweiterung und Vertiefung die abendländische Weltkritik fähig ist und was alles über den harmlosen Relativismus Nietzsches und seiner Generation hinaus in den Kreis der Betrachtung gezogen, welche Feinheit des Formgefühls, welcher Grad von Psychologie, welche Entsagung und Unabhängigkeit von praktischen Interessen, welche Unumschränktheit des Horizonts erreicht werden muß, bevor man sagen darf, man habe die Weltgeschichte, die Welt als Geschichte, verstanden.
Diesem allem, den willkürlichen, engen, von außen gekommenen, vom eignen Interesse diktierten, der Historie aufgezwungenen[S. 35] Formen stelle ich die natürliche, die „kopernikanische“ Gestalt des Weltgeschehens entgegen, die ihm in der Tiefe innewohnt und sich nur dem nicht voreingenommenen Blick offenbart.
Ich erinnere an Goethe. Was er die lebendige Natur genannt hat, ist genau das, was hier Weltgeschichte im weitesten Umfange, Welt als Geschichte genannt wird. Goethe, der als Künstler wieder und immer wieder das Leben, die Entwicklung seiner Gestalten, das Werden, nicht das Gewordene, herausbildet, wie es der Wilhelm Meister und Wahrheit und Dichtung zeigen, haßte die Mathematik. Hier stand die Welt als Mechanismus der Welt als Organismus, die tote der lebendigen Natur, das Gesetz der Gestalt gegenüber. Jede Zeile, die er als Naturforscher schrieb, sollte die Gestalt des Werdenden, „geprägte Form, die lebend sich entwickelt,“ vor Augen stellen. Nachfühlen, Anschauen, Vergleichen, die unmittelbare innere Gewißheit, die exakte sinnliche Phantasie — das waren seine Mittel, den Geheimnissen der bewegten Erscheinung nahe zu kommen. Und das sind die Mittel der Geschichtsforschung überhaupt. Es gibt keine andern. Dieser göttliche Blick ließ ihn am Abend der Schlacht von Valmy am Lagerfeuer jenes Wort aussprechen: „Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen.“ Kein Heerführer, kein Diplomat, von Philosophen zu schweigen, hat Geschichte so unmittelbar werden gefühlt. Es ist das tiefste Urteil, das je über einen großen Akt der Geschichte in dem Augenblick ausgesprochen wurde, wo er sich vollzog.
Und so wie er die Entwicklung der Pflanzenform aus dem Blatt, die Entstehung des Wirbeltiertypus, das Werden der geologischen Schichten verfolgte — das Schicksal der Natur, nicht ihre Kausalität — soll hier die Formensprache der menschlichen Historie, ihre periodische Struktur, der Atem der Geschichte aus der Fülle aller sinnfälligen Einzelheiten entwickelt werden.
Man hat sonst den Menschen den Organismen der Erdoberfläche zugerechnet und mit Grund. Sein Körperbau, seine natürlichen Funktionen, seine ganze sinnliche Erscheinung, alles[S. 36] gehört einer umfassenderen Einheit an. Nur hier macht man eine Ausnahme, trotz der tiefgefühlten Verwandtschaft des Pflanzenschicksals mit dem Menschenschicksal — einem ewigen Thema aller Lyrik — trotz der Ähnlichkeit aller menschlichen Geschichte mit der jeder andern Gruppe höherer Lebewesen — einem Thema unzähliger Märchen, Sagen und Fabeln. Hier vergleiche man, indem man die Welt menschlicher Kulturen rein und tief auf die Einbildungskraft wirken läßt, nicht indem man sie in ein vorgefaßtes Schema zwängt; man sehe in den Worten Jugend, Aufstieg, Blütezeit, Verfall, die bis jetzt regelmäßig und heute mehr denn je der Ausdruck subjektiver Wertschätzungen und allerpersönlichster Interessen sozialer, moralischer, ästhetischer Art waren, endlich objektive Bezeichnungen organischer Zustände; man stelle die antike Kultur als in sich abgeschlossenes Phänomen, als Körper und Ausdruck der antiken Seele, neben die ägyptische, indische, babylonische, chinesische, abendländische und suche das Typische in den wechselnden Geschicken dieser großen Individuen, das Notwendige in der unbändigen Fülle des Zufälligen und man wird endlich das Bild der Weltgeschichte sich entfalten sehen, das uns, den Menschen des Abendlandes, und uns allein natürlich ist.
Kehren wir zum engeren Thema zurück, so ist aus diesem Weltblick die Struktur der Gegenwart, zunächst zwischen 1800 und 2000, morphologisch zu bestimmen. Das Wann dieser Epoche innerhalb der abendländischen Gesamtkultur, ihr Sinn als biographischer Abschnitt, der in irgendeiner Gestalt mit Notwendigkeit in jeder Kultur anzutreffen ist, die organische und symbolische Bedeutung der ihr angehörenden politischen, künstlerischen, geistigen, sozialen Form komplexe soll festgestellt werden.
An diesem Punkte ergibt sich die Identität der Periode mit dem Hellenismus, und zwar im besonderen die ihres augenblicklichen Höhepunktes — bezeichnet durch den Weltkrieg — mit dem Übergang der hellenistischen in die Römerzeit. Das Römertum, von strengstem Tatsachensinn, ungenial, barbarisch,[S. 37] diszipliniert, praktisch, protestantisch, preußisch, wird uns, die wir auf Vergleiche angewiesen sind, immer den Schlüssel zum Verständnis der eigenen Zukunft bieten. Griechen und Römer — damit scheidet sich auch das Schicksal, das sich für uns schon vollzogen hat und das, welches uns bevorsteht. Denn man hätte längst im „Altertum“ eine Entwicklung finden können und sollen, die ein vollkommenes Gegenstück zur eignen, westeuropäischen, bildet, in jeder Einzelheit der Oberfläche verschieden, aber völlig gleich in dem innern Drang, der den großen Organismus seiner Vollendung entgegentreibt. Wir hätten Zug um Zug vom „trojanischen Krieg“ und den Kreuzzügen, Homer und dem Nibelungenlied an über Dorik und Gotik, dionysischer Bewegung und Renaissance, Polyklet und Sebastian Bach, Athen und Paris, Aristoteles und Kant, Alexander und Napoleon bis zum Weltstadtstadium und Imperialismus beider Kulturen hier ein beständiges alter ego der eignen Wirklichkeit gefunden.
Aber die Interpretation des antiken Geschichtsbildes, die hier Vorbedingung war — wie einseitig ist sie immer angegriffen worden! wie äußerlich! wie parteiisch! wie wenig umfassend! Weil wir uns „den Alten“ allzu verwandt fühlten, haben wir uns die Aufgabe allzu leicht gemacht. In der flachen Ähnlichkeit liegt die Gefahr, der die gesamte Altertumsforschung erlegen ist. Es ist ein ewiges Vorurteil, das wir endlich überwinden sollten, daß die Antike uns innerlich nahesteht, weil wir vermeintlich ihre Schüler und Nachkommen, weil wir tatsächlich nur ihre Anbeter gewesen sind. Die ganze religionsphilosophische, kunsthistorische, sozialkritische Arbeit des 19. Jahrhunderts war nötig, nicht um uns endlich die Dramen des Äschylus, die Lehre Platos, Apollo und Dionysos, den athenischen Staat, den Cäsarismus verstehen zu lehren — davon sind wir weit entfernt —, sondern um uns endlich fühlen zu lassen, wie unermeßlich fremd und fern uns das alles innerlich ist, fremder vielleicht als die mexikanischen Götter und die indische Architektur.
Unsere Meinungen von der griechisch-römischen Kultur haben sich immer zwischen zwei Extremen bewegt, wobei ohne Ausnahme das Schema Altertum — Mittelalter — Neuzeit die Perspektive aller „Standpunkte“ von vornherein bestimmt hat.[S. 38] Die einen, Männer des öffentlichen Lebens vor allem, Nationalökonomen, Politiker, Juristen, finden die „heutige Menschheit“ im besten Fortschreiten, schätzen sie sehr hoch ein und messen an ihr alles Frühere. Es gibt keine moderne Partei, nach deren Grundsätzen Kleon, Marius, Themistokles, Catilina und die Gracchen nicht schon „gewürdigt“ worden sind. Die andern, Künstler, Dichter, Philologen und Philosophen, fühlen sich in besagter Gegenwart nicht zu Hause, nehmen darum in irgendeiner Vergangenheit einen ebenso absoluten Standpunkt ein und verurteilen von ihm aus ebenso dogmatisch das Heute. Die einen sehen im Griechentum ein „Noch nicht“, die andern in der Modernität ein „Nicht mehr“, immer unter der Suggestion eines Geschichtsbildes, das beide Phänomene linienförmig aneinander knüpft.
Es sind die zwei Seelen Fausts, die sich in diesem Gegensatz verwirklicht haben. Die Gefahr der einen ist die intelligente Oberflächlichkeit. Es bleibt von allem, was antike Kultur, was Abglanz der antiken Seele gewesen war, zuletzt nichts in ihren Händen als soziale, wirtschaftliche, rechtliche, politische, physiologische „Tatsachen“. Der Rest nimmt den Charakter von „sekundären Folgen“, „Reflexen“, „Begleiterscheinungen“ an. Von der mythischen Wucht der Chöre des Äschylus, von der kolossalen Erdkraft der ältesten Plastik, der dorischen Säule, von der Glut der apollinischen Kulte, von der Tiefe selbst noch des römischen Kaiserkultes ist in ihren Büchern nichts zu spüren. Die andern, verspätete Romantiker vor allem, wie noch zuletzt die drei Basler Professoren Bachofen, Burckhardt und Nietzsche, erliegen der Gefahr aller Ideologie. Sie verlieren sich in den Wolkenregionen eines Altertums, das lediglich ein Spiegelbild ihrer philologisch geregelten Empfindsamkeit ist. Sie verlassen sich auf die Reste der alten Literatur, das einzige Zeugnis, das ihnen edel genug ist — aber noch nie ist eine Kultur durch ihre großen Schriftsteller unvollkommener repräsentiert worden.[12] Die andern stützen sich vorwiegend auf[S. 39] das prosaische Quellenmaterial der Rechtsurkunden, Inschriften und Münzen, das insbesondere Burckhardt und Nietzsche sehr zu ihrem Schaden verachtet hatten, und ordnen ihm die erhaltene Literatur mit ihrem oft minimalen Wahrheits- und Tatsachensinn unter. So nahm man sich gegenseitig schon der kritischen Grundlagen wegen nicht ernst. Ich wüßte nicht, daß Nietzsche und Mommsen einander die geringste Beachtung geschenkt hätten.
Aber keiner von beiden hat die Höhe der Betrachtung erreicht, aus welcher dieser Gegensatz in nichts zerfällt und die trotzdem möglich gewesen wäre. Hier rächte sich die Herübernahme des Kausalprinzips aus der Naturwissenschaft in die Geschichtsforschung. Man kam zu einem das Weltbild der Physik oberflächlich nachmalenden Pragmatismus, der die ganz andersartige Formensprache der Historie verdeckt und verwirrt, nicht erschließt. Man wußte allerseits nichts Besseres, um die Masse historischen Materials einer vertieften und ordnenden Auffassung zu unterwerfen, als einen Komplex von Erscheinungen als primär, als Ursache anzusetzen und die übrigen demgemäß als sekundär, als Folgen oder Wirkungen zu behandeln. Nicht nur die Praktiker, auch die Romantiker haben dazu gegriffen, weil die Historie ihre eigne Logik auch ihrem beschränkten Blick nicht offenbart hat und das Bedürfnis nach Feststellung einer immanenten Notwendigkeit, deren Vorhandensein man fühlte, viel zu stark war, wenn man nicht wie Schopenhauer der Geschichte überhaupt mißmutig den Rücken kehren wollte.
Reden wir ohne weiteres von einer materialistischen und einer ideologischen Art, die Antike zu sehen. Dort erklärt man, daß das Sinken der einen Wagschale seine Ursache im Steigen der andern hat. Man beweist, daß dies ohne Ausnahme der[S. 40] Fall ist — zweifellos ein schlagender Beweis. Hier haben wir also Ursache und Wirkung, und zwar stellen — selbstverständlich — die sozialen und sexuellen, allenfalls die rein politischen Phänomene die Ursachen, die religiösen, geistigen, künstlerischen die Wirkungen dar (soweit der Materialist für die letzteren die Bezeichnung Tatsachen duldet). Die Ideologen beweisen umgekehrt, daß das Steigen der einen Schale aus dem Sinken der andern folgt, und sie beweisen es mit derselben Exaktheit. Sie versenken sich in Kulte, Mysterien, Bräuche, in die Geheimnisse des Verses und der Linie und würdigen das banausische Alltagsleben, eine peinliche Folge der irdischen Unvollkommenheit, kaum eines Seitenblicks. Beide beweisen, den Kausalnexus deutlich vor Augen, daß die andern den wahren Zusammenhang der Dinge offenbar nicht sehen oder sehen wollen und enden damit, daß sie einander blind, flach, dumm, absurd oder frivol, kuriose Käuze oder platte Philister schelten. Der Ideologe ist entsetzt, wenn jemand Finanzprobleme unter Hellenen ernst nimmt und z. B. statt von den tiefsinnigen Sprüchen des delphischen Orakels von den weitreichenden Geldoperationen redet, welche die Orakelpriester mit den dort deponierten Summen vornahmen. Der Politikus aber lächelt weise über den, der seine Begeisterung an sakrale Formeln und die Tracht attischer Epheben verschwendet, statt über antike Klassenkämpfe ein mit vielen modernen Schlagworten gespicktes Buch zu schreiben.
Der eine Typus ist schon in Petrarka vorgebildet. Er hat Florenz und Weimar, den Begriff der Renaissance und den abendländischen Klassizismus geschaffen. Den andern findet man seit der Mitte des 18. Jahrhunderts, mit dem Beginn einer zivilisierten, wirtschaftlich-großstädtischen Politik, also zuerst in England (Grote). Im Grunde stehen sich hier die Auffassung des kultivierten und des zivilisierten Menschen gegenüber, ein Gegensatz, der zu tief, zu menschlich ist, um die Inferiorität beider Standpunkte empfinden oder gar überwinden zu lassen.
Auch der Materialismus verfährt in diesem Punkte idealistisch. Auch er hat, ohne es zu wissen und zu wollen, seine Einsichten von inneren Wünschen abhängig gemacht. In der Tat haben sich unsere besten Geister ohne Ausnahme vor dem Bilde der Antike in Ehrfurcht gebeugt und in diesem einen[S. 41] Falle der schrankenlosen Kritik entsagt. Die Analyse des Altertums ist immer durch eine gewisse Scheu verdunkelt worden. Es gibt in der gesamten Geschichte kein zweites Beispiel für einen so leidenschaftlichen Kultus, den eine Kultur mit dem Gedächtnis einer andern treibt. Daß wir Altertum und Neuzeit durch ein „Mittelalter“ idealisch verknüpften, über ein Jahrtausend gering gewerteter, fast verachteter Historie hinweg, ist nur ein einzelner Ausdruck dieser unwillkürlichen Devotion. Wir Westeuropäer haben „den Alten“ die Reinheit und Selbständigkeit unserer Kunst zum Opfer gebracht, indem wir nur mit einem Seitenblick auf das hehre „Vorbild“ zu schaffen wagten; wir haben in unser Bild von den Griechen und Römern jedesmal das hineingelegt, hineingefühlt, was wir in der Tiefe der eigenen Seele entbehrten oder erhofften. Eines Tages wird uns ein geistreicher Psychologe die Geschichte unserer verhängnisvollsten Illusion, die Geschichte dessen, was wir jedesmal als antik verehrten, erzählen. Es gibt wenige Aufgaben, die für die intime Kenntnis der abendländischen Seele von Kaiser Otto III., dem ersten, bis zu Nietzsche, dem letzten Opfer des Südens, lehrreicher wären.
Goethe redet auf seiner italienischen Reise mit Begeisterung von den Bauten Palladios, deren frostiger Akademik wir heute höchst skeptisch gegenüberstehen. Er sieht dann Pompeji und spricht mit unverhohlenem Mißvergnügen von dem „wunderlichen, halb unangenehmen Eindruck“. Was er von den Tempeln von Pästum und Segesta, Meisterstücken hellenischer Kunst, sagt, ist verlegen und unbedeutend. Offenbar hat er das Altertum, als es ihm einmal leibhaft in seiner vollen Kraft entgegentrat, nicht wiedererkannt. Das bezeichnet den historischen Sinn unserer Seelen: sie wollen nicht Eindrücke von Fremdem, sondern Ausdruck von Eignem. Ihr „Altertum“ war jedesmal der Horizont eines historischen Gesamtbildes, das sie geschaffen und mit ihrem besten Blute genährt haben, ein Gefäß für das eigne Weltgefühl, ein Phantom, ein Idol. Man begeistert sich in Denkerstuben und poetischen Zirkeln an den verwegenen Schilderungen antiken Großstadttreibens bei Aristophanes, Juvenal und Petronius, an südlichem Schmutz und Pöbel, Lärm und Gewalttat, Lustknaben und Phrynen, am Phalluskult und cäsarischen Orgien[S. 42] — aber demselben Stück Wirklichkeit in heutigen Weltstädten geht man klagend und naserümpfend aus dem Wege. „In den Städten ist schlecht zu leben: da gibt es zu viele der Brünstigen.“ Also sprach Zarathustra. Sie rühmen die Staatsgesinnung der Römer und verachten den, der heute nicht jede Berührung mit öffentlichen Angelegenheiten meidet. Es gibt eine Klasse von Kennern, für welche der Unterschied von Toga und Gehrock, von byzantinischem Zirkus und englischem Sportplatz, von antiken Alpenstraßen und transkontinentalen Eisenbahnen, Trieren und Schnelldampfern, römischen Lanzen und preußischen Bajonetten, zuletzt sogar vom Suezkanal, je nachdem ihn ein Pharao oder ein moderner Ingenieur gebaut hat, eine magische Gewalt besitzt, die jeden freien Blick mit Sicherheit einschläfert. Sie würden eine Dampfmaschine als Symbol menschlicher Leidenschaft und Ausdruck vitaler Energie erst dann gelten lassen, wenn Heron von Alexandria sie erfunden hätte. Es gilt ihnen als Blasphemie, wenn man statt vom Kult der Großen Mutter vom Berge Pessinus, von römischer Zentralheizung und Buchführung spricht. Trotzdem war das griechische Wort für Kapital ἀφορμή, Ausgangspunkt, und Thukydides lobt die Athener seiner Zeit (I, 70), daß sie keine anderen Feste kannten, als ihre Geschäfte zu betreiben.[13]
Aber die andern sehen nichts als dies. Sie glauben das Wesen dieser uns so fremden Kultur zu erschöpfen, indem sie die Griechen ohne weiteres als ihresgleichen behandeln und sie bewegen sich, wenn sie psychologische Schlüsse ziehen, in einem System von Identitäten, das die antike Seele überhaupt nicht berührt. Sie ahnen gar nicht, daß Worte wie Republik, Freiheit, Eigentum dort und hier Dinge bezeichnen, die innerlich auch nicht die leiseste Verwandtschaft besitzen. Sie spötteln über Historiker der Goethezeit, wenn sie ihre politischen Ideale ausdrücken, indem sie eine Geschichte des Altertums verfassen und mit den Namen Lykurg, Brutus, Cato, Cicero, Augustus durch deren Rettungen oder Verurteilungen das eigene Programm[S. 43] oder eine persönliche Schwärmerei decken, aber sie selbst können kein Kapitel schreiben, ohne zu verraten, welcher Parteirichtung ihre Morgenzeitung angehört.
Aber es ist gleichviel, ob man die Vergangenheit mit den Augen Don Quijotes oder Sancho Pansas betrachtet. Beide Wege führen nicht zum Ziel. Schließlich hat sich jeder von ihnen erlaubt, das Stück der Antike in den Vordergrund zu stellen, das den eignen Intentionen zufällig am besten entsprach, Nietzsche das vorsokratische Athen, Nationalökonomen die hellenistische Periode, Politiker das republikanische Rom und Dichter die Kaiserzeit.
Nicht als ob religiöse oder künstlerische Erscheinungen ursprünglicher wären als soziale und wirtschaftliche. Es ist weder so noch umgekehrt. Es gibt für den, der hier die unbedingte Freiheit des Blickes erworben hat, jenseits aller persönlichen Interessen welcher Art auch immer, überhaupt keine Art von Abhängigkeit, keine Priorität, keine Ursache und Wirkung, keinen Unterschied des Wertes und der Wichtigkeit. Was den einzelnen Phänomenen ihren Rang gibt, ist lediglich die größere oder geringere Reinheit und Kraft ihrer Formensprache, die Stärke ihrer Symbolik — abseits von gut und böse, hoch und niedrig, Nutzen und Ideal.
Der Untergang des Abendlandes, so betrachtet, bedeutet nichts Geringeres als das Problem der Zivilisation. Eine der Grundfragen aller Historie liegt hier vor. Was ist Zivilisation, als logische Folge, als Vollendung und Ausgang einer Kultur begriffen?
Denn jede Kultur hat ihre eigne Zivilisation. Zum ersten Male werden hier die beiden Worte, die bisher einen vagen ethischen Unterschied persönlicher Art zu bezeichnen hatten, in periodischem Sinne, als Ausdrücke für ein strenges und notwendiges organisches Nacheinander gefaßt. Die Zivilisation ist das unausweichliche Schicksal einer Kultur. Hier ist der Gipfel erreicht, von dem aus die letzten und schwersten Fragen der historischen Morphologie lösbar werden.[S. 44] Zivilisation sind die äußersten und künstlichsten Zustände, deren eine höhere Art Menschen fähig ist. Sie sind ein Abschluß; sie folgen dem Werden als das Gewordene, dem Leben als der Tod, der Entwicklung als die Starrheit, dem Lande und der seelischen Kindheit, wie sie Dorik und Gotik zeigen, als das geistige Greisentum und die steinerne, versteinernde Weltstadt. Sie sind ein Ende, unwiderruflich, aber sie sind mit innerster Notwendigkeit immer wieder erreicht worden.
Damit erst wird man den Römer als den Nachfolger des Hellenen verstehen. Erst so rückt die späte Antike in das Licht, das ihre tiefsten Geheimnisse preisgibt. Denn was hat es zu bedeuten — was man nur mit leeren Worten bestreiten kann —, daß die Römer Barbaren gewesen sind, Barbaren, die einem großen Aufschwung nicht vorangehen, sondern ihn beschließen? Seelenlos, unphilosophisch, ohne Kunst, animalisch bis zum Brutalen, rücksichtslos auf materielle Erfolge haltend, stehen sie zwischen der hellenischen Kultur und dem Nichts. Ihre nur auf das Praktische gerichtete Einbildungskraft — sie besaßen ein sakrales Recht, das die Beziehungen zwischen Göttern und Menschen wie zwischen Privatpersonen regelte, aber keine Spur eines Mythus — ist eine Anlage, die man in Athen überhaupt nicht antrifft. Griechische Seele und römischer Intellekt — das ist es. So unterscheiden sich Kultur und Zivilisation. Das gilt nicht nur von der Antike. Immer wieder taucht dieser Typus starkgeistiger, vollkommen unmetaphysischer Menschen auf. In ihren Händen liegt das geistige und materielle Geschick einer jeden Spätzeit. Sie haben den babylonischen, ägyptischen, indischen, chinesischen, römischen Imperialismus durchgeführt. In solchen Perioden sind der Buddhismus, Stoizismus und Sozialismus zu endgültigen Weltstimmungen herangereift, die ein erlöschendes Menschentum in seiner ganzen Substanz noch einmal zu ergreifen und umzugestalten vermögen. Die reine Zivilisation als historischer Prozeß besteht in einem stufenweisen Abbau anorganisch gewordener, erstorbener Formen.
Der Übergang von der Kultur zur Zivilisation vollzieht sich in der Antike im 4., im Abendlande im 19. Jahrhundert. Von da an fallen die großen geistigen Entscheidungen nicht[S. 45] mehr wie zur Zeit der orphischen Bewegung und der Reformation in der „ganzen Welt“, in der schließlich kein Dorf ganz unwichtig ist, sondern in drei oder vier Weltstädten, die allen Gehalt der Historie in sich aufgesogen haben und denen gegenüber die gesamte Landschaft der Kultur zum Range der Provinz herabsinkt, die ihrerseits nur noch die Weltstädte mit den Resten ihres höheren Menschentums zu nähren hat. Weltstadt und Provinz — mit diesen Grundbegriffen aller Zivilisation tritt ein ganz neues Formproblem der Geschichte hervor, das wir Heutigen gerade durchleben, ohne es in seiner ganzen Tragweite auch nur entfernt begriffen zu haben. Statt einer Welt eine Stadt, ein Punkt, in dem sich das ganze Leben weiter Länder sammelt, während der Rest verdorrt; statt eines formvollen, mit der Erde verwachsenen Volkes ein neuer Nomade, ein Parasit, der Großstadtbewohner, der reine, traditionslose, in formlos fluktuierender Masse auftretende Tatsachenmensch, irreligiös, intelligent, unfruchtbar, mit einer tiefen Abneigung gegen das Bauerntum (und dessen höchste Form, den Landadel), also ein ungeheurer Schritt zum Anorganischen, zum Ende — was bedeutet das? Frankreich und England haben diesen Schritt vollzogen und Deutschland ist im Begriff, ihn zu tun. Auf Syrakus, Athen, Alexandria folgt Rom. Auf Madrid, Paris, London folgt Berlin. Provinz zu werden ist das Schicksal ganzer Länder, die nicht im Strahlenkreise einer dieser Städte liegen wie damals Kreta und Makedonien, heute der skandinavische Norden.[14]
Ehemals spielte sich der Kampf um die ideelle Fassung der Epoche auf dem Boden metaphysischer, kultisch oder dogmatisch geprägter Weltprobleme zwischen dem erdhaften Geiste des Bauerntums (Adel und Priestertum) und dem „weltlichen“ patrizischen Geiste der alten, kleinen, berühmten Städte der dorischen und gotischen Frühzeit ab. Dergestalt waren die[S. 46] Kämpfe um die Dionysosreligion — z. B. unter dem Tyrannen Kleisthenes von Sikyon[15] — und um die Reformation in den deutschen Reichsstädten und in den Hugenottenkriegen. Aber wie diese Städte zuletzt das Land überwanden — ein rein städtisches Weltbewußtsein begegnet schon bei Parmenides und Descartes — so überwindet die Weltstadt sie. Das ist der geistige Prozeß aller Spätzeiten, der Ionik wie des Barock. Heute wie zur Zeit des Hellenismus, an dessen Schwelle die Gründung einer künstlichen, also landfremden Großstadt, Alexandrias, steht, sind diese Kulturstädte — Florenz, Nürnberg, Salamanca, Brügge, Prag — Provinzstädte geworden, die gegen den Geist der Weltstädte einen hoffnungslosen intellektuellen Widerstand leisten. Die Weltstadt bedeutet den Kosmopolitismus an Stelle der „Heimat“,[16] den kühlen Tatsachensinn an Stelle der Ehrfurcht vor dem Überlieferten und Gewachsenen, die wissenschaftliche Irreligion als Petrefakt der voraufgegangenen Religion des Herzens, die „Gesellschaft“ an Stelle des Staates, die natürlichen statt der erworbenen Rechte. Das Geld als anorganischen abstrakten Faktor, von allen Beziehungen zum Sinne des fruchtbaren Bodens, zu den Werten einer ursprünglichen Lebenshaltung gelöst — das haben die Römer vor den Griechen voraus. Von hier an ist eine vornehme Weltanschauung auch eine Geldfrage. Nicht der griechische Stoizismus des Chrysipp, aber der spätrömische des Cato und Seneka setzt als Grundlage ein Vermögen voraus[17] und nicht die sozialethische Gesinnung des 18. Jahrhunderts, aber die des 20. ist, wenn sie über eine berufsmäßige — einträgliche — Agitation hinaus Tat werden will, eine Sache für Millionäre. Zur Weltstadt gehört nicht ein Volk, sondern eine Masse. Ihr Unverständnis für alles Überlieferte, in dem man die Kultur bekämpft (den Adel, die Kirche, die Privilegien, die Dynastie, in der Kunst die Konventionen, in[S. 47] der Wissenschaft die Grenzen der Erkenntnismöglichkeit), ihre der bäuerlichen Klugheit überlegene scharfe und kühle Intelligenz, ihr Naturalismus in einem ganz neuen Sinne, der über Sokrates und Rousseau weit zurück in bezug auf alles Sexuelle und Soziale an urmenschliche Instinkte und Zustände anknüpft, das panem et circenses, das heute wieder in der Verkleidung von Lohnkampf und Sportplatz erscheint — alles das bezeichnet der endgültig abgeschlossenen Kultur, der Provinz gegenüber eine ganz neue, späte und zukunftslose, aber unvermeidliche Form menschlicher Existenz.
Das ist es, was gesehen sein will, nicht mit den Augen des Parteimannes, des Ideologen, des zeitgemäßen Moralisten, aus dem Winkel irgendeines „Standpunktes“ heraus, sondern aus zeitloser Höhe, den Blick auf die historische Formenwelt von Jahrtausenden gerichtet — wenn man wirklich die große Krisis der Gegenwart begreifen will.
Ich sehe Symbole ersten Ranges darin, daß in Rom, wo um 60 v. Chr. der Triumvir Crassus der erste Bauplatzspekulant war, das auf allen Inschriften prangende römische Volk, vor dem Gallier, Griechen, Parther, Syrer in der Ferne zitterten, in ungeheurem Elend in den vielstöckigen Mietskasernen lichtloser Vorstädte[18] hauste und die Erfolge der militärischen Expansion mit Gleichgültigkeit oder einer Art von sportlichem Interesse aufnahm; daß manche der großen Familien des Uradels, Nachkommen der Sieger über die Kelten, Samniten und Hannibal, weil sie sich an der wüsten Spekulation nicht beteiligten, ihre Stammhäuser aufgeben und armselige Mietwohnungen beziehen mußten; daß, während sich längs der Via Appia die noch heute bewunderten Grabmäler der Finanzgrößen Roms erhoben, die Leichen des Volkes zusammen mit Tierkadavern und Großstadtkehricht in ein grauenhaftes Massengrab geworfen wurden, bis man unter Augustus, um Seuchen zu verhüten, die Stelle zuschüttete,[S. 48] auf der Mäcenas dann seinen berühmten Park anlegte; daß man in dem entvölkerten Athen, das von Fremdenbesuch und den Stiftungen reicher Ausländer (wie des Judenkönigs Herodes) lebte, der Reisepöbel allzu rasch reich gewordener Römer die Werke der perikleischen Zeit begaffte, von denen er so wenig verstand wie die amerikanischen Besucher der Sixtinischen Kapelle von Michelangelo, nachdem man alle beweglichen Kunstwerke fortgeschleppt oder zu phantastischen Modepreisen angekauft und dafür kolossale und anmaßende Römerbauten neben die tiefen und bescheidenen Werke der alten Zeit gesetzt hatte. In diesen Dingen, die der Historiker nicht zu loben oder tadeln, sondern morphologisch abzuwägen hat, liegt für den, welcher zu sehen gelernt hat, eine Idee unmittelbar zutage.
Es ist heute wie damals nicht die Frage, ob man von Geburt Germane oder Romane, Hellene oder Römer, sondern ob man von Erziehung Weltstädter oder Provinzler ist. Das entscheidet über alles Tatsächliche. Hier finden wir einen neuen, in seiner Art vollkommenen Weltblick als Ausdruck eines neuen Lebensstils. Eine höchst bezeichnende und in allen bisher vorliegenden Fällen identische Metamorphose vollzieht sich. Es ist einer der wichtigsten Gründe, weshalb man in dem wirren Bilde der historischen Oberfläche die eigentliche Struktur der Historie nicht aufgefunden hat, daß man es nicht verstand, die Formkomplexe des kultivierten und des zivilisierten Daseins aus ihrer wechselseitigen Durchdringung zu lösen. Eine Kritik der Gegenwart steht hier vor ihrer schwersten Aufgabe.
Denn es wird sich zeigen, daß von diesem Augenblicke an alle großen Konflikte der Weltanschauung, der Politik, der Kunst, des Wissens, des Gefühls im Zeichen dieses einen Gegensatzes stehen. Was ist zivilisierte Politik von morgen im Gegensatz zur kultivierten von gestern? In der Antike Rhetorik, im Abendlande Journalismus, und zwar im Dienste jenes Abstraktums, das die Macht der Zivilisation repräsentiert, des Geldes. Sein Geist ist es, der unvermerkt die historischen Formen des Völkerdaseins durchdringt, oft ohne sie im geringsten zu ändern oder zu zerstören. Der römische Staatsmechanismus ist vom älteren Scipio Africanus bis auf Augustus in viel höherem Grade stationär geblieben, als dies in der Regel[S. 49] angenommen wird. Aber die großen Parteien, Vehikel einer veralteten Form des politischen Lebens, sind zur Zeit der Gracchen wie im 20. Jahrhundert nur noch scheinbar Mittelpunkte der entscheidenden Aktionen. In Wirklichkeit ist es dem Forum Romanum gegenüber gleichgültig, wie auf dem Forum von Pompeji geredet, beschlossen und gewählt wird, und die drei oder vier Weltblätter werden in unsrer Zukunft die Meinung der Provinzzeitungen und damit den „Willen des Volkes“ bestimmen. Es ist eine kleine Anzahl überlegener Gehirne, deren Namen in diesem Augenblick vielleicht nicht die bekanntesten sind, die alles entscheidet, während die große Masse der Politiker zweiten Ranges, Rhetoren und Tribunen, Abgeordnete und Journalisten, eine Auswahl nach Provinzhorizonten, nach unten die Illusion einer Selbstbestimmung des Volkes aufrecht erhält. Und die Kunst? Die Philosophie? Die Ideale der platonischen und der kantischen Zeit galten einem höhern Menschentum überhaupt, die des Hellenismus und der Gegenwart, vor allem der Sozialismus, der ihm genetisch nahe verwandte Darwinismus mit seinen so ganz ungoetheschen Formeln vom Kampf ums Dasein und der Zuchtwahl, die damit wiederum verwandten Frauen- und Eheprobleme bei Ibsen, Strindberg und Shaw, die impressionistischen Neigungen einer anarchischen Sinnlichkeit, das ganze Bündel moderner Sehnsüchte, Reize und Schmerzen, deren Ausdruck die Lyrik Baudelaires und die Musik Wagners ist, sind nicht für das Weltgefühl des dörflichen und überhaupt des natürlichen Menschen, sondern ausschließlich für den weltstädtischen Gehirnmenschen da. Je kleiner die Stadt, desto sinnloser die Beschäftigung mit dieser Malerei und Musik. Zur Kultur gehört die Gymnastik, das Turnier, der Agon, zur Zivilisation der Sport. Auch das unterscheidet die hellenische Palästra vom römischen Zirkus.[19] Die Kunst selbst wird Sport — das bedeutet l’art pour l’art — vor einem hochintelligenten Publikum von Kennern und Käufern, mag es sich um die Bewältigung absurder instrumentaler Tonmassen oder harmonischer[S. 50] Hindernisse, mag es sich um das „Nehmen“ eines Farbenproblems handeln. Eine neue Tatsachenphilosophie erscheint, die für metaphysische Spekulationen nur ein Lächeln übrig hat, eine neue Literatur, dem Intellekt, dem Geschmack und den Nerven des Großstädters ein Bedürfnis, dem Provinzialen unverständlich und verhaßt.[20] Weder die alexandrinische Poesie, noch die Freilichtmalerei gehen das „Volk“ etwas an. Der Übergang wird damals wie heute durch eine Reihe nur in dieser Epoche anzutreffender Skandale bezeichnet. Die Entrüstung der Athener über Euripides und die revolutionären Malweisen z. B. des Apollodor, wiederholt sich in der Auflehnung gegen Wagner, Manet, Ibsen und Nietzsche.
Man kann die Griechen verstehen, ohne von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen zu reden. Die Römer versteht man nur durch sie. Bei Chäronea und bei Leipzig wurde zum letzten Male um eine Idee gekämpft. Im ersten punischen Kriege und bei Sedan sind die wirtschaftlichen Momente nicht mehr zu übersehen. Erst die Römer mit ihrer praktischen Energie haben der Sklavenarbeit und dem Sklavenhandel jenen riesenhaften Stil gegeben, der für viele den Typus der antiken Lebenshaltung überhaupt entscheidend bestimmt. Erst die germanischen, nicht die romanischen Völker Westeuropas haben dementsprechend aus der Dampfmaschine eine das Bild der Länder verändernde Großindustrie entwickelt. Man wird die Beziehung beider tiefsymbolischen Phänomene zum Stoizismus und zum Sozialismus nicht übersehen. Erst der römische, durch C. Flaminius angekündigte, in Marius zum ersten Male Gestalt gewordene Cäsarismus hat innerhalb der antiken Welt die Erhabenheit des Geldes — in der Hand starkgeistiger, groß angelegter Tatsachenmenschen — kennen gelehrt. Ohne das ist weder Cäsar noch das Römertum überhaupt verständlich. Jeder Grieche hat einen Zug von Don Quijote, jeder Römer von Sancho Pansa — was sie sonst noch waren, tritt dahinter zurück.
[S. 51]
Was die römische Weltherrschaft betrifft, so ist sie ein negatives Phänomen, nicht das Resultat eines Überschusses von Kraft auf der einen — den hatten die Römer nach Zama nicht mehr —, sondern das eines Mangels an Widerstand auf der andern Seite. Die Römer haben die Welt gar nicht erobert. Sie haben nur in Besitz genommen, was als Beute für jedermann dalag. Das Imperium Romanum ist nicht durch die äußerste Anspannung aller militärischen und finanziellen Hilfsmittel, wie es einst Karthago gegenüber der Fall war, sondern durch den Verzicht des alten Ostens auf äußere Selbstbestimmung entstanden. Man lasse sich nicht durch den Schein glänzender soldatischer Erfolge täuschen. Mit ein paar schlecht geübten, schlecht geführten, übel gelaunten Legionen haben Lukullus und Pompejus ganze Reiche unterworfen, woran zur Zeit der Schlacht bei Issus nicht zu denken gewesen wäre. Die mithridatische Gefahr, eine wirkliche Gefahr für dies nie ernstlich geprüfte System materieller Kräfte, hätte als solche für die Besieger Hannibals niemals bestanden. Die Römer haben nach Zama keinen Krieg gegen eine große Militärmacht mehr geführt und hätten keinen führen können.[21] Ihre klassischen Kriege waren die gegen die Samniten, gegen Pyrrhus und Karthago. Ihre große Stunde war Cannä. Es gibt kein Volk, das Jahrhunderte hindurch auf dem Kothurn steht. Das preußisch-deutsche, das die mächtigen Augenblicke von 1813, 1870 und 1914 hatte, besitzt deren mehr als andere.
Ich lehre hier den Imperialismus, als dessen Petrefakt Reiche wie das ägyptische, chinesische, römische, die indische Welt, die Welt des Islam noch Jahrhunderte und Jahrtausende stehen bleiben und aus einer Erobererfaust in die andre gehen können — tote Körper, amorphe, entseelte Menschenmassen, verbrauchter Stoff einer großen Geschichte — als das typische Symbol des Ausgangs begreifen. Imperialismus ist reine Zivilisation.[S. 52] In dieser Erscheinungsform liegt unwiderruflich das Schicksal des Abendlandes. Der kultivierte Mensch hat seine Energie nach innen, der zivilisierte nach außen. Deshalb sehe ich in Cecil Rhodes den ersten Mann einer neuen Zeit. Er repräsentiert den politischen Stil einer ferneren, abendländischen, germanischen, insbesondere deutschen Zukunft. Sein Wort „Ausdehnung ist alles“ enthält in dieser napoleonischen Fassung die eigentlichste Tendenz einer jeden ausgereiften Zivilisation. Das gilt von den Römern, den Arabern, den Chinesen. Hier gibt es keine Wahl. Hier entscheidet nicht einmal der bewußte Wille des einzelnen oder ganzer Klassen und Völker. Die expansive Tendenz ist ein Verhängnis, etwas Dämonisches und Ungeheures, das den späten Menschen des Weltstadtstadiums packt, in seinen Dienst zwingt und verbraucht, ob er will oder nicht, ob er es weiß oder nicht.[22] Leben ist die Verwirklichung von Möglichem, und für den Gehirnmenschen gibt es nur extensive Möglichkeiten.[23] So sehr der heutige, noch wenig entwickelte Sozialismus sich gegen die Expansion auflehnt, er wird eines Tages mit der Vehemenz eines Schicksals ihr vornehmster Träger sein. Hier rührt die Formensprache der Politik — als unmittelbarer intellektueller Ausdruck einer Art von Menschentum — an ein tiefes metaphysisches Problem: an die durch die unbedingte Gültigkeit des Kausalitätsprinzips bestätigte Tatsache, daß der Geist das Komplement der Ausdehnung ist.
Rhodes erscheint als der erste Vorläufer eines abendländischen Cäsarentypus, für den die Zeit noch lange nicht gekommen ist. Er steht in der Mitte zwischen Napoleon und den Gewaltmenschen des nächsten Jahrhunderts, wie jener Flaminius, der seit 232 die Römer zur Unterwerfung der cisalpinen Gallier — und damit zum Beginn ihrer kolonialen Ausdehnungspolitik drängte, zwischen Alexander und Cäsar. Flaminius war Demagoge,[S. 53] streng genommen ein Privatmann von staatsbeherrschendem Einfluß in einer Zeit, wo der Staatsgedanke der Gewalt wirtschaftlicher Faktoren erliegt, in Rom sicherlich der erste vom cäsarischen Oppositionstypus. Mit ihm endet der organische Machtwille des Patriziats, der von einer Idee getragen ist, und es beginnt die rein materialistische, unethische, schrankenlose Expansion. Alexander und Napoleon waren Romantiker, an der Schwelle der Zivilisation und schon von ihrer kalten und klaren Luft angeweht; aber der eine gefiel sich in der Rolle des Achilleus und der andere las den Werther. Cäsar war lediglich ein Tatsachenmensch von ungeheurem Verstande.
Aber schon Rhodes verstand unter erfolgreicher Politik einzig den territorialen und finanziellen Erfolg. Das ist das Römische an ihm, dessen er sich sehr bewußt war. In dieser Energie und Reinheit hatte sich die westeuropäische Zivilisation noch nicht verkörpert. Nur vor seinen Landkarten konnte er in eine Art dichterischer Ekstase geraten, er, der als Sohn eines puritanischen Pfarrhauses mittellos nach Südafrika gekommen war und ein Riesenvermögen als Machtmittel für seine politischen Ziele erworben hatte. Sein Gedanke einer transafrikanischen Bahn vom Kap nach Kairo, sein Entwurf eines südafrikanischen Reiches, seine geistige Gewalt über die Minenmagnaten, eiserne Geldmenschen, die er zwang, ihr Vermögen in den Dienst seiner Ideen zu stellen, seine Hauptstadt Buluwayo, die er, der allmächtige Staatsmann ohne ein definierbares Verhältnis zum Staate, als künftige Residenz in königlichem Maßstabe anlegte, seine Kriege, diplomatischen Aktionen, Straßensysteme, Syndikate, Heere, sein Begriff von der „großen Pflicht des Gehirnmenschen gegenüber der Zivilisation“ — alles das ist, groß und vornehm, das Vorspiel einer uns noch vorbehaltenen Zukunft, mit der die Geschichte des westeuropäischen Menschen endgültig schließen wird.
Wer nicht begreift, daß sich an diesem Ausgang nichts ändern läßt, daß man dies wollen muß oder gar nichts, daß man dies Schicksal lieben oder an der Zukunft, am Leben verzweifeln muß, wer das Großartige nicht empfindet, das auch in dieser Wirksamkeit höchster Intelligenzen, dieser Energie und Disziplin metallharter Naturen, diesem Kampf mit den kältesten,[S. 54] abstraktesten Mitteln liegt, wer mit dem Idealismus eines Provinzialen herumgeht und den Lebensstil verflossener Zeiten sucht, der muß es aufgeben, Geschichte verstehen, Geschichte durchleben, Geschichte schaffen zu wollen.
So erscheint das Imperium Romanum nicht mehr als ein einmaliges Phänomen, sondern als normales Produkt einer strengen und energischen, weltstädtischen, eminent praktischen Geistigkeit und als typischer Endzustand, der schon einige Male dagewesen, aber bisher nicht identifiziert worden ist. Begreifen wir endlich, daß das Geheimnis der historischen Form nicht an der Oberfläche liegt und nicht durch Ähnlichkeiten des Kostüms oder der Szene zu fassen ist, daß es in der menschlichen so gut wie in der Tier- und Pflanzengeschichte Erscheinungen von täuschender Ähnlichkeit gibt, die innerlich nichts Verwandtes besitzen — Karl der Große und Harun al Raschid, Alexander und Cäsar, die Germanenkriege gegen Rom und die Mongolenstürme gegen Westeuropa — und andre, die bei größter äußerer Verschiedenheit Identisches zum Ausdruck bringen wie Trajan und Ramses II., die Bourbonen und der attische Demos, Mohammed und Pythagoras. Kommen wir zur Einsicht, daß das 19. und 20. Jahrhundert, vermeintlich der Gipfel einer geradlinig ansteigenden Weltgeschichte, als Phänomen tatsächlich in jeder bis zum Ende gereiften Kultur nachzuweisen ist, nicht mit Sozialisten, Impressionisten, elektrischen Bahnen, Torpedos und Differentialgleichungen, die nur zum Körper der Zeit gehören, sondern mit seiner zivilisierten Geistigkeit, die auch ganz andere Möglichkeiten äußerer Gestaltung besitzt, daß die Gegenwart also ein Durchgangsstadium darstellt, das unter gewissen Bedingungen mit Sicherheit eintritt, daß es mithin auch ganz bestimmte spätere Zustände als die modernen westeuropäischen gibt, daß sie in der abgelaufenen Geschichte schon mehr als einmal dagewesen sind und daß damit die Zukunft des Abendlandes nicht ein uferloses Hinauf und Vorwärts in der Richtung unserer augenblicklichen Ideale und mit phantastischen Zeiträumen ist, sondern ein in Hinsicht auf Form und Dauer streng begrenztes und unausweichlich bestimmtes Einzelphänomen der Historie vom Umfange weniger Jahrhunderte, das aus den vorliegenden Beispielen[S. 55] übersehen und in wesentlichen Zügen berechnet werden kann.
Hat man diese Höhe der Betrachtung erreicht, so fallen einem alle Früchte von selbst zu. An den einen Gedanken schließen sich, mit ihm lösen sich zwanglos alle Einzelprobleme, welche auf den Gebieten der Religionsforschung, der Kunstgeschichte, der Erkenntniskritik, der Ethik, der Politik, der Nationalökonomie den modernen Geist seit Jahrzehnten und leidenschaftlich, aber ohne den letzten Erfolg beschäftigt haben.
Dieser Gedanke gehört zu den Wahrheiten, die nicht mehr bestritten werden, sobald sie einmal in voller Deutlichkeit ausgesprochen sind. Er gehört zu den innern Notwendigkeiten der Kultur Westeuropas und ihres Weltgefühls. Er ist geeignet, die Lebensanschauung derjenigen von Grund aus zu ändern, die ihn völlig begriffen, das heißt ihn sich innerlich zu eigen gemacht haben. Es bedeutet eine große Vertiefung des uns natürlichen und notwendigen Weltbildes, daß wir die welthistorische Entwicklung, in der wir stehen und die wir bis jetzt rückwärts als ein organisches Ganze zu betrachten gelernt haben, nun auch vorwärts in großen Umrissen verfolgen können. Dergleichen hat sich bisher nur der Physiker bei seinen Berechnungen träumen lassen. Es bedeutet, ich wiederhole es noch einmal, auch im Historischen den Ersatz des ptolemäischen durch einen kopernikanischen Aspekt, das heißt eine unermeßliche Erweiterung des Lebenshorizontes.
Es stand bis jetzt frei, von der Zukunft zu hoffen, was man wollte. Wo es keine Tatsachen gibt, regiert das Gefühl. Künftig wird es jedem Pflicht sein, vom Kommenden zu erfahren, was geschehen kann und also geschehen wird, mit der unabänderlichen Notwendigkeit eines Schicksals, und was von unsern persönlichen oder den Zeitidealen ganz unabhängig ist. Gebrauchen wir das bedenkliche Wort Freiheit, so steht es uns nicht mehr frei, dieses oder jenes zu verwirklichen, sondern das Notwendige oder nichts. Dies als „gut“ zu empfinden ist im Grunde das Kennzeichen des Realisten. Es bedauern und tadeln heißt aber nicht es ändern. Zur Geburt gehört[S. 56] der Tod, zur Jugend das Alter, zum Leben überhaupt seine Gestalt und die vorbestimmten Grenzen seiner Dauer. Die Gegenwart ist eine zivilisierte, keine kultivierte Phase. Damit scheidet eine ganze Reihe von Lebensinhalten als unmöglich aus. Man kann das bedauern und dies Bedauern in eine pessimistische Philosophie und Lyrik kleiden — und man wird das künftig tun —, aber man kann es nicht ändern. Es wird nicht mehr erlaubt sein, im Heute und Morgen mit aller Selbstsicherheit die Geburt oder Blüte von dem anzunehmen, was man wünscht, wenn auch die historische Erfahrung laut genug dagegen redet.
Ich bin auf den Einwand gefaßt, daß ein solcher Weltaspekt, der über die allgemeinen Direktiven der Zukunft Gewißheit gibt und weitgehende Hoffnungen abschneidet, lebensfeindlich und für viele ein Verhängnis sein würde, falls er einmal mehr als bloße Theorie, falls er die praktische Weltanschauung der für die Gestaltung der Zukunft wirklich in Betracht kommenden Gruppe von Persönlichkeiten sein würde.
Ich bin nicht der Meinung. Wir sind zivilisierte Menschen, nicht Menschen der Gotik und des Rokoko; wir haben mit den harten und kalten Tatsachen eines späten Lebens zu rechnen, dessen Parallele nicht im perikleischen Athen, sondern im cäsarischen Rom liegt. Von einer großen Malerei und Musik wird für den westeuropäischen Menschen nicht mehr die Rede sein. Seine architektonischen Möglichkeiten sind seit hundert Jahren erschöpft. Ihm sind nur extensive Möglichkeiten geblieben. Aber ich sehe den Nachteil nicht, der entstehen könnte, wenn eine tüchtige und von unbegrenzten Hoffnungen geschwellte Generation beizeiten erfährt, daß ein Teil dieser Hoffnungen zu Fehlschlägen führen muß. Mögen es die teuersten sein; wer etwas wert ist, wird das überwinden. Es ist wahr, daß es für einzelne tragisch ausgehen kann, wenn sich ihrer in den entscheidenden Jahren die Gewißheit bemächtigt, daß im Bereiche der Architektur, des Dramas, der Malerei für sie nichts mehr zu erobern ist. Mögen sie zugrunde gehen. Man war sich bisher einig darüber, hier keinerlei Schranken anzuerkennen; man glaubte, daß jede Zeit auf jedem Gebiete auch ihre Aufgabe habe; man fand sie, wenn es sein mußte, mit Gewalt und bösem Gewissen, und jedenfalls stellte es sich erst nach dem Tode[S. 57] heraus, ob der Glaube einen Grund hatte und ob die Arbeit eines Lebens notwendig oder überflüssig gewesen war. Aber jeder, der nicht bloßer Romantiker ist, wird diese Ausflucht ablehnen. Das ist nicht der Stolz, der die Römer auszeichnete. Was liegt an denen, die es vorziehen, wenn man vor einer erschöpften Erzgrube ihnen sagt: Hier wird morgen eine neue Ader angeschlagen werden — wie es die augenblickliche Kunst mit ihren durch und durch unwahren Stilbildungen tut —, statt sie auf das reiche Tonlager zu verweisen, das unerschlossen daneben liegt? — Ich betrachte diese Lehre als eine Wohltat für die kommende Generation, weil sie ihr zeigt, was möglich und also notwendig ist und was nicht zu den innern Möglichkeiten der Zeit gehört. Es ist bisher eine Unsumme von Geist und Kraft auf falschen Wegen verschwendet worden. Der westeuropäische Mensch, so historisch er denkt und fühlt, ist in einem gewissen Lebensalter sich nie seiner eigentlichen Richtung bewußt. Er tastet und sucht und verirrt sich, wenn die äußern Anlässe ihm nicht günstig sind. Hier endlich hat die Arbeit von Jahrhunderten ihm die Möglichkeit gegeben, die Lage seines Lebens im Zusammenhang mit der Gesamtkultur zu übersehen und zu prüfen, was er kann und soll. Wenn unter dem Eindruck dieses Buches sich Menschen der neuen Generation der Technik statt der Lyrik, der Marine statt der Malerei, der Politik statt der Erkenntniskritik zuwenden, so tun sie, was ich wünsche, und man kann ihnen nichts Besseres wünschen.
Es bleibt noch das Verhältnis einer Morphologie der Weltgeschichte zur Philosophie festzustellen. Jede echte Geschichtsbetrachtung ist echte Philosophie — oder bloße Ameisenarbeit. Aber der Philosoph älteren Stils bewegt sich in einem schweren Irrtum. Er glaubt nicht an das Wandelbare seiner Bestimmung. Er meint, daß das höhere Denken einen ewigen und unveränderlichen Gegenstand besitze, daß die großen Fragen zu allen Zeiten dieselben seien und daß sie endlich einmal beantwortet werden könnten.
[S. 58]
Aber Frage und Antwort sind hier eins, und jede große Frage, der das leidenschaftliche Verlangen nach einer ganz bestimmten Antwort schon zugrunde liegt, hat lediglich die Bedeutung eines Lebenssymbols. Es gibt keine ewigen Wahrheiten. Jede Philosophie ist ein Ausdruck ihrer und nur ihrer Zeit, und es gibt nicht zwei Zeitalter, welche die gleichen philosophischen Intentionen besäßen, sobald von wirklicher Philosophie und nicht von irgendwelchen akademischen Belanglosigkeiten über Urteilsformen oder Gefühlskategorien die Rede sein soll. Der Unterschied liegt nicht zwischen unsterblichen und vergänglichen Lehren, sondern zwischen Lehren, welche eine Zeitlang oder niemals lebendig sind. Unvergänglichkeit gewordener Gedanken ist eine Illusion. Das Wesentliche ist, was für ein Mensch in ihnen Gestalt gewinnt. Je größer der Mensch, um so wahrer die Philosophie — im Sinne der inneren Wahrheit eines großen Kunstwerkes nämlich, was von der Beweisbarkeit und selbst Widerspruchslosigkeit der einzelnen Sätze unabhängig ist. Im höchsten Falle kann sie den ganzen Gehalt einer Zeit erschöpfen, in sich verwirklichen und ihn so, formgeworden, in Persönlichkeit und Idee verkörpert, der ferneren Entwicklung übergeben. Das wissenschaftliche Kostüm, die gelehrte Maske einer Philosophie entscheidet hier nichts. Nichts ist einfacher, als an Stelle von Gedanken, die man nicht hat, ein System zu begründen. Aber selbst ein guter Gedanke ist wenig wert, wenn er von einem Flachkopf ausgesprochen wird. Allein die Notwendigkeit für das Leben entscheidet über den Rang einer Lehre.
Deshalb sehe ich den Prüfstein für den Wert eines Denkers in seinem Blick für die großen Tatsachen seiner Zeit. Erst hier entscheidet es sich, ob jemand nur ein geschickter Konstrukteur von Systemen und Prinzipien ist, ob er sich nur mit Gewandtheit und Belesenheit in Definitionen und Analysen bewegt — oder ob es die Seele der Zeit selbst ist, die aus seinen Werken und Intuitionen redet. Ein Philosoph, der nicht auch die Wirklichkeit ergreift und beherrscht, wird niemals ersten Ranges sein. Die Vorsokratiker waren Kaufleute und Politiker großen Stils. Plato kostete es fast das Leben, daß er in Syrakus seine politischen Gedanken hatte verwirklichen wollen. Derselbe Plato[S. 59] hat jene Reihe geometrischer Sätze gefunden, die es Euklid erst möglich machte, das System der antiken Mathematik aufzubauen. Pascal, den Nietzsche nur als den „gebrochenen Christen“ kennt, Descartes, Leibniz waren die ersten Mathematiker und Techniker ihrer Zeit.
Und hier finde ich einen starken Einwand gegen alle Philosophen der jüngsten Vergangenheit. Was ihnen fehlt, ist der entscheidende Rang im wirklichen Leben. Keiner von ihnen hat in die hohe Politik, in die Entwicklung der modernen Technik, des Verkehrs, der Volkswirtschaft, in irgendeine Art von großer Wirklichkeit auch nur mit einer Tat, einem mächtigen Gedanken entscheidend eingegriffen. Keiner zählt in der Mathematik, der Physik, der Staatswissenschaft im geringsten mit, wie es noch mit Kant der Fall war. Was das bedeutet, lehrt ein Blick auf andere Zeiten. Aristoteles hat in seiner Schrift über den Staat der Athener für die sozialpolitische Situation des anbrechenden Hellenismus das feinste Verständnis bewiesen. Er hätte sehr wohl — wie Sophokles — die Finanzverwaltung von Athen führen können. Goethe, dessen ministerielle Amtsführung mustergültig war und dem leider ein großer Staat als Wirkungskreis gefehlt hat, wandte sein Interesse dem Bau des Suez- und Panamakanals, den er innerhalb einer genau eingetroffenen Frist voraussah, und deren kommerzieller Wirkung zu. Das amerikanische Wirtschaftsleben, seine Rückwirkung auf das alte Europa und die eben im Aufstieg begriffene Maschinenindustrie haben ihn immer wieder beschäftigt. Hobbes war einer der Väter des großen Planes, Südamerika für England zu erwerben, und wenn es auch damals bei der Besetzung von Jamaika blieb, so hat er doch den Ruhm, ein Mitbegründer des englischen Kolonialreiches zu sein. Leibniz, sicherlich der mächtigste Geist in der westeuropäischen Philosophie, der Begründer der Differentialrechnung und der analysis situs, hat in einer zum Zweck der politischen Entlastung Deutschlands entworfenen Denkschrift an Ludwig XIV. die Bedeutung Ägyptens für die französische Weltpolitik dargelegt. Seine Gedanken waren der Zeit (1672) so weit vorausgeschritten, daß man später überzeugt war, Napoleon habe sie bei seiner Expedition nach dem Orient benützt. Leibniz stellte schon damals[S. 60] fest, was Napoleon seit Wagram immer deutlicher begriff, daß Erwerbungen am Rhein und in Belgien die Position Frankreichs nicht dauernd verbessern könnten und daß die Landenge von Suez eines Tages der Schlüssel zur Weltherrschaft sein werde. Ohne Zweifel war der König den tiefen politischen und strategischen Ausführungen des Philosophen nicht gewachsen.
Ein Blick von Menschen solchen Formats auf heutige Philosophen ist beschämend. Welche Geringfügigkeit der Person! Welche Alltäglichkeit des geistigen und praktischen Horizontes! Wie kommt es, daß die bloße Vorstellung, einer von ihnen solle seinen geistigen Rang als Staatsmann, als Diplomat, als Organisator großen Stils, als Leiter irgendeines mächtigen kolonialen, kaufmännischen oder Verkehrsunternehmens beweisen, geradezu Mitleid erregt? Aber das ist kein Zeichen von Innerlichkeit, sondern von Mangel an Gewicht. Ich sehe mich vergebens um, wo einer von ihnen auch nur durch ein tiefes und vorauseilendes Urteil in einer entscheidenden Zeitfrage sich einen Namen gemacht hätte. Ich finde nichts als Provinzmeinungen, wie sie jeder hat. Ich frage mich, wenn ich das Buch eines modernen Denkers zur Hand nehme, was er — außer professoralem oder windigem Parteigerede vom Niveau eines mittleren Journalisten, wie man es bei Guyau, Bergson, Spencer, Dühring, Eucken findet — vom Tatsächlichen der Weltpolitik, von den großen Problemen der Weltstädte, des Kapitalismus, der Zukunft des Staates, des Verhältnisses der Technik zum Ausgang der Zivilisation, des Russentums, der Wissenschaft überhaupt ahnt. Goethe hätte das alles verstanden und geliebt. Von lebenden Philosophen übersieht es nicht einer. Das ist, ich wiederhole es, nicht Inhalt der Philosophie, aber ein unzweifelhaftes Symptom ihrer inneren Notwendigkeit, ihrer Fruchtbarkeit und ihres symbolischen Ranges.
Über die Tragweite dieses negativen Resultates sollte man sich keiner Täuschung hingeben. Offenbar hat man den letzten Sinn philosophischer Wirksamkeit aus den Augen verloren. Man verwechselt sie mit Predigt, Agitation, Feuilleton oder Fachwissenschaft. Man ist von der Vogelperspektive zur Froschperspektive herabgekommen. Es handelt sich um nichts Geringeres als um die Frage, ob eine echte Philosophie heute oder morgen[S. 61] überhaupt möglich ist. Im andern Fall wäre es besser, Pflanzer oder Ingenieur zu werden, irgend etwas Wahres und Wirkliches, statt verbrauchte Themen unter dem Vorwande eines „neuerlichen Aufschwungs des philosophischen Denkens“ wiederzukäuen und lieber einen Flugmotor zu konstruieren als eine neue und ebenso überflüssige Theorie der Apperzeption. Es ist wahrhaftig ein armseliger Lebensinhalt, die Ansichten über den Begriff des Willens und den psychophysischen Parallelismus noch einmal und etwas anders zu formulieren, als es hundert Vorgänger getan haben. Das mag ein „Beruf“ sein, Philosophie ist es nicht. Was nicht das ganze Leben einer Zeit bis in die tiefsten Tiefen ergreift und verändert, sollte verschwiegen bleiben. Und was schon gestern möglich war, ist heute zum mindesten nicht mehr notwendig.
Ich liebe die Tiefe und Feinheit mathematischer und physikalischer Theorien, denen gegenüber der Ästhetiker und Physiolog ein Stümper ist. Für die prachtvoll klaren, hochintellektuellen Formen eines Schnelldampfers, eines Stahlwerkes, einer Präzisionsmaschine, die Subtilität und Eleganz gewisser chemischer und optischer Verfahren gebe ich den ganzen Stilplunder des heutigen Kunstgewerbes samt Malerei und Architektur hin. Ich ziehe einen römischen Aquädukt allen römischen Tempeln und Statuen vor. Ich liebe das Kolosseum und die Riesengewölbe des Palatin, weil sie heute mit der braunen Masse ihrer Ziegelkonstruktion das echte Römertum, den großartigen Tatsachensinn ihrer Ingenieure vor Augen stellen. Sie würden mir gleichgültig sein, wenn der leere und anmaßende Marmorprunk der Cäsaren mit seinen Statuenreihen, Friesen und überladenen Architraven noch erhalten wäre. Man werfe einen Blick auf eine Rekonstruktion der Kaiserfora: Man wird das getreue Seitenstück moderner Weltausstellungen finden, aufdringlich, massenhaft, leer, ein dem perikleischen Griechen wie dem Menschen des Rokoko ganz fremdes Prahlen mit Material und Dimensionen, wie es ganz ebenso die Ruinen von Luxor und Karnak aus der Zeit Ramses II., der ägyptischen Modernität von 1300 v. Chr. zeigen. Nicht umsonst verachtete der echte Römer den Graeculus histrio, den „Künstler“, den „Philosophen“ auf dem Boden römischer Zivilisation. Künste und Philosophie gehörten nicht mehr in diese[S. 62] Zeit; sie waren erschöpft, verbraucht, überflüssig. Das sagte ihm sein Instinkt für die Realitäten des Lebens. Ein römisches Gesetz wog schwerer als alle damalige Lyrik und Metaphysik der Schulen. Und ich behaupte, daß heute ein besserer Philosoph in manchem Erfinder, Diplomaten und Finanzmann steckt als in allen denen, welche das platte Handwerk der experimentellen Psychologie treiben. Das ist eine Lage, wie sie auf einer gewissen historischen Stufe immer wieder eintritt. Es wäre sinnlos gewesen, wenn ein Römer von geistigem Range, statt als Konsul oder Prätor ein Heer zu führen, eine Provinz zu organisieren, Städte und Straßen zu bauen oder in Rom „der erste zu sein“, in Athen oder Rhodos irgendeine neue Nuance der nachplatonischen Kathederphilosophie hätte aushecken wollen. Natürlich hat es auch keiner getan. Das lag nicht in der Richtung der Zeit und konnte also nur Menschen dritten Ranges reizen, die immer gerade bis zu dem Zeitgeist von vorgestern vordringen. Es ist eine sehr ernste Frage, ob dies Stadium für uns bereits eingetreten ist oder noch nicht.
Ein Jahrhundert rein extensiver Wirksamkeit unter Ausschluß hoher künstlerischer und metaphysischer Produktion — sagen wir kurz ein irreligiöses Zeitalter, was sich mit dem Begriff des Weltstädtischen durchaus deckt — ist eine Zeit des Niedergangs. Gewiß. Aber wir haben diese Zeit nicht gewählt. Wir können es nicht ändern, daß wir als Menschen des beginnenden Winters der vollen Zivilisation und nicht auf der Sonnenhöhe einer reifen Kultur zur Zeit des Phidias oder Mozart geboren sind. Es hängt alles davon ab, daß man sich diese Lage, dies Schicksal, klar macht und begreift, daß man sich darüber belügen, aber nicht hinwegsetzen kann. Wer sich dies nicht eingesteht, zählt unter den Menschen seiner Generation nicht mit. Er bleibt ein Narr, ein Charlatan oder ein Pedant.
Bevor man heute an ein Problem herantritt, hat man sich also zu fragen — eine Frage, die schon vom Instinkt der wirklich Berufenen beantwortet wird —, was einem Menschen dieser Tage möglich ist und was er sich verbieten muß. Es ist immer nur eine ganz kleine Anzahl metaphysischer Aufgaben, deren Lösung einer Epoche des Denkens vorbehalten ist. Und es liegt[S. 63] bereits wieder eine ganze Welt zwischen der Zeit Nietzsches, in der noch ein letzter Zug von Romantik wirksam war, und der Gegenwart, die von aller Romantik endgültig geschieden ist.
Die systematische Philosophie war mit dem Ausgang des 18. Jahrhunderts vollendet. Kant hatte ihre äußersten Möglichkeiten in eine große und — für den westeuropäischen Geist — vielfach endgültige Form gebracht. Ihr folgt wie auf Plato und Aristoteles eine spezifisch großstädtische, nicht spekulative, sondern praktische, irreligiöse, ethisch-gesellschaftliche Philosophie. Sie beginnt, Zeno und Epikur entsprechend, mit Schopenhauer, der zuerst den Willen zum Leben („schöpferische Lebenskraft“) in den Mittelpunkt seines Denkens stellte, aber, was die tiefere Tendenz seiner Lehre verschleiert hat, die systematischen Velleitäten von der Erscheinung und dem Ding an sich, von Form und Inhalt der Anschauung, vom Unterschiede zwischen Verstand und Vernunft unter dem Eindruck einer großen Tradition noch beibehielt. Es ist derselbe schöpferische Lebenswille, der im Tristan schopenhauerisch verneint, im Siegfried darwinistisch bejaht wurde, den Nietzsche im Zarathustra glänzend und theatralisch formulierte, der durch den Hegelianer Marx der Anlaß einer nationalökonomischen, durch den Malthusianer Darwin der einer zoologischen Hypothese wurde, die beide gemeinsam und unvermerkt das Weltgefühl des westeuropäischen Großstädters verwandelt haben, und der von Hebbels Judith bis zu Ibsens Epilog eine Reihe tragischer Konzeptionen vom gleichen Typus hervorrief, damit aber ebenfalls den Umkreis echter philosophischer Möglichkeiten erschöpft hatte.
Die systematische Philosophie liegt uns heute unendlich fern; die ethische ist abgeschlossen. Es bleibt noch eine dritte, dem hellenischen Skeptizismus entsprechende Möglichkeit innerhalb der abendländischen Geistigkeit, die, welche durch die bisher unbekannte Methode der vergleichenden historischen Morphologie bezeichnet wird. Eine Möglichkeit, das heißt eine Notwendigkeit. Der antike Skeptizismus ist ahistorisch: er zweifelt, indem er einfach nein sagt. Der des Abendlandes muß, wenn er innere Notwendigkeit besitzen, wenn er ein Symbol unseres dem Ende sich zuneigenden Seelentums sein soll, durch und durch historisch sein. Er hebt auf, indem er[S. 64] alles als relativ, als geschichtliches Phänomen versteht. Er verfährt psychologisch. Die skeptische Philosophie tritt im Hellenismus als Negation der Philosophie auf — man erklärt sie für zwecklos. Wir nehmen demgegenüber die Geschichte der Philosophie als letztes ernsthaftes Thema der Philosophie an. Das ist Skepsis. Man verzichtet auf absolute Standpunkte, der Grieche, indem er über die Vergangenheit seines Denkens lächelt, wir, indem wir sie als Organismus begreifen.
In diesem Buche liegt der Versuch vor, diese „unphilosophische Philosophie“ der Zukunft — es würde die letzte Westeuropas sein — zu skizzieren. Der Skeptizismus ist Ausdruck einer reinen Zivilisation; er zersetzt das Weltbild der voraufgegangenen Kultur. Hier erfolgt die Auflösung aller älteren Probleme ins Genetische. Die Überzeugung, daß alles was ist, auch geworden ist, daß allem Naturhaften und Erkennbaren ein Historisches zugrunde liegt, der Welt als dem Wirklichen ein Ich als das Mögliche, das sich in ihr verwirklicht hat, die Einsicht, daß nicht nur im Was, sondern auch im Wann und Wie lange ein tiefes Geheimnis ruht, führt auf die Tatsache, daß alles, was immer es sonst sei, auch Ausdruck eines Lebendigen sein muß. Im Gewordnen spiegelt sich das Werden. In der alten Formel esse est percipi drängt sich das Urgefühl hervor, daß alles Vorhandene in einer entscheidenden Beziehung zum lebenden Menschen stehen muß und daß für den toten nichts mehr „da ist“. Aber hat er die Welt, seine Welt „verlassen“ oder hat er sie durch den Tod aufgehoben? Das ist die Frage. Gerade diese Beziehung aber ist von den Denkern der systematischen Periode nur in formaler Hinsicht, naturhaft, zeitlos, erkenntniskritisch also untersucht worden. Man dachte an „den Menschen“ schlechthin, nicht an bestimmte historische Menschen. Für den Denker der ethischen Periode, schon für Schopenhauer, trat diese Frage in den Hintergrund vor der andern, idealistisch oder utilitarisch gefaßten nach dem Werte dessen, was für den einzelnen oder für alle „da ist“. Aber auch hier dachte man an „den Menschen“ als Typus, ohne die Berechtigung so allgemeiner Folgerungen zu prüfen. Hier endlich, im Stadium des historisch-psychologischen Skeptizismus, wird aus dem unmittelbaren[S. 65] Lebensgefühl heraus bemerkt, daß das gesamte Bild der Umwelt eine Funktion des Lebens selbst ist, Spiegel, Ausdruck, Sinnbild der lebendigen Seele, und zwar zunächst jeder einzelnen für sich. Auch Erkenntnisse und Wertungen sind Akte lebender Menschen. Dem frühen Denken ist die äußere Wirklichkeit Erkenntnisprodukt und Anlaß ethischer Schätzungen; dem späten ist sie vor allem Symbol. Die Morphologie der Weltgeschichte wird notwendig zu einer universellen Symbolik.
Damit fällt auch der Anspruch des höheren Denkens, allgemeine und ewige Wahrheiten aufzufinden. Wahrheiten gibt es nur in bezug auf ein bestimmtes Menschentum. Diese Philosophie selbst würde demnach Ausdruck und Spiegelung der abendländischen Seele, im Unterschiede etwa von der antiken und indischen, und zwar nur in deren zivilisiertem Stadium sein, womit ihr Gehalt als Weltanschauung, ihre praktische Tragweite und ihr Geltungsbereich bestimmt sind.
Endlich sei eine persönliche Bemerkung gestattet. Im Jahre 1911 hatte ich die Absicht, über einige politische Erscheinungen der Gegenwart und die aus ihnen möglichen Schlüsse für die Zukunft etwas aus einem weiteren Horizont zusammenzustellen. Der Weltkrieg als die bereits unvermeidlich gewordene äußere Form der historischen Krisis wurde damals unmittelbar bevorstehend, und es handelte sich darum, ihn aus dem Geiste der voraufgehenden Jahrhunderte — nicht Jahre — zu begreifen. Im Verlauf der ursprünglich kleinen Arbeit drängte sich die Überzeugung auf, daß zu einem wirklichen Verständnis der Epoche der Umfang der Grundlagen viel weiter gewählt werden müsse, daß es völlig unmöglich sei, eine Untersuchung dieser Art auf eine einzelne Zeit und deren politischen Tatsachenkreis zu beschränken, sie im Rahmen pragmatischer Erwägungen zu halten und selbst auf rein metaphysische, höchst transzendente Betrachtungen zu verzichten, wenn man nicht auch auf jede tiefere Notwendigkeit der Resultate Verzicht leisten wollte. Es wurde deutlich, daß ein politisches Problem[S. 66] nicht von der Politik selbst aus begriffen werden kann und daß wesentliche Züge, die in der Tiefe mitwirken, nur auf dem Gebiete der Kunst, sogar nur in der Form weit entlegener wissenschaftlicher und rein philosophischer Gedanken greifbar in Erscheinung treten. Selbst eine politisch-soziale Analyse der letzten Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts, eines Stadiums gespannter Ruhe zwischen zwei mächtigen, weithin sichtbaren Ereignissen, dem einen, das durch die Revolution und Napoleon das Bild der westeuropäischen Wirklichkeit für hundert Jahre bestimmt hat, und einem andern von mindestens der gleichen Tragweite, das sich mit steigender Geschwindigkeit näherte, erwies sich als unausführbar, ohne daß zuletzt alle großen Probleme des Seins in ihrem vollen Umfange einbezogen wurden. Denn es tritt im historischen wie im naturhaften Weltbilde nicht das geringste hervor, ohne daß in ihm die ganze Summe aller tiefsten Tendenzen verkörpert wäre. So erfuhr das ursprüngliche Thema eine ungeheure Erweiterung. Eine Unzahl überraschender, großenteils ganz neuer Fragen und Zusammenhänge drängte sich auf. Endlich war es vollkommen klar, daß kein Fragment der Geschichte vollkommen durchleuchtet werden könne, bevor nicht das Geheimnis der Weltgeschichte überhaupt, genauer das der Geschichte des höhern Menschentums als einer organischen Einheit von regelmäßiger Struktur klargestellt war. Und eben das war bisher nicht entfernt geleistet worden.
Von diesem Augenblicke an traten in wachsender Fülle die oft geahnten, zuweilen berührten, nie begriffenen Beziehungen hervor, welche die Formen der bildenden Künste mit denen des Krieges und der Staatsverwaltung verbinden, die tiefe Verwandtschaft zwischen politischen und mathematischen Gebilden derselben Kultur, zwischen religiösen und technischen Anschauungen, zwischen Mathematik, Musik und Plastik, zwischen wirtschaftlichen und Erkenntnisformen. Die tiefinnerliche Abhängigkeit der modernsten physikalischen und chemischen Theorien von den mythologischen Vorstellungen unsrer germanischen Ahnen, die vollkommene Kongruenz im Stil der Tragödie, der dynamischen Technik und des heutigen Geldverkehrs, die zuerst bizarre, dann selbstverständliche Tatsache, daß die Perspektive der Ölmalerei, der Buchdruck, das Kreditsystem, die Fernwaffe,[S. 67] die kontrapunktische Musik einerseits, die nackte Statue, die Polis, die von Griechen erfundene Geldmünze andrerseits identische Ausdrücke eines und desselben seelischen Prinzips sind, wurde unzweifelhaft deutlich, und weit darüber hinaus rückte die Tatsache ins hellste Licht, daß diese mächtigen Gruppen morphologischer Verwandtschaften, von denen jede eine einzelne Art Mensch im Gesamtbilde der Weltgeschichte symbolisch darstellt, von streng symmetrischem Aufbau sind. Erst diese Perspektive legt den wahren Begriff der Historie bloß. Sie läßt sich, da sie selbst wiederum Symptom und Ausdruck einer Zeit und erst heute und nur für den westeuropäischen Menschen innerlich möglich und damit notwendig ist, nur mit gewissen Anschauungen der modernsten Mathematik auf dem Gebiete der Transformationsgruppen entfernt vergleichen. Es waren dies Gedanken, die mich seit langen Jahren beschäftigt hatten, aber dunkel und unbestimmt, bis sie aus diesem Anlaß in greifbarer Gestalt hervortraten.
Ich sah die Gegenwart — den sich nähernden Weltkrieg — in einem ganz andern Licht. Das war nicht mehr eine einmalige Konstellation zufälliger, von nationalen Stimmungen, persönlichen Einwirkungen und wirtschaftlichen Tendenzen abhängiger Tatsachen, denen der Historiker durch irgendein kausales Schema politischer oder sozialer Natur den Anschein der Einheit und materiellen Notwendigkeit aufprägt; das war der Typus eines historischen Aktes, der innerhalb eines großen historischen Organismus von genau abgrenzbarem Umfange einen biographisch seit Jahrhunderten vorbestimmten Platz hat. Eine Unsumme leidenschaftlichster Fragen und Einsichten, die heute in tausend Büchern und Meinungen, aber zerstreut, vereinzelt, aus dem beschränkten Horizont eines Spezialgebietes zutage traten und deshalb reizen, bedrücken und verwirren, aber nicht befreien konnten, bezeichnet die große Krisis. Man kennt sie, aber man übersieht ihre Identität. Ich nenne die in ihrer wahren Bedeutung gar nicht begriffenen Kunstprobleme, die dem Streit um Form und Inhalt, um Linie oder Raum, um das Zeichnerische oder Malerische, den Begriff des Stils, den Sinn des Impressionismus und der Musik Wagners zugrunde liegen; den Niedergang der[S. 68] Kunst, den wachsenden Zweifel am Werte der Wissenschaft; die schweren Fragen, welche aus dem Sieg der Weltstadt über das Bauerntum hervorgehen: die Kinderlosigkeit, die Landflucht, den sozialen Rang des fluktuierenden vierten Standes; die Krisis im Sozialismus, im Parlamentarismus, im Rationalismus; die Stellung des Einzelnen zum Staate; das Eigentumsproblem, das davon abhängende Eheproblem; auf scheinbar ganz anderm Gebiete die massenhaften völkerpsychologischen Arbeiten über Mythen und Kulte, über die Anfänge der Kunst, der Religion, des Denkens, die mit einem Male nicht mehr ideologisch, sondern streng morphologisch behandelt wurden — Fragen, die alle das eine, nie mit hinreichender Deutlichkeit ins Bewußtsein getretene Rätsel der Historie überhaupt zum Ziel hatten. Hier lagen nicht unzählige, sondern ein und dieselbe Aufgabe vor. Hier hatte jeder etwas geahnt, aber keiner von seinem engen Standpunkte aus die einzige und umfassende Lösung gefunden, die seit den Tagen Nietzsches in der Luft lag, der alle entscheidenden Probleme bereits in Händen hielt, ohne als Romantiker es zu wagen, der strengen Wirklichkeit ins Gesicht zu sehen.
Darin liegt aber auch die tiefe Notwendigkeit der abschließenden Lehre, die kommen mußte und nur zu dieser Zeit kommen konnte. Sie ist kein Angriff auf das Vorhandene an Ideen und Werken. Sie bestätigt vielmehr alles, was seit Generationen gesucht und geleistet wurde. Dieser Skeptizismus stellt den Kern dessen dar, was auf allen Einzelgebieten, gleichviel in welcher Absicht, an lebendigen Tendenzen vorliegt.
Vor allem aber fand sich endlich der Gegensatz, aus dem allein das Wesen der Geschichte erfaßt werden kann: der von Historie und Natur. Ich wiederhole: der Mensch ist als Element und Träger der Welt nicht nur Glied der Natur, sondern auch Glied der Geschichte, eines zweiten Kosmos, von andrer Ordnung und andrem Gehalte, der von der gesamten Metaphysik zugunsten des ersten vernachlässigt worden ist. Was mich zum ersten Nachdenken über diese Grundfrage unsres Weltbewußtseins brachte, war die Beobachtung, daß der heutige Historiker, an den sinnlich greifbaren Ereignissen, dem Gewordenen, herumtastend, die Geschichte, das Geschehen, das[S. 69] Werden selbst bereits ergriffen zu haben glaubt, ein Vorurteil aller nur verstandesmäßig Erkennenden, nicht auch Schauenden,[24] das schon die großen Eleaten stutzig gemacht hatte, als sie behaupteten, daß es, für den Erkennenden nämlich, kein Werden, nur ein Sein (Gewordensein) gebe. Mit andern Worten: man sah die Geschichte als Natur, im Objektsinne des Physikers, und handelte danach. Von hier schreibt sich der folgenschwere Mißgriff, die Prinzipien der Kausalität, des Gesetzes, des Systems, also die Struktur des starren Seins in den Aspekt des Geschehens zu legen. Man verhielt sich, als gebe es eine menschliche Kultur etwa wie es Elektrizität oder Gravitation gibt, mit den im wesentlichen gleichen Möglichkeiten der Analyse; man hatte den Ehrgeiz, die Gewohnheiten des Naturforschers zu kopieren, so daß man wohl gelegentlich fragte, was denn die Gotik, der Islam, die antike Polis sei, nicht aber, warum diese Symbole eines Lebendigen gerade damals und dort auftauchen mußten, in dieser Form und für diese Dauer. Man begnügte sich, sobald eine der zahllosen Ähnlichkeiten räumlich und zeitlich weit getrennter Geschichtsphänomene zutage trat, sie einfach zu registrieren, mit einigen geistvollen Bemerkungen über das Wunderbare des Zusammentreffens, über[S. 70] Rhodos als das „Venedig des Altertums“ oder Napoleon als den neuen Alexander, statt gerade hier, wo das Schicksalsproblem als das eigentliche Problem der Historie (das Problem der Zeit nämlich) hervortritt, den höchsten Ernst wissenschaftlich geregelter Psychologie einzusetzen und die Antwort auf die Frage zu finden, welche ganz anders geartete Notwendigkeit, der kausalen ganz und gar fremd, hier am Werke ist. Daß jede Erscheinung auch dadurch ein metaphysisches Rätsel aufgibt, daß sie zu einer niemals gleichgültigen Zeit auftritt, daß man sich auch noch fragen muß, was für ein lebendiger Zusammenhang neben dem anorganisch-naturgesetzlichen im Weltbilde besteht — das ja die Ausstrahlung des ganzen Menschen und nicht, wie Kant meinte, nur die des erkennenden ist —, daß eine Erscheinung nicht nur Tatsache für den Verstand, sondern auch Ausdruck des Seelischen ist, nicht nur Objekt, sondern auch Symbol, und zwar von den höchsten religiösen und künstlerischen Schöpfungen an bis zu den Geringfügigkeiten des Alltagslebens, das war philosophisch etwas Neues.
Endlich sah ich die Lösung deutlich vor mir, in ungeheuren Umrissen, in voller innerer Notwendigkeit, eine Lösung, die auf ein einziges Prinzip zurückführt, das zu finden war und bisher nicht gefunden wurde, etwas, das mich seit meiner Jugend verfolgt und angezogen hatte und das mich quälte, weil ich es als vorhanden, als Aufgabe empfand, aber nicht fassen konnte. So ist aus dem etwas zufälligen Anlaß das vorliegende Buch entstanden, als der vorläufige Ausdruck eines neuen Weltbildes, mit allen Fehlern eines ersten Versuchs behaftet, ich weiß es wohl, unvollständig und sicher nicht ohne Widersprüche. Dennoch enthält es meiner Überzeugung nach die unwiderlegliche Formulierung eines Gedankens, der, ich sage es noch einmal, nicht bestritten werden wird, sobald er einmal ausgesprochen ist.
Das engere Thema ist also eine Analyse des Unterganges der westeuropäischen Kultur. Das Ziel aber ist die Entwicklung einer Philosophie und der ihr eigentümlichen, hier zu prüfenden Methode der vergleichenden Morphologie der Weltgeschichte. Die Arbeit zerfällt naturgemäß in zwei Teile. Der[S. 71] erste, „Gestalt und Wirklichkeit“, der sich mit den Problemen der Zahl, des Schicksals, der Kausalität, der Tragödie, der bildenden Künste, der Weltanschauung, des Lebens, der Naturerkenntnis, des Mythus beschäftigt, enthält die Grundlagen einer Symbolik. Der zweite, „Welthistorische Perspektiven“, wird eine Anzahl historischer Phänomene analysieren: die hier in ihrem wahren Umfange zum ersten Male aufgedeckte arabische Kultur, die Zivilisation, die Weltstadt, das Imperium Romanum, die Grundformen des Staates, des Geldes, der Technik, endlich das Russentum. Ich schließe ausdrücklich hier, wo die eigentliche Geschichte im Vordergrund steht, eine Reihe weiterer Probleme aus, die zur tiefern Begründung gehören, aber selbständiger Behandlung vorbehalten bleiben sollen: die Probleme des Geschlechts, der Familie, der Rassen und Sprachen, der Ehe und des Eigentums, der Religion, des Verhältnisses von Wissen und Glauben, Vaterschaft und Künstlertum, Muttertum und Religiosität.
Die folgenden Tafeln geben einen Überblick über das, was Resultat der Untersuchung ist. Sie mögen zugleich einen Begriff von der Fruchtbarkeit und Tragweite der neuen Methode geben.
[1] Es war ein noch heute nicht überwundener Mißgriff Kants von ungeheurer Tragweite, daß er den äußern und innern Menschen zunächst mit den vieldeutigen und vor allem nicht unveränderlichen Begriffen Raum und Zeit ganz schematisch in Verbindung brachte und weiterhin damit in vollkommen falscher Weise Geometrie und Arithmetik verband, an deren Stelle hier der viel tiefere Gegensatz der mathematischen und chronologischen Zahl wenigstens genannt sein soll. Arithmetik und Geometrie sind beides Raumrechnungen und in ihren höhern Gebieten überhaupt nicht mehr unterscheidbar. Eine Zeitrechnung, über deren Begriff der naive Mensch sich gefühlsmäßig durchaus klar ist, beantwortet die Frage nach dem Wann, nicht dem Was oder Wieviel.
[2] Man muß es fühlen können, wie sehr die Tiefe der formalen Kombination und die Energie des Abstrahierens auf dem Gebiete etwa der Renaissanceforschung oder der Geschichte der Völkerwanderung hinter dem zurückbleibt, was auf dem Gebiete der Funktionentheorie und der theoretischen Optik selbstverständlich ist. Neben dem Physiker und Mathematiker wirkt der Historiker nachlässig.
[3] Die ohnehin sehr spät einsetzenden Versuche der Griechen, nach dem Muster Ägyptens etwas wie einen Kalender oder eine Chronologie zustande zu bringen, sind von höchster Naivität. Die Olympiadenrechnung ist keine Ära wie etwa die christliche Zeitrechnung und außerdem nur ein literarischer Notbehelf, nichts dem Volke Geläufiges. Es gab keinen Nullpunkt, von dem aus man zählen konnte. Wir besitzen die Inschrift eines Vertrages zwischen Elis und Heräa, der „hundert Jahre von diesem Jahre an“ gelten sollte. Welches Jahr dies war, ließ sich aber nicht angeben. Nach einiger Zeit wird man also nicht mehr gewußt haben, wie lange der Vertrag bestand, und offenbar hatte das niemand beachtet. Wahrscheinlich aber werden diese Gegenwartsmenschen ihn überhaupt bald vergessen haben. Es bezeichnet den legendenhaft-kindlichen Charakter des antiken Geschichtsbildes, daß man eine geordnete Datierung der Fakta etwa des „trojanischen Krieges“, der der Stufe nach doch unsern Kreuzzügen entspricht, geradezu als stilwidrig empfinden würde.
[4] Demgegenüber ist es ein Symbol ersten Ranges und ohne Beispiel in der Kunstgeschichte, daß die Hellenen der mykenischen Vorzeit gegenüber — in einem an Steinmaterial überreichen Lande! — vom Steinbau zur Verwendung des Holzes zurückkehrten, woraus sich das Fehlen architektonischer Reste zwischen 1200 und 600 erklärt. Die ägyptische Pflanzensäule war von Anfang an Steinsäule, die dorische Säule war eine Holzsäule. Darin spricht sich die tiefe Feindseligkeit der antiken Seele gegen die Dauer aus.
[5] Hat je eine hellenische Stadt auch nur ein umfassendes Werk ausgeführt, das einen Gedanken an kommende Generationen verrät? Die Straßen- und Bewässerungssysteme, die man in mykenischer, d. h. vorantiker Zeit nachgewiesen hat, sind seit der Geburt antiker Völker — mit dem Anbruch homerischer Zeit also — verfallen und vergessen worden. Ebenso wurde Mykene selbst als historischer Faktor vollständig vergessen. Wir besitzen Tausende von Schrifttäfelchen aus mykenischer Zeit, aus homerischer nicht ein einziges. Aber das ist kein „Rückschritt“, sondern der neue Stil einer andersgearteten Seele. Das ist „reine Gegenwart“.
[6] Von Homer bis zu den Tragödien Senekas, ein volles Jahrtausend hindurch, erscheinen die mythischen Gestalten wie Thyest, Klytämnestra, Herakles trotz ihrer begrenzten Zahl unverändert immer wieder, während in der Dichtung des Abendlandes der faustische Mensch zuerst als Parzeval und Tristan, dann im Sinn der Epoche verwandelt als Hamlet, als Don Quijote, als Don Juan, in einer letzten zeitgemäßen Verwandlung als Faust und Werther und dann als Held des modernen weltstädtischen Romans, immer aber in der Atmosphäre und Bedingtheit eines bestimmten Jahrhunderts auftritt.
[7] Abt Gerbert (als Papst Sylvester II.), der Freund Kaiser Ottos III., hat um 1000, also mit dem Beginn des romanischen Stils und der Kreuzzugsbewegung, den ersten Symptomen einer neuen Seele, die Konstruktion der Schlag- und Räderuhren erfunden. In Deutschland entstanden auch um 1200 die ersten Turmuhren und etwas später die Taschenuhren. Man bemerke die bedeutsame Verbindung der Zeitmessung mit dem Gebäude des religiösen Kultus.
[8] Bei Newton heißt sie bezeichnenderweise Fluxionsrechnung — mit Rücksicht auf gewisse metaphysische Vorstellungen vom Wesen der Zeit. In der griechischen Mathematik kommt die Zeit gar nicht vor.
[9] Hier steht der Historiker auch unter dem verhängnisvollen Vorurteil der Geographie (um nicht zu sagen unter der Suggestion eines Landkartenbildes), die einen Erdteil Europa annimmt, worauf er sich verpflichtet fühlt, auch eine entsprechende ideelle Abgrenzung gegen Asien vorzunehmen. Das Wort Europa sollte aus der Geschichte gestrichen werden. Es gibt keinen „Europäer“ als historischen Typus. Es ist töricht, im Falle der Hellenen von „europäischem Altertum“ (Homer, Heraklit, Pythagoras waren also „Asiaten“?) und von ihrer „Mission“ zu reden, Asien und Europa kulturell anzunähern. Das sind Worte, die aus einer banalen Interpretation der Landkarte stammen und denen nichts Wirkliches entspricht. Es war allein das Wort Europa mit dem unter seinem Einfluß entstandenen Gedankenkomplex, das Rußland mit dem Abendlande in unserm historischen Bewußtsein zu einer durch nichts gerechtfertigten Einheit verband. Hier hat, in einer durch Bücher erzogenen Kultur von Lesern, eine bloße Abstraktion zu ungeheuren realen Konsequenzen geführt. Sie haben, in der Person Peters des Großen, die historische Tendenz einer primitiven Völkermasse auf Jahrhunderte gefälscht, obwohl der russische Instinkt „Europa“ sehr richtig und tief mit einer in Tolstoi, Aksakow und Dostojewski verkörperten Feindseligkeit gegen das „Mütterchen Rußland“ abgrenzt. Orient und Okzident sind Begriffe von echtem historischen Gehalt. „Europa“ ist leerer Schall. Alles, was die Antike an großen Schöpfungen hervorbrachte, entstand unter Negation einer kontinentalen Grenze zwischen Rom und Cypern, Byzanz und Alexandria. Alles, was europäische Kultur heißt, entstand zwischen Weichsel, Adria und Guadalquivir. Und gesetzt, daß Griechenland zur Zeit des Perikles „in Europa lag“, so liegt es heute nicht mehr dort.
[10] Im Neuen Testament ist die polare Fassung mehr durch die Dialektik des Apostels Paulus, die periodische durch die Apokalypse vertreten.
[11] Er liegt schon in Wolfram von Eschenbachs Parzeval und Dantes Divina comedia.
[12] Entscheidend ist die Auswahl des Übriggebliebenen, die nicht allein vom Zufall, sondern ganz wesentlich von einer Tendenz bestimmt ist. Der Attizismus der Augustuszeit, müde, unfruchtbar, pedantisch, zurückschauend, hat den Begriff des Klassischen geprägt und eine ganz kleine Gruppe griechischer Werke bis auf Plato herab als klassisch anerkannt. Das übrige, darunter die gesamte reiche hellenistische Literatur, wurde verworfen und ging fast vollständig verloren. Jene von einem schulmeisterlichen Geschmack ausgewählte Gruppe, die größtenteils erhalten blieb, hat dann das imaginäre Bild des klassischen „Altertums“ in Florenz sowohl wie für Winckelmann, Hölderlin, Goethe und sogar Nietzsche bestimmt.
[13] Das römische otium cum dignitate hat man lediglich als Kehrseite einer großangelegten und energischen öffentlichen Wirksamkeit, nicht als privaten lyrischen oder gelehrten Schlendrian zu verstehen, wie ihn erst sehr spät die Briefe des jüngeren Plinius beschreiben.
[14] Was man in der Entwicklung Strindbergs und vor allem Ibsens, der in der zivilisierten Atmosphäre seiner Probleme immer nur Gast gewesen ist, nicht übersehen wird. Das Motiv von „Brand“ und „Rosmersholm“ ist eine merkwürdige Mischung von angebornem Provinzialismus und theoretisch erworbenem Weltstadthorizont. Nora ist das Urbild einer durch Lektüre aus der Bahn geratenen Provinzlerin.
[15] Der den Kult des Stadtheros Adrastos und den Vortrag der homerischen Gesänge verbot, um dem dorischen Adel die Wurzeln seines Seelentums zu nehmen (um 560).
[16] Ein tiefes Wort, das seinen Sinn erhält, sobald der Barbar zum Kulturmenschen wird, und ihn wieder verliert, sobald der zivilisierte Mensch das „ubi bene, ibi patria“ akzeptiert.
[17] Deshalb verfielen dem Christentum zuerst die Römer, die es sich nicht leisten konnten, Stoiker zu sein.
[18] In Rom und Byzanz wurden sechs- bis zehnstöckige Miethäuser — bei höchstens drei Meter Straßenbreite — errichtet, die bei dem Fehlen aller baupolizeilichen Vorschriften oft genug mit ihren Bewohnern zusammenbrachen. Ein großer Teil der cives Romani, für die „panem et circenses“ den ganzen Lebensinhalt bildeten, besaß nur einen teuer bezahlten Schlafplatz in den ameisenhaft wimmelnden „insulae“.
[19] Die deutsche Gymnastik ist seit 1813 und den höchst provinzialen, urwüchsigen Formen, die ihr Jahn damals gab, in rascher Entwicklung zum Sportmäßigen begriffen. Der Unterschied eines Berliner Sportplatzes an einem großen Tage von einem römischen Zirkus war schon 1914 sehr gering.
[20] Was sich seit 1880 in Deutschland an literarischen Kämpfen abspielt, ist nichts als der übrigens unter ganz belanglosen Leuten geführte Kampf zwischen weltstädtischer und provinzialer Poesie (Heimatkunst).
[21] Die Eroberung Galliens durch Cäsar war ein ausgesprochener Kolonialkrieg, d. h. von einseitiger Aktivität. Daß er trotzdem den Höhepunkt der späteren römischen Kriegsgeschichte bildet, bestätigt nur deren rasch abnehmenden Gehalt an wirklichen Leistungen.
[22] Die modernen Deutschen sind das glänzende Beispiel eines Volkes, das ohne sein Wissen und Wollen expansiv geworden ist. Sie waren es schon, als sie noch das Volk Goethes zu sein glaubten. Bismarck hat diesen tiefern Sinn der durch ihn begründeten Epoche nicht einmal geahnt. Er glaubte den Abschluß einer politischen Entwicklung erreicht zu haben.
[23] So war vielleicht das bedeutende Wort Napoleons an Goethe gemeint. „Was will man heute mit dem Schicksal? Die Politik ist das Schicksal.“
[24] Die Philosophie dieses Buches verdanke ich der Philosophie Goethes, der unbekannten, und erst in viel geringerem Grade der Philosophie Nietzsches. Die Stellung Goethes in der westeuropäischen Metaphysik ist noch gar nicht verstanden worden. Man nennt ihn nicht einmal, wenn von Philosophie die Rede ist. Unglücklicherweise hat er seine Lehre nicht in einem starren System niedergelegt; deshalb übersehen ihn die Systematiker. Aber er war Philosoph. Er nimmt Kant gegenüber dieselbe Stellung ein wie Plato gegenüber Aristoteles, und es ist ebenfalls eine mißliche Sache, Plato in ein System bringen zu wollen. Plato und Goethe repräsentieren die Philosophie des Werdens, Aristoteles und Kant die des Gewordnen. Hier steht Intuition gegen Analyse. Was verstandesmäßig kaum auszusprechen ist, findet sich in einzelnen Vermerken und Gedichten wie den Orphischen Urworten, Strophen wie „Wenn im Unendlichen“ und „Sagt es niemand“, die man als Inkarnationen einer ganz bestimmten Metaphysik zu betrachten hat. An folgendem Ausspruch möchte ich nicht ein Wort geändert wissen: „Die Gottheit ist wirksam im Lebendigen, aber nicht im Toten; sie ist im Werdenden und sich Verwandelnden, aber nicht im Gewordnen und Erstarrten. Deshalb hat auch die Vernunft in ihrer Tendenz zum Göttlichen es nur mit dem Werdenden, Lebendigen zu tun, der Verstand mit dem Gewordenen, Erstarrten, daß er es nutze“ (zu Eckermann).
[S. 73]
|
INDISCHE
seit 1500 v. Chr. |
ANTIKE
seit 1100 v. Chr. |
ARABISCHE
seit 0 |
ABENDLÄNDISCHE KULTUR
seit 900 |
||||||||||||||||||||
|
FRÜHLING: Landschaftlich-intuitiv. Mächtige
Schöpfungen einer erwachenden traumschweren Seele. Überpersönliche
Einheit und Fülle.
|
|||||||||||||||||||||||
|
1. Geburt eines Mythus großen Stils als Ausdruck
eines neuen Gottgefühls. Weltangst und Weltsehnsucht.
|
|||||||||||||||||||||||
|
1500–1200
Mythologie des Veda. |
1100–800
Olympischer Mythos. |
0–300
Urchristentum. |
900–1200
Germanischer Katholizismus (7 Sakramente) (Heiland). |
||||||||||||||||||||
|
|
Homer.
|
Orientalische Kulte der Kaiserzeit
(Isis, Mithras).
|
Marienkult. Gralsage (Parzeval)
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
Manichäismus.
|
Edda. Nibelungen (Baldr, Siegfried).
|
||||||||||||||||||||
|
Arische Heldensage.
|
Arische Hellenische.
|
Evangelien. Apokalypse; Legende.
|
Die abendländische Heiligenlegende.
|
||||||||||||||||||||
|
2. Früheste mystisch-metaphysische Gestaltung des
neuen Weltblickes.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Im Rigveda und den ältesten Teilen der andern Veden.
|
Unbekannt.
|
Plotin 204–269.
Origenes 185–254. |
Dante 1265–1321
Thomas v. Aquino 1224–1274. Eckart (1250–1329). |
||||||||||||||||||||
|
Nachwirkung in den Kosmogonien.
|
Neuplatoniker, Gnostiker, Kirchenväter.
|
Mystik und Scholastik.
|
|||||||||||||||||||||
|
SOMMER: Reifende Bewußtheit. Früheste
städtisch-bürgerliche und kritische Regungen.
|
|||||||||||||||||||||||
|
3. „Reformation“: Innerhalb der Religion
volksmäßige Auflehnung gegen die großen Formen der Frühzeit.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Bramanas.
Älteste Elemente der Upanishads. |
Dionysosreligion, Orphiker, antihomerische
Strömungen. 7. Jahrh.
|
Abfall der Monophysiten 449.
Bar Sudaili und die syrische Mystik um 500. |
Protestantismus.
Luther, Zwingli, Calvin um 1500. |
||||||||||||||||||||
|
SOMMER: Reifende Bewußtheit. Früheste
städtisch-bürgerliche und kritische Regungen.
|
|||||||||||||||||||||||
|
4. Beginn einer rein philosophischen Fassung des
Weltgefühls. Gegensatz idealistischer und realistischer Systeme.
|
|||||||||||||||||||||||
|
In den Upanishads enthalten.
|
Die großen Vorsokratiker 6./5. Jahrh.
|
Bisher unerforschte syrische, koptische, neupersische
Literatur des 6./7. Jahrh.
|
Galilei, Descartes, Bacon, Bruno, Boehme, Leibniz
16./17. Jahrh.
|
||||||||||||||||||||
|
5. Bildung einer neuen Mathematik. Konzeption der
Zahl als Abbild und Inbegriff der Weltform.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Verschollen.
|
Die Zahl als Maß (Größe).
(Geometrie, Arithmetik) Pythagoräer seit 540. |
Die unbestimmte Zahl.
(Algebra) Entwicklung unerforscht. |
Die Zahl als Funktion.
(Analysis) Descartes, Pascal, Fermat um 1630 Newton, Leibniz um 1670. |
||||||||||||||||||||
|
6. „Puritanismus“: Rationalistisch-mystische
Verarmung des Religiösen. Intellektueller Fanatismus.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Spuren in den Upanishads.
|
Pythagoräischer Bund seit 540.
|
Mohammed.
Hedschra 622. |
Puritaner in England seit 1620.
Jansenisten (Port Royal) in Frankreich seit 1640. |
||||||||||||||||||||
|
HERBST: Großstädtische Intelligenz. Höhepunkt
strenggeistiger Gestaltungskraft.
|
|||||||||||||||||||||||
|
7. „Aufklärung“: Glaube an die Allmacht des
Verstandes. Kultus der „Natur“. „Vernünftige Religion“.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Sutras; Sankhya.
Jüngere Elemente der Upanishads. |
Sophistik 5. Jahrh.
Sokrates 469–399. Demokrit 460–360. |
Mutaziliten 8. Jahrh.
Nazzam, Alkindi um 830. Alkabi um 900. |
Sensualisten (Locke, Shaftesbury).
17./18. Jahrh. Rousseau 1712–1778. Voltaire. Enzyklopädisten 18. Jahrh. |
||||||||||||||||||||
|
8. Höhepunkt des mathematischen Denkens. Abklärung
der Formenwelt der Zahlen.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Verschollen.
(Stellenwert, die Null als Zahl, Winkelfunktionen.) |
Archytas 430–365.
Plato 426–346. Eudoxos 408–355. (Kegelschnitte.) |
Noch unerforscht.
(Zahlentheorie, spärische Trigonometrie.) |
Euler 1707–1783.
Lagrange 1736–1813. Laplace 1749–1827. (Infinitesimalproblem.) |
||||||||||||||||||||
|
9. Die großen abschließenden Systeme.
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
WINTER: Anbruch der weltstädtischen Zivilisation.
Erlöschen der seelischen Gestaltungskraft. Das Leben selbst wird
problematisch. Ethisch-praktische Tendenzen eines irreligiösen und
unmetaphysischen Weltstädtertums.
|
|||||||||||||||||||||||
|
10. Materialistische Weltanschauung: Kultus der
praktischen Erfahrung des Nutzens, des Glückes.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Tscharvaka.
(Lokoyata.) |
Cyniker, Cyrenaiker.
Letzte Sophisten. Pyrrhon 325–275. |
Kommunist., atheist., epikur. Sekten der
Abbassidenzeit
9. Jahrh. Die „lauteren Brüder“ um 950. |
Bentham, Feuerbach, Stirner.
Comte, Spencer, Marx. Darwinisten. Materialisten. |
||||||||||||||||||||
|
11. Ethisch-gesellschaftliche Lebensideale:
Epoche der „Philosophie ohne Mathematik“.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Sekten der Buddhazeit.
|
Epikur 347–270.
Zenon 340–265. Alexandrinismus. |
Tendenzen im frühen Sufismus
Al Gunaid † 910. |
Schopenhauer, Nietzsche.
Sozialismus, Anarchismus. Hebbel, Wagner, Ibsen. |
||||||||||||||||||||
|
12. Innere Vollendung der mathematischen
Formenwelt. Die abschließenden Gedanken.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Verschollen.
|
Euklid, Apollonios
4./3. Jahrh. Eratosthenes, Archimedes 3. Jahrh. |
Alchwarizmi 800, Ibn Kurra 850.
Alkarchi, Albiruni 10. Jahrh. |
Gauß 1777–1855.
Cauchy 1789–1857. Riemann 1826–1866. |
||||||||||||||||||||
|
13. Sinken des abstrakten Denkertums zu einer
fachwissenschaftlichen Kathederphilosophie. Kompendienliteratur.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Die „sechs klassischen Systeme“.
|
Akademie; Peripatos. Stoa; Epikuräer.
|
Schulen von Bagdad und Basra.
|
Kantianer, Hegelianer. „Logiker“ und
„Psychologen“.
|
||||||||||||||||||||
|
14. Das Ende: Ausbreitung einer letzten
Weltstimmung.
|
|||||||||||||||||||||||
|
Der indische Buddhismus seit 500.
|
Der hellenistisch-römische Stoizismus seit 200.
|
Der praktische Fatalismus des Islam seit 1000.
|
Der ethische Sozialismus seit Ende des 19.
Jahrh. sich verbreitend.
|
||||||||||||||||||||
|
ÄGYPTISCHE
|
ANTIKE
|
ARABISCHE
|
ABENDLÄNDISCHE KULTUR
|
|
VORZEIT: Chaos urmenschlicher Kunstformen.
Mystische Liniensymbolik und Versuche naiver Imitation.
|
|||
|
THINITENZEIT.
3400–3000.
|
KRETISCH-MYKENISCHE ZEIT. 1600–1100.
(Ägyptischer Einfluß.) |
ALTSYRISCH-ARABISCHE KUNST. Vor 0.
(Antiker, babylon.-persischer Einfluß.) |
MEROWINGER-KAROLINGERZEIT 500–900.
(Maurisch-byzant. Einfluß.) |
|
„KULTUR“: Lebensgeschichte eines das gesamte
äußere Sein formenden Stils. Formensprache von tiefster symbolischer
Notwendigkeit.
|
|||
|
I. FRÜHZEIT: Ornament und
Architektur als elementarer Ausdruck des jungen Weltgefühls („Die
Primitiven“).
|
|||
|
DAS ALTE REICH
2950–2475. |
DORIK.
1100–650. |
ALCHRISTLICH-„SPÄTANTIKE“ KUNST.
0–500. |
GOTIK.
900–1500. |
|
1. Geburt und Aufschwung. Aus dem Geiste der
Landschaft erwachsende, nicht bewußt geschaffene Formen.
|
|||
|
4.–5. Dynastie 2930–2625.
Streng geometrischer Tempelstil. Flachrelief. Frontale Bildplastik. Pyramidentempel. Pflanzensäulen, Kolonnaden. Reliefzyklen. |
Nicht erhaltene Holzarchitektur (Antentempel).
Geometrischer (Dipylon-)stil 11./9. Jahrh. Die dorische Säule (Holz). Grabvasenmalerei. |
Basiliskenstil.
Sarkophag-(Tief-)relief. Katakombenmalerei. Kuppelbasilika („Moschee“). (Pantheon in Rom). Säulenbögen. Frontalbildnisse. |
Romanik und Frühgotik
Ornament und Dom Hochgotik; Gewölbte Dome. Kathedralplastik, Glasmalerei. |
|
2. Vollendung der frühen Formensprache.
Erschöpfung der Möglichkeiten und Widerspruch.
|
|||
|
6. Dynastie 2625–2475.
Erlöschen des Pyramidenstils und es episch-idyll. Reliefs. Blüte der archaischen Bildnisplastik. |
800–650.
Wenig bekannt. Protokorinth.-altattische Tonmalerei (Mythische Stoffe). |
4.–5. Jahrh.
Syrisch-byzantinische Kunst. Erlöschen des Relief- und Porträtstils. Blüte der Mosaikmalerei. Anfänge der Arabeske. (Tür von S. Ambrogio in Mailand 386). |
Spätgotik und Renaissance
14./15. Jahrh. Erlöschen der gotischen Skulptur (Nürnberg). Blüte und Ende von Fresko und Renaissanceplastik. Von Giotto und Donatello (Gotik) bis Michelangelo (Barock). Das gotische Tafelbild von Van Eick bis Holbein. Erfindung des Kontrapunkts und der Ölmalerei. |
|
II. SPÄTZEIT: Bildung einer
Gruppe städtisch-bewußter, gewählter, von Einzelnen getragener Künste
(„Die großen Meister“).
|
|||
|
DAS MITTLERE REICH
2200–1800. |
IONIK.
650–350. |
BYZANTINISCH-ISLAMISCHE KUNST.
500–800. |
BAROCK.
1500–1800. |
|
1. Ausbildung eines reifen Künstlertums.
|
|||
|
Infolge späterer Zerstörung wenig bekannte Epoche.
Die Architektur bleibt herrschend. |
Herrschaft der Freskomalerei von Butades bis Polygnot
650–400.
Die ionische Säule. Vollendung des Tempelbaus. Aufschwung der Rundplastik. („Apoll von Tenea“ bis Hageladas.) |
Herrschaft der Mosaikmalerei 6. Jahrh.
Vollendung des Moscheentypus (Zentralkuppelbau, Hagia Sophia 530). Die Arabeske (Fassade von M’schatta). |
Herrschaft der Ölmalerei von Tizian bis
Rembrandt († 1669).
Der malerische Baustil von Michelangelo bis Bernini († 1680). Aufschwung der Musik von Orlando Lasso bis Heinrich Schütz. († 1672): Zeit der Kantate. |
|
2. Äußere Vollendung einer durchgeistigten
Formensprache.
|
|||
|
12. Dynastie.
2000–1788 Pylonentempel. Historische Reliefs. Charakterbildnisse. |
Blüte von Athen.
480–330. Herschaft der Plastik von Myron bis Phidias 460–330. Ausgang der Fresko- und Tonmalerei. |
Maurische Kunst.
7./8. Jahrh. Vollkommene Herrschaft der Arabeske auch über die Architektur. |
Rokoko.
18. Jahrh. Herrschaft der Musik von Corelli (geb. 1653) und Bach (1685) bis Mozart: Zeit der Sonate. Der musikalische (Rokoko-)Baustil. Ausgang der Ölmalerei von Watteau bis Goya. |
|
3. Ermatten der Gestaltungskraft. Auflösung der
großen Form. Ende des Stils.
|
|||
|
Anfang der Hyksoszeit.
|
Die korinthische Säule (Genre).
Skopas und Praxiteles (Sentiment und Subjektivismus). Malerei des Apollodor und Apelles („Natur“). |
Abbassidenzeit.
|
Empirestil und Biedermeier.
Beethoven. Hogarth. Gainsburough. Delacroix. |
|
ZIVILISATION: Das Dasein ohne innere Form.
Weltstadtkunst als Luxus, Sport, Gewohnheit. Wechselnde Stilmoden
(Wiederbelebungen, Mischungen, Erfindungen) ohne symbolischen Gehalt.
|
|||
|
1. „Modernität“. Versuche, die Decadence
künstlerisch zu fassen. Verwandlung von Musik, Baukunst und Malerei in
bloßes Kunstgewerbe.
|
|||
|
Hyksoszeit 1788–1580.
Verfall der Reliefkomposition. Auflösung der plastischen Konvention Mehrschiffige Säulenhallen. |
Hellenismus 300–100.
Ende der strengen Plastik (Lysippos). Pergamenische Kunst (Theatralik). Hellenistische Malweisen (Enkaustik, Illustionsmalerei, Rhopographie). Das Idealorträt. |
Seldschuckenzeit nach 1000.
Stationäre „Kunst des Orients“. In Byzanz „Renaissance des Hellenismus“ (1000). |
19. und 20. Jahrh.
Ende der Musik: Berlioz, Liszt, Wagner. Episode des Impressionismus von Constable und Corot bis Manet und Leibl. Nazarener, Prärafaeliten. |
|
2. Ende des Formgefühls. Sinnlose, leere,
erkünstelte, gehäufte Ornamentik. Imitation alter und fremder Motive.
|
|||
|
18. Dynastie 1580–1350.
Verfall der Pflanzensäule. Naturalismus des Echnaton. Memnonskolosse Felsentempel der Hatschepsut. |
Römerzeit 100 v. bis 100 n. Chr.
Häufung der 3 Säulenordnungen. Zeit der Statuenkopisten. Römerplastik. Kaiserbauten im oriental. Geschmack. |
Mongolenzeit seit 1258.
Auflösung der maurischen Kunst in örtliche Nuancen. (Von Spanien bis Indien.) |
|
|
3. Ausgang. Barbarische Massenhaftigkeit;
Kolossalwirkungen. Verrohung der Technik. Übergewicht fremder
Kunstformen.
|
|||
|
19. Dynastie 1350–1205.
(Sethos I. und Ramses II.) Riesenhallen und Statuenalleen von Luxor, Karnak und Abydos. Plünderung alter Bauten. |
Späte Kaiserzeit
Riesenfora, Thermen, Triumphsäulen. Sieg der früharabischen Kunst im Westen. |
|
|
|
ÄGYPTISCHE
|
ANTIKE
|
ABENDLÄNDISCHE KULTUR
|
|
VORZEIT: Rein ethnographischer Völkertypus.
Stämme und Häuptlinge. Noch keine „Politik“. Kein „Staat“.
|
||
|
THINITENZEIT (MENES).
3400–3000.
|
SPÄTKRETISCH-MYKENISCHE ZEIT.
(„AGAMEMNON“). 1600–1200. |
FRANKENZEIT (KARL DER GROSSE).
500–900. |
|
VÖLKERNAMEN DIESER STUFE:
UNBEKANNT (DIE GAUVÖLKER). |
DANAER, ACHÄER, ETRUSKER.
|
FRANKEN, SACHSEN, LANGOBARDEN.
|
|
KULTUR: Völkergruppe von ausgeprägtem Stil und
einheitlichem Weltgefühl. Wirkung einer immanenten Staatsidee.
|
||
|
VÖLKER: ÄGYPTER.
|
DORIER, IONIER, LATINER.
|
DEUTSCHE, FRANZOSEN, ITALIENER, SPANIER,
ENGLÄNDER.
|
|
I. FRÜHZEIT: Organische Struktur
des politischen Daseins. Die beiden frühen Stände: Adel und
Priestertum.
|
||
|
DAS ALTE REICH.
2900–2400. |
DORISCHE ZEIT.
1100–650. |
GOTISCHE ZEIT.
900–1500. |
|
1. Patriarchalische Staatsbildungen. Geist des
bäuerlichen Landes. Die „Stadt“ nur Markt oder Burg. Wechselnde Pfalzen
der Herrscher. Lehnsadel. Ritterlich-religiöse Ideale. Kämpfe der
Vasallen untereinander und gegen den Fürsten.
|
||
|
Lehnsstaat der 4. Dynastie. Macht der Gaufürsten und
der Rê-Priesterschaft. Der Pharao als Inkarnation des Rê.
|
Homerische Zustände.
Historische Daten unbekannt. |
Deutsche Kaiserzeit. Kreuzzüge.
Kaisertum und Papsttum. |
|
2. Krisis und Auflösung der primitiven
politischen Daseinsformen.
|
||
|
6. Dynastie. Zerfall des Reiches in erbliche
Fürstentümer. Interregnum. Teilkönige.
|
Kaum bekannt.
Ursparta um 900. |
Verfall der Universalidee. Interregnum.
Macht der Vasallen (Deutsche Fürsten, Renaissancestaaten, Lancaster und York). |
|
II. SPÄTZEIT: Verwirklichung der
gereiften Staatsidee. Die Stadt gegen das Land: Entstehung des dritten
Standes (Bürgertum).
|
||
|
DAS MITTLERE REICH.
2200–1800. |
IONISCHE ZEIT.
650–350. |
BAROCKZEIT.
1500–1800. |
|
3. Bildung einer Staatenwelt von strenger Form.
|
||
|
Der zentralisierte Beamtenstaat.
11. Dynastie (2160–2000): Sturz der Feudalfürsten druch die Herrscher von Theben. |
Der Stadtstaat.
Zeit der Tyrannis (650–500). Kleisthenes, Periander, Polykrates. |
Die dynastische Hausmacht. Ständestaat.
Zeit der Fronde (1550–1650). Richelieu, Wallenstein, Cromwell. |
|
4. Höchste Vollendung der Staatsform
(„Absolutismus“). Einheit von Stadt und Land („Staat und Gesellschaft“,
die „Drei Stände“).
|
||
|
12. Dynastie (2000–1788): Strengste Zentralgewalt.
Mediatisation der Feudalherren. Hofadel und Beamtenschaft.
Erbfolgerevolten. Amenemhat, Sesostris. |
Um 450: Absolutismus des Demos von Athen.
Politik der Agora. Themistokles, Perikles. |
Um 1700: Absolutismus der regierenden Häuser
(Versailles). Hofadel. Kabinettspolitik und Erbfolgekriege.
Ludwig XIV. Friedrich II. |
|
5. Sprengung der Staatsform (Revolution und
Napoleonismus). Sieg der Stadt über das Land (des „Volkes“ über die
„Privilegierten“, der Intelligenz über die Tradition).
|
||
|
1788–1680 Revolutionen und Militärregiment.
Teilkönige, zum Teil aus dem Volke stammend.
|
380–350 Soziale Revolutionen (Athen, Argos).
Die „zweite Tyrannis“. (Dionys v. Syrakus, Jason v. Pherä.) Pilipp und Alexander. |
Ende des 18. Jahrh.: Revolutionen in Frankreich,
Amerika, Genf usw.
Napoleon. |
|
ZIVILISATION: Auflösung der jetzt wesentlich
städtisch orientierten Volkskörper zu internationalen, praktisch
interessierten Massen. Weltstadt und Provinz: Der vierte Stand („Masse“),
anorganisch, kosmopolitisch.
|
||
|
1. Stadium: Das Geld. Wirtschaftskomplexe die
Staatsform aufsaugend.
|
||
|
Hyksoszeit 1788–1580.
Fremdherrschaft der Eroberer. |
Hellenismus 300–100.
Diadochenreiche von Alexander bis Scipio 300–200. Die soziale Monarchie. Die politische Monarachie der Römer von Scipio bis Marius 200–100. |
„Europäische Zivilisation“ 1800–2000.
System der Großmächte von Napoleon bis zum Weltkrieg. Nationalismus, Parlamentarismus 1800–1900. Sozialismus und Imperialismus 1900–2000. |
|
2. Stadium: „Cäsarismus“. Wachsender Naturalismus
der politischen Form. Zerfall der Volksorganismen in amorphe
Menschenmassen; deren Resorption in ein Imperium von allmählich wieder
primitiv-despotischem Charakter.
|
||
|
18. Dynastie 1580–1350.
Thutmosis III. |
Von Sulla bis Domitian 100 v. bis 100 n. Chr.
Cäsar, Tiberius. |
2000–2200.
|
|
3. Stadium: „Ägyptizismus“, „Mandarinentum“,
„Byzantinismus“. Erstarren und Zerfall auch des imperialen Mechanismus:
die Beute junger Völker oder fremder Eroberer. Langsames Heraufdringen
urmenschlicher Zustände (Septimius Severus als „Häuptling“).
|
||
|
19. Dynastie 1350–1205.
Sethos I., Ramses II., Echnaton. |
Von Trajan bis Aurelian 100–300.
Trajan. Mark Aurel. |
Nach 2200.
|
[S. 75]
[S. 77]
Es ist zunächst notwendig, einige hier in einem strengen und teilweise neuen Sinne gebrauchte Grundbegriffe zu bestimmen, deren metaphysischer Gehalt sich im Laufe der Darstellung von selbst ergeben wird, die aber schon am Anfang unzweideutig erklärt sein müssen.
Der volkstümliche, auch der Philosophie geläufige Unterschied von Sein und Werden erscheint ungeeignet, das Wesentliche des mit ihm bezweckten Gegensatzes wirklich zu treffen. Ein unendliches Werden — Wirken, „Wirklichkeit“ — wird man immer, wofür etwa die physikalischen Begriffe der gleichförmigen Geschwindigkeit und des Bewegungszustandes oder die Grundvorstellung der kinetischen Gastheorie als Beispiele dienen können, auch als Zustand auffassen und also dem Sein zuordnen dürfen. Dagegen lassen sich — mit Goethe — als letzte Elemente des in und mit dem Bewußtsein schlechthin Gegebenen das Werden und das Gewordne unterscheiden. Jedenfalls ist, wenn man an der Möglichkeit zweifelt, durch abstrakte Begriffsbildungen den letzten Gründen des Menschlichen nahe zu kommen, das sehr klare und bestimmte Gefühl, aus welchem dieser fundamentale, die äußersten Grenzen des Bewußtseins berührende Gegensatz hervorgeht, das ursprünglichste Etwas, bis zu dem sich überhaupt gelangen läßt.
Es folgt daraus mit Notwendigkeit, daß immer ein Werden dem Gewordnen zugrunde liegt — a priori im Sinne Kants —, nicht umgekehrt.
Ich unterscheide ferner mit den Bezeichnungen „das Eigne“ und „das Fremde“ zwei Urtatsachen des Bewußtseins, deren Sinn für jeden wachen Menschen — also nicht für den Träumenden — mit unmittelbarer innerer Gewißheit feststeht, ohne durch eine Definition näher bestimmt werden zu können. Zu der[S. 78] durch das Wort Sinnlichkeit (Außenwelt, Empfindungsleben) bezeichneten ursprünglichen Tatsache steht das Element des Fremden immer auf irgendeine Weise in Beziehung. Die philosophische Gestaltungskraft großer Denker hat durch halbanschauliche schematische Konzeptionen wie Erscheinung und Ding an sich, Welt als Wille und Vorstellung, Ich und Nicht-Ich diese Beziehung immer wieder schärfer zu fassen versucht, obwohl diese Absicht sicherlich die Möglichkeiten exakter menschlicher Erkenntnis überschreitet. Ebenso birgt sich in der als Ich (Innenleben, Person) bezeichneten ursprünglichen Tatsache das Element des Eignen in einer Weise, deren strenge Fassung den Methoden des abstrakten Denkens ebenfalls entzogen bleibt.
Ich bezeichne weiterhin mit den Worten Seele und Welt denjenigen Gegensatz, dessen Vorhandensein mit der Tatsache des wachen, rein menschlichen Bewußtseins selbst identisch ist. Es gibt Grade der Klarheit und Schärfe dieses Gegensatzes, Grade der Bewußtheit — Geistigkeit — des Lebens also, von dem sich noch kaum in Pole sondernden mythischen Dämmern der primitiven Menschen und des Kindes — hierher gehören die in Spätzeiten immer seltener werdenden Augenblicke der religiösen und künstlerischen Inspiration — bis zur äußersten Schärfe des Wachseins etwa in den Zuständen des kantischen und des napoleonischen Denkens. Diese elementare Struktur des Bewußtseins ist als eine Tatsache von unmittelbarer innerer Gewißheit der begrifflichen Zergliederung nicht weiter zugänglich, und ebenso gewiß ist es, daß jene beiden nur sprachlich und gewissermaßen künstlich abteilbaren Momente stets miteinander und durcheinander da sind und durchaus als Einheit, als Totalität hervortreten, ohne daß das erkenntniskritische Vorurteil des geborenen Idealisten und Realisten, wonach entweder die Seele der Welt oder die Welt der Seele als das Primäre — sie sagen „als Ursache“ — zugrunde liegt, in der reinen Tatsache des Bewußtseins irgendwie begründet wäre. Ob in einem philosophischen System der Akzent auf dem einen oder andern liegt, ist lediglich ein Kennzeichen der Persönlichkeit und von rein biographischer Bedeutung.
Gibt man den Begriffen des Werdens und des Gewordnen eine Anwendung auf diese polare Struktur des Bewußtseins, so[S. 79] erhält das Wort Leben einen ganz bestimmten, dem des Werdens nahe verwandten Sinn. Man darf Werden und Gewordnes als die Tatsache und den Gegenstand des Lebens bezeichnen. Das eigne, fortschreitende, ständig sich erfüllende Leben ist in jedem seiner Augenblicke mit dem eignen, wachen Bewußtsein identisch[25] — diese Tatsache heißt Gegenwart — und beide besitzen wie alles Werden das geheimnisvolle Merkmal der Richtung, ein unaussprechliches Gefühl (Lebensgefühl), das der Mensch in allen höhern Sprachen durch das Wort Zeit und die daran sich knüpfenden Probleme geistig zu bannen und — vergeblich — zu deuten versucht hat. Es folgt daraus eine tiefe Beziehung des Gewordnen (Starren) zum Tode.
Nennt man die Seele — und zwar unter Betonung des Unbewußten vor dem Bewußten — das Mögliche, die Welt dagegen das Wirkliche, Ausdrücke, über deren Bedeutung ein inneres Gefühl keinen Zweifel läßt, so erscheint das Leben als die Gestalt, in welcher sich die Verwirklichung des Möglichen vollzieht. Im Hinblick auf das Merkmal der Richtung heißt das Mögliche Zukunft, das Verwirklichte Vergangenheit. Die Verwirklichung selbst, die Mitte und den Sinn des Lebens, nennen wir Gegenwart. „Seele“ ist das zu Vollendende, „Welt“ das Vollendete, „Leben“ die Vollendung. Die Ausdrücke Augenblick, Dauer, Entwicklung, Lebensinhalt, Lebensaufgabe, Bestimmung, Umfang, Ziel, Ende, Fülle und Leere des Lebens erhalten damit eine bestimmte, für alles Folgende, namentlich für das Verständnis historischer Phänomene wesentliche Bedeutung.
Endlich sollen die Worte Geschichte und Natur, wie schon erwähnt, in einem ganz bestimmten, bisher nicht üblichen Sinne angewandt werden. Es sind darunter mögliche Arten zu verstehen, die Gesamtheit des Bewußten, Werden und Gewordnes, Leben und Erlebtes, in einem einheitlichen, durchgeistigten, wohlgeordneten Weltbilde (Kosmos, Universum, All) aufzufassen, je nachdem das Werden oder das Gewordne, Richtung oder Ausdehnung („Zeit“ oder „Raum“) den unteilbaren Eindruck gestaltend beherrschen. Es handelt sich hier[S. 80] nicht um eine Alternative, sondern um eine Skala von unendlich vielen und sehr verschiedenartigen Möglichkeiten, eine „Außenwelt“ als Abglanz und Zeugnis des eignen Daseins zu besitzen, eine Skala, deren Extreme eine rein organische und eine rein mechanische Weltanschauung (im wörtlichen Sinne: Anschauung der Welt) sind. Der Urmensch (so wie wir sein Bewußtsein uns vorstellen) und das Kind (wie wir uns erinnern) besitzen noch keine dieser Möglichkeiten mit hinreichender Klarheit der struktiven Durchbildung. Als Bedingung dieses höheren Weltbewußtseins hat man den Besitz der Sprache anzusehen, und zwar nicht den einer menschlichen Sprache überhaupt, sondern den einer Kultursprache, die für den ersten noch nicht vorhanden und für das andere, obwohl vorhanden, noch nicht zugänglich ist. Beide besitzen, um dasselbe mit andern Worten zu sagen, noch kein klares und deutliches Weltdenken, zwar eine Ahnung, aber noch kein wirkliches Wissen von Geschichte und Natur, in deren Zusammenhang ihr eigenes Dasein eingegliedert erscheint: Sie haben keine Kultur.
Damit erhält dies wichtige Wort einen bestimmten, höchst bedeutsamen Sinn, der in allem Folgenden vorausgesetzt wird. Ich unterscheide im Hinblick auf die oben gewählten Bezeichnungen der Seele als des Möglichen und der Welt als des Wirklichen mögliche und wirkliche Kultur, das heißt Kultur als Idee des — allgemeinen oder einzelnen — Daseins und Kultur als Körper dieser Idee, als die Summe ihres versinnlichten, räumlich und faßlich gewordenen Ausdrucks: Taten und Gesinnungen. Religion und Staat, Künste und Wissenschaften, Völker und Städte, wirtschaftliche und gesellschaftliche Formen, Sprachen, Rechte, Sitten, Charaktere, Gesichtszüge und Trachten. Geschichte ist, mit dem Leben, dem Werden eng verwandt, die Verwirklichung möglicher Kultur.
Es muß hinzugefügt werden, daß diese grundlegenden Bestimmungen zum großen Teil nicht mehr im Bereiche der Mitteilbarkeit durch Begriff, Definition und Beweis liegen, daß sie vielmehr ihrer tiefsten Bedeutung nach gefühlt, erlebt, erschaut werden müssen. Es besteht ein selten gewürdigter Unterschied[S. 81] zwischen Erleben und Erkennen als den Formen der Beziehung zwischen Eignem und Fremdem („Subjekt und Objekt“). Er wird deutlich in dem Unterschiede zwischen der unmittelbaren Gewißheit, wie sie die Arten der Intuition (Erleuchtung, Eingebung, künstlerisches Schauen, Goethes „exakte sinnliche Phantasie“) gewähren und den Resultaten der verstandesmäßigen Erfahrung und experimentellen Technik. Der Mitteilung dienen dort der Vergleich, das Bild, das Symbol, hier die Formel, das Gesetz, das Schema. Gewordnes wird erkannt oder vielmehr, wie sich zeigen wird, das Gewordensein für den menschlichen Geist ist mit dem vollzogenen Erkenntnisakt identisch. Ein Werden kann nur erlebt, mit tiefem, wortlosem Verstehen gefühlt werden. Hierauf beruht das, was man Menschenkenntnis nennt. Geschichte verstehen heißt Menschenkenner im höchsten Sinne sein. Je reiner ein Geschichtsbild, desto ausschließlicher ist es diesem nicht eigentlich irdischen Blick zugänglich, der mit den Erkenntnismitteln, welche die „Kritik der reinen Vernunft“ untersucht, nichts zu schaffen hat. Der Mechanismus eines reinen Naturbildes, etwa der Welt Newtons und Kants, wird erkannt, begriffen, zergliedert, in Gesetze und Gleichungen, zuletzt in ein System gebracht. Der Organismus eines reinen Geschichtsbildes, wie es die Welt Plotins, Dantes und Brunos war, wird angeschaut, innerlich erlebt, als Gestalt und Sinnbild aufgefaßt, zuletzt in dichterischen und künstlerischen Konzeptionen wiedergegeben. — Goethes „lebendige Natur“ ist ein historisches Weltbild.
Erleben und Erkennen sind Bewußtseinsakte einzelner Menschen. Ihr Resultat, nunmehr ein Stück Vergangenheit, Gedächtnis, Wissen, heißt ein Erlebnis oder eine Erkenntnis. Etwas verstehen — historisch oder natürlich — heißt es in die schon vorhandene Summe von Erlebnissen oder Erkenntnissen harmonisch einordnen können.
Ich wähle als Beispiel für die Art, wie eine Seele sich im Bilde ihrer Umwelt zu verwirklichen sucht, inwiefern also gewordne Kultur Ausdruck und Abbild einer Idee menschlichen[S. 82] Daseins ist, die Zahl, die aller Mathematik als schlechthin gegebenes Element zugrunde liegt. Und zwar deshalb, weil die Mathematik, in ihrer ganzen Tiefe den wenigsten erreichbar, einen einzigartigen Rang unter allen Schöpfungen des Geistes behauptet. Sie ist eine Wissenschaft strengsten Stils wie die Logik, aber umfassender und bei weitem gehaltvoller; sie ist eine echte Kunst neben der Plastik und Musik, was die Notwendigkeit einer leitenden Inspiration und die großen formalen Konventionen in ihrer Entwicklung angeht; sie ist endlich eine Metaphysik vom höchsten Range, wie Plato und vor allem Leibniz beweisen. Jede Philosophie ist bisher in der Verbundenheit mit einer zugehörigen Mathematik erwachsen. Die Zahl ist die bildgewordene Idee der kausalen Notwendigkeit, wie die Vorstellung von Gott, die jede Kultur aus ihrer tiefsten Tiefe neu gestaltet, die bildgewordene Idee der Notwendigkeit des Schicksals ist. In diesem Sinne darf man das Dasein von Zahlen ein Mysterium nennen, und das religiöse Denken aller Kulturen hat sich diesem Eindruck nie entzogen.
Wie alles Werden das ursprüngliche Merkmal der Richtung (Nichtumkehrbarkeit), so trägt alles Gewordne das Merkmal der Ausdehnung und zwar so, daß nur eine künstliche Trennung der Bedeutung dieser Worte möglich erscheint. Das eigentliche Geheimnis alles Gewordnen und also (räumlich-stofflich) Ausgedehnten aber verkörpert sich im Geistigen jeder Kultur im Typus der mathematischen (starren) im Gegensatz zur chronologischen Zahl. Und zwar liegt in ihrem Wesen die Absicht einer mechanischen Grenzsetzung. Die Zahl ist darin dem Worte verwandt, das — als Begriff, „begreifend“, „bezeichnend“ — ebenfalls Welteindrücke abgrenzt. Das Tiefste ist hier allerdings unfaßlich und unaussprechlich. Die wirkliche, zum Ding gewordene Zahl, das exakt vorgestellte, gesprochene, geschriebene Zahlzeichen — Ziffer, Formel, Zeichen, Figur —, das allein der mathematischen Behandlung unterliegt, ist wie das gedachte, gesprochene, geschriebene Wort bereits ein optisches Symbol dafür, versinnlicht und mitteilbar, in welchem die Grenzsetzung abgebildet erscheint. Der Ursprung der Zahlen gleicht dem Ursprung des Mythus. Der[S. 83] Römer erhob die numina, unbestimmbare Natureindrücke („das Fremde“) zu Gottheiten, indem er sie durch einen Namen, sie begrenzend, bannte. Ebenso sind Zahlen und Worte gestaltetes, in Form gebanntes Weltgefühl. Mit ihnen gelangt der Geist („das Eigne“) zur Macht. Mit ihnen ordnet und zergliedert er die Welt. Alle echten Erkenntnisakte — nicht Erlebnisakte — als solche an das Vorhandensein einer Kultursprache gebunden, bezwecken das gleiche. Die Definition, das Urteil, das Gesetz, das System sind Resultate vollzogener Grenzsetzungen und die Feststellung eines Kausalverhältnisses, in der sich das Wesen aller Naturwissenschaft erschöpft, besteht lediglich in der präzisen Abgrenzung zweier Eindrücke, die im Hinblick auf die Zahl Ursache und Wirkung, im Hinblick auf das Wort Grund und Folge heißen. Hierauf beruht die innere Verwandtschaft des Baues einer hochentwickelten Sprache (Grammatik, Satzbau) mit der zugehörigen Mathematik. Die Logik ist immer eine Art Mathematik und umgekehrt. Mithin liegt auch in allen Bewußtseinsakten, welche zur mathematischen Zahl in Beziehung stehen — messen, zählen, zeichnen, wägen, ordnen, teilen —, die gemeinsame Tendenz auf Abgrenzung von Gewordnem und Ausgedehntem und erst durch kaum noch bewußte Akte dieser Art gibt es für den wachen Menschen objektive Gegenstände, Eigenschaften, Beziehungen, Einzelnes, Einheit und Mehrheit, kurz die als notwendig und unerschütterlich empfundene Struktur desjenigen Weltbildes, das er „Natur“ nennt und als solche „erkennt“. Natur ist das Zählbare. Geschichte ist der Inbegriff dessen, was zur Mathematik kein Verhältnis hat. Daher die mathematische Gewißheit der Naturgesetze, die staunende Einsicht Galileis, daß die Natur „scritta in lingua matematica“ sei und die von Kant hervorgehobene Tatsache, daß die exakte Naturwissenschaft genau so weit reicht wie die Möglichkeit der Anwendung mathematischer Methoden.
In der Zahl als dem Zeichen der vollendeten extensiven Begrenzung liegt demnach, wie Pythagoras infolge einer großartigen, durchaus religiösen Intuition mit innerster Gewißheit begriff, das Wesen alles Wirklichen, das geworden,[S. 84] erkannt, begrenzt zugleich ist. Indes darf man Mathematik, wenn man darunter den Besitz einer eingebornen virtuellen Zahlenwelt versteht, nicht mit der viel engeren wissenschaftlichen Mathematik, der Lehre von den Zahlen verwechseln. Das eine ist eine erschöpfende und notwendige Eigenschaft des Bewußtseins, das andere eine mögliche Art, sie geistig zu entwickeln. Die geschriebene Mathematik, ein System starrer Sätze, repräsentiert so wenig wie die in theoretischen Werken niedergelegte Philosophie den ganzen Besitz dessen, was im Schoße einer Kultur an mathematischen und philosophischen Möglichkeiten vorhanden war. Es gibt noch ganz andere Wege, das den Zahlen zugrunde liegende Urgefühl zu versinnlichen, das Gewordne und Ausgedehnte, sei es Stoff oder Raum, einem gestaltenden Prinzip zu unterwerfen. Am Anfang jeder Kultur steht ein archaischer Stil, den man nicht nur in der frühhellenischen Kunst hätte geometrisch nennen können. Es liegt etwas Gemeinsames, ausdrücklich Mathematisches im Dipylonstil der altgriechischen Grabvasen, im Tempelstil der 4. Dynastie Ägyptens mit seiner unbedingten Herrschaft der geraden Linie und des rechten Winkels, im hieratischen Stil der altchristlichen Sarkophagreliefs und im romanischen Ornament. Jede Linie, jede menschliche oder Tierfigur mit ihrer gar nicht imitativen Tendenz offenbart hier ein mystisches Zahlendenken in unmittelbarer Beziehung auf das Geheimnis und den Kult des Todes (des Starren).
Gotische Dome und dorische Tempel sind steingewordne Mathematik. Gewiß hat Pythagoras die antike Zahl als das Prinzip einer Weltordnung greifbarer Dinge, als Maß oder Größe, wissenschaftlich erfaßt. Aber sie wurde eben damals, ebenfalls als schöne Ordnung von sinnlich-körperhaften Einheiten, durch den strengen Kanon der hellenischen Statue und der dorischen wie ionischen Säulenordnung zum Ausdruck gebracht. Alle großen Künste sind ebensoviel Arten zahlenmäßiger bedeutungsvoller Grenzgebung. Man denke an das Raumproblem in der Malerei. Eine hohe mathematische Begabung kann auch ohne jede Wissenschaft produktiv sein und zum vollen Bewußtsein ihrer selbst gelangen. Man wird doch angesichts des gewaltigen Zahlensinnes, den die Raumgliederung der Pyramidentempel,[S. 85] die Bau-, Bewässerungs- und Verwaltungstechnik, vom ägyptischen Kalender ganz zu schweigen, schon im Alten Reiche um 2800 v. Chr. voraussetzt, nicht behaupten wollen, daß das wertlose „Rechenbuch des Ahmes“ aus dem Neuen Reiche das Niveau der ägyptischen Mathematik bezeichne. Die Eingebornen Australiens, deren Geist durchaus der Stufe des Urmenschen angehört, besitzen einen mathematischen Instinkt oder, was dasselbe ist, einen noch nicht durch Worte und Zeichen bewußt gewordnen Schatz an Zahlen, der in bezug auf die Interpretation reiner Räumlichkeit den griechischen bei weitem übertrifft. Sie haben als Waffe den Bumerang erfunden, dessen Wirkung auf eine gefühlsmäßige Vertrautheit mit Zahlenarten schließen läßt, die wir der höheren geometrischen Analysis zuweisen würden. Sie besitzen dementsprechend — aus einem später zu erläuternden Zusammenhange — ein äußerst kompliziertes Zeremoniell und eine so feine sprachliche Abstufung der Verwandtschaftsgrade, wie sie nirgends, selbst in hohen Kulturen nicht, wieder beobachtet worden ist. Dem entspricht es, daß die Griechen in ihrer reifsten Zeit unter Perikles in Analogie zur euklidischen Mathematik weder einen Sinn für das Zeremoniell des öffentlichen Lebens noch für die Einsamkeit besaßen, sehr im Gegensatz zum Barock, das neben der Analysis des Raumes den Hof des Sonnenkönigs und ein auf dynastischen Verwandtschaften beruhendes Staatensystem entstehen sah.
Es ist der Stil einer Seele, der in einer Zahlenwelt, aber nicht in ihrer wissenschaftlichen Fassung allein zum Ausdruck kommt.
Daraus folgt ein entscheidender Umstand, der den Mathematikern selbst bisher verborgen geblieben ist.
Eine Zahl an sich gibt es nicht und kann es nicht geben. Es gibt mehrere Zahlenwelten, weil es mehrere Kulturen gibt. Wir finden einen indischen, arabischen, antiken, abendländischen Zahlentypus, jeder von Grund aus etwas Eignes und Einziges, jeder Ausdruck eines andern Weltgefühls, jeder Symbol von einer auch wissenschaftlich genau begrenzten Gültigkeit, Prinzip einer Ordnung des Gewordnen, in der sich das[S. 86] tiefste Wesen einer einzigen und keiner andern Seele spiegelt, derjenigen, welche Mittelpunkt gerade dieser und keiner andern Kultur ist. Es gibt demnach mehr als eine Mathematik. Denn ohne Zweifel ist das architektonische System der euklidischen Geometrie ein ganz andres als das der kartesischen, die Analysis von Archimedes eine andre als die von Gauß, nicht nur der Formensprache, der Absicht und den Mitteln nach, sondern vor allem in der Tiefe, im ursprünglichen Phänomen der Zahl, dessen wissenschaftliche Entwicklung sie darstellt. Diese im Geiste und durch den Geist empfangene Zahl, das Grenzerlebnis, das in ihr mit innerster Notwendigkeit versinnlicht und Form geworden ist, mithin auch die gesamte Natur, die ausgedehnte Welt, deren Bild durch diese spontane Grenzgebung entstand und die immer nur der Behandlung durch eine einzige Art von Mathematik zugänglich ist, das alles spricht nicht vom allgemeinen, sondern jedesmal von einem ganz bestimmten Menschentum.
Es hängt also für den Stil einer entstehenden Mathematik alles davon ab, in welcher Kultur sie wurzelt, was für Menschen über sie nachdenken. Denn die Zahl geht dem Geiste vorauf, nicht umgekehrt. Zahlen sind schöpferische, nicht geschaffene Wesenheiten. Der Geist kann die in ihnen verborgnen formalen Möglichkeiten zur wissenschaftlichen Entfaltung bringen, sie handhaben, an ihrer Behandlung zur höchsten Reife gelangen; sie zu modifizieren ist er völlig außerstande. In den frühesten Formen des Ornaments und der Architektur, schon in der dorischen Säule und der Kathedralgotik ist die Idee der euklidischen Geometrie und der Infinitesimalrechnung verwirklicht, Jahrhunderte bevor der erste Mathematiker dieser Kulturen geboren wurde.
Ein tiefes inneres Erlebnis, das eigentliche Erwachen des Ich, welches das Kind zum höhern Menschen, zum Gliede der ihm angehörigen Kultur macht, bezeichnet den Beginn des Zahlen- wie des Sprachverständnisses. Erst von hier an gibt es für das Bewußtsein Gegenstände als etwas in jedem Betrachte Begrenztes und Wohlunterschiedenes, erst von hier an genau bestimmbare Eigenschaften, Begriffe, eine kausale Notwendigkeit, ein System der Umwelt, eine Weltform, Weltgesetze[S. 87] — das „Gesetzte“ ist seiner Natur nach immer das Begrenzte, Starre, den Zahlen Unterworfene — und ein plötzliches Gefühl dafür, was Zahlen, sei es in Gestalt einer bildenden Kunst oder einer mathematischen Wissenschaft, bedeuten. Man begreift, daß sie dem Urmenschen wie dem Kinde noch verschlossen sind und daß eine entscheidende — historische oder biographische — Epoche eintritt, sobald der in seiner Bedeutung erfaßte Akt des Zählens, Messens, Zeichnens, Formens eine ganz neue Welt aus einem neu erschlossenen Innenleben hervorgehen läßt. Dies Erlebnis aber, mit dem der große Stil beginnt, trennt Kulturen, Arten der Seele als Individuen aus dem primitiv Menschlichen ab.
Nun hat Kant den Besitz menschlichen Wissens nach Synthesen a priori (notwendig und allgemeingültig) und a posteriori (aus Erfahrung stammend) eingeteilt und die mathematische Erkenntnis den ersteren zugerechnet. Zweifellos hat er damit ein starkes inneres Gefühl in eine abstrakte Fassung gebracht. Aber ganz abgesehen davon, daß eine scharfe Grenze zwischen beiden, wie sie nach der ganzen Herkunft des Prinzips unbedingt gefordert werden müßte, nicht vorhanden ist (wofür die moderne höhere Mathematik und Mechanik mehr als hinreichend Beispiele gibt), erscheint auch das a priori, sicherlich eine der genialsten Konzeptionen aller Erkenntniskritik, als ein höchst schwieriger Begriff. Kant setzt mit ihm, ohne sich die Mühe eines Beweises zu geben — der sich auch gar nicht erbringen läßt —, sowohl die Unveränderlichkeit der Form aller Geistestätigkeit als ihre Identität für alle Menschen voraus. Infolgedessen ist ein Umstand von gar nicht zu überschätzender Tragweite völlig übersehen worden, vor allem deshalb, weil Kant bei der Prüfung seiner Gedanken nur das geistige Material und den intellektuellen Habitus seiner Zeit zu Rate zog. Er betrifft den schwankenden Grad dieser „Allgemeingültigkeit“. Neben gewissen Faktoren von zweifellos weitreichender Geltung, die wenigstens scheinbar unabhängig davon sind, zu welcher Kultur, in welches Jahrhundert der Erkennende gehört, liegt allem Denken auch noch eine ganz andere Notwendigkeit der Form zugrunde, welcher der Mensch eben als Glied einer bestimmten und keiner anderen[S. 88] Kultur unterworfen ist. Das sind nun zwei sehr verschiedene Arten des apriorischen Gehaltes und es ist eine nie zu beantwortende, weil jenseits aller Erkenntnismöglichkeiten liegende Frage, welches die Grenze zwischen ihnen ist und ob es eine solche überhaupt gibt. Daß die bisher als selbstverständlich geltende Konstanz der geistigen Formen eine Illusion ist, daß es innerhalb der uns vorliegenden Geschichte mehr als einen Stil des Erkennens gibt, hat man bisher nicht anzunehmen gewagt. Aber es sei daran erinnert, daß der consensus omnium nicht nur eine allgemeine Wahrheit, sondern auch einen allgemeinen Irrtum beweisen kann. Ein dunkler Zweifel war allenfalls immer da und man hätte das Richtige schon aus der Nichtübereinstimmung sämtlicher Denker erschließen sollen. Aber daß diese nicht auf eine Unvollkommenheit des menschlichen Geistes, auf ein „Noch nicht“ einer endgültigen Erkenntnis zurückgeht, kein Mangel, sondern eine schicksalhafte historische Notwendigkeit ist — das ist eine Entdeckung. Das Tiefste und Letzte kann nicht aus der Konstanz, sondern allein aus der Verschiedenheit und nur aus der organischen Periodizität dieser Verschiedenheit erschlossen werden. Die vergleichende Morphologie der Erkenntnisformen ist eine Aufgabe, die dem abendländischen Denken noch vorbehalten ist.
Wäre Mathematik eine bloße Wissenschaft wie die Astronomie oder Mineralogie, so würde man ihren Gegenstand definieren können. Man kann es nicht und hat es nicht gekonnt. Mögen wir Westeuropäer auch den eignen wissenschaftlichen Zahlbegriff gewaltsam auf das anwenden, was die Mathematiker in Athen und Bagdad beschäftigte, so viel ist sicher, daß Thema, Absicht und Methode der gleichnamigen Wissenschaft dort ganz andre waren. Es gibt keine Mathematik, es gibt nur Mathematiken. Was wir Geschichte „der“ Mathematik nennen, vermeintlich die fortschreitende Verifikation eines einzigen und unveränderlichen Ideals, ist in der Tat, sobald man das täuschende Bild der historischen Oberfläche beseitigt, eine Mehrzahl in sich geschlossener, unabhängiger[S. 89] Prozesse, eine wiederholte Geburt neuer, ein Aneignen, Umbilden und Abstreifen fremder Formenwelten, ein rein organisches, an eine bestimmte Dauer gebundenes Aufblühen, Reifen, Welken und Sterben. Man lasse sich nicht täuschen. Der ahistorische griechische Geist schuf seine Mathematik aus dem Nichts; der historisch angelegte Geist des Abendlandes, der die angelernte antike Wissenschaft schon besaß — äußerlich, nicht innerlich —, mußte die eigne durch ein scheinbares Ändern und Verbessern, durch ein tatsächliches Vernichten der ihm inadäquaten euklidischen gewinnen. Das eine geschah durch Pythagoras, das andere durch Descartes. Beide Akte sind in der Tiefe identisch.
Die Verwandtschaft der Formensprache einer Mathematik mit der der benachbarten großen Künste wird demnach keinem Zweifel unterliegen. Das Ziel jeder Mathematik ist ein in sich vollendetes System von Sätzen, das die synthetische Ordnung a priori des starren Ausgedehnten repräsentiert, dieselbe unablässig erstrebte Synthese, welche auch im Formproblem, jeder bildenden Kunst und in dem Ringen jedes einzelnen Künstlers um die technische Meisterschaft auf seinem Gebiete zutage tritt. Das Formgefühl des Bildhauers, Malers, Tondichters ist ein wesentlich mathematisches. In der geometrischen Analysis und der projektiven Geometrie des 17. Jahrhunderts offenbart sich dieselbe Ordnung, welche die gleichzeitige Instrumentalmusik fugierten Stils durch die Regeln des Kontrapunktes, dieser Geometrie des Tonraumes, welche die ihr verschwisterte Ölmalerei durch das Prinzip einer nur dem Abendlande bekannten Perspektive, der gefühlten Geometrie des Bildraumes, ins Leben rufen, ergreifen, durchdringen möchte. Sie ist das, was Goethe die Idee nannte, deren Gestalt im Sinnlichen unmittelbar angeschaut werde, während die bloße Wissenschaft nicht anschaue, sondern nur beobachte und zergliedere. Aber die Mathematik geht über Beobachten und Zergliedern hinaus. Sie verfährt in ihren höchsten Augenblicken intuitiv, nicht abstrahierend. Von Goethe stammt das tiefe Wort, daß der Mathematiker nur insofern vollkommen sei, als er das Schöne des Wahren in sich empfinde. Hier wird man fühlen, wie nahe das Geheimnis im Phänomen[S. 90] der Zahl dem Geheimnis der Kunstform liegt, die ebenfalls in einer bedeutsamen Grenzgebung, im schönen Maß, in der abgewogenen Größe, der strengen Beziehung, der Harmonie, kurz in einer vollkommenen Ordnung von Sinnlichem ihr Ziel findet. Damit tritt der geborene Mathematiker neben die großen Meister der Fuge, des Meißels und des Pinsels, die ebenfalls jene große Ordnung aller Dinge, die der bloße Mitmensch ihrer Kultur in sich trägt, ohne sie wirklich zu besitzen, in Symbole kleiden, verwirklichen, mitteilen wollen. Damit wird das Reich der Zahlen zum intuitiven Abbild der Weltform neben dem Reich der Töne, Linien und Farben. Deshalb bedeutet das Wort „schöpferisch“ im Mathematischen mehr als in den bloßen Wissenschaften. Newton, Gauß, Riemann waren künstlerische Naturen. Man lese nach, wie ihre großen Konzeptionen sie plötzlich überfielen. „Ein Mathematiker,“ meinte der alte Weierstraß, „der nicht zugleich ein Stück von einem Poeten ist, wird niemals ein vollkommener Mathematiker sein.“
Mathematik ist also auch eine Kunst. Sie hat ihre Stile und Stilperioden. Sie ist nicht, wie der Laie meint — auch der Philosoph, insofern er hier als Laie urteilt —, der Substanz nach unveränderlich, sondern wie jede Kunst von Epoche zu Epoche unvermerkten Wandlungen unterworfen. Man sollte die Entwicklung der großen Künste nie behandeln, ohne auf die gleichzeitige Mathematik einen gewiß nicht unfruchtbaren Seitenblick zu werfen. Einzelheiten in den sehr tiefen Beziehungen zwischen den Tendenzen der Musiktheorie von Orlando Lasso an und den Entwicklungsphasen der Funktionentheorie sind niemals untersucht worden, obwohl die Ästhetik mehr daraus hätte lernen können als aus aller „Psychologie“. Alle ganz großen Mathematiker seit Fermat, Pascal und Descartes (1630) sind transzendente Analytiker, alle antiken von Pythagoras an (540) anschaulich-körperhaft denkende Naturen gewesen. Soll ich noch einmal auf die enge Verwandtschaft dieser Begabungen mit der anbrechenden Blütezeit dort der reinen Instrumentalmusik, hier der ionischen Marmorskulptur hinweisen? Die antike Mathematik, ursprünglich beinahe rein planimetrisch, zeigt in der Entwicklung[S. 91] von Pythagoras zu Archimedes eine Tendenz zum stereometrischen Denken alles Zahlenmäßigen. Dem entspricht die Tendenz der Flächenmalerei attisch-korinthischen Stils über das der Fläche aufgesetzte Relief hinaus zur Rundplastik. Die Statue ging teils aus der figürlich — reliefmäßig — behandelten Säule (Hera des Cheramyes), teils aus der zur Wandverkleidung dienenden Holz- oder Erztafel (Artemis der Nikandre) hervor. Sowohl das Holz wie der Poros wurden mit dem Schnitzmesser bearbeitet und erst die Behandlung des Marmors mit dem Meißel entsprach ganz dem künstlerischen Gefühl der Schöpfung eines Körpers. Aber das Entsprechende geschieht im Abendlande. Während die auch weiterhin so genannte Geometrie sich zur Analysis des reinen Raumes umbildet, aus der Schritt für Schritt das unmittelbar Optische beseitigt wird — man beachte, wie weit schon der Koordinatenbegriff von Descartes über den von Fermat hinausgeht —, gewinnt die Instrumentalmusik ihre neuen Ausdrucksmittel. Seit 1520 beginnt die in Oberitalien erfundene Geige die Laute zu verdrängen. Das Fagott ist seit 1525 bekannt. In Deutschland hat sich während des 16. und 17. Jahrhunderts die Orgel zum raumbeherrschenden Instrument entwickelt. Monteverdi (1567–1643), der mit der Einführung des Dominantseptakkordes die eigentliche Chromatik begründet, besaß das erste wirkliche Orchester und um 1630 erscheint mit Frescobaldi der erste große Orgelvirtuose. Und neben der analysis situs, dieser Meisterschöpfung von Leibniz, steht die mächtige Raumsymbolik der letzten Werke Rembrandts, der 1669 starb — die des Selbstbildnisses in München, des Darmstädter Christus und des Evangelisten Matthäus.
Sicherlich unterscheidet auch dies das Formwollen jeder Mathematik von den rein wissenschaftlichen Absichten aller Physik und Chemie und rückt sie in die Nähe der bildenden Künste, daß ihr Element, die starren Zahlen, seien sie nun optisch oder transzendent aufgefaßt, keine empirischen Wirklichkeiten sind, sondern reine Formen des Ausgedehnten wie ornamentale Linien und musikalische Harmonien, ihr Verfahren also, mit Kant zu reden, synthetisch, künstlerisch gesprochen Komposition ist, in welcher der echte Künstler einem höheren[S. 92] Zwange — dem „a priori“ Kants — unterliegt. Das mag in den populären Teilen einer Mathematik weniger hervortreten, aber die Zahlengebilde höherer Ordnung, zu denen jede von ihnen und im Unterschiede von jeder andern alsbald aufsteigt, wie das indische Dezimalsystem, die antiken Gruppen der Kegelschnitte, der Primzahlen und der regelmäßigen Polyeder, im Abendlande der Zahlkörper, die mehrdimensionalen Räume, die höchst transzendenten Gebilde der Transformations- und Mengenlehre, die Gruppe der nichteuklidischen Geometrien, sind nicht mehr von rein verstandesmäßiger Herkunft und setzen, um in ihren letzten, völlig metaphysischen Gründen durchschaut zu werden, eine Art visionärer Erleuchtung voraus. Hier handelt es sich um ein inneres Erlebnis, nicht nur um Erkenntnis. Erst hier beginnt die große Symbolik der Zahlen. Diese Formen, wie sie im Geiste großer Meister im Namen ihrer Kultur, als Ausdruck der letzten Geheimnisse ihres Weltgefühls entstehen, offenbaren dem Eingeweihten etwas wie den Urgrund seines Daseins. Diese Schöpfungen muß man wie das Innere eines Domes, wie die Verse der Engel im Faustprolog oder eine Kantate von Bach auf sich wirken lassen, wozu es glücklicher und seltener Stunden bedarf. Nur wer dies vermag, und es wird immer nur eine sehr kleine Zahl reifer Geister sein, begreift Plato, wenn er die ewigen Ideen seines Kosmos „die Zahlen“ nannte.
Als man im Kreise der Pythagoräer um 540 zu der Einsicht kam, daß das Wesen aller Dinge die Zahl sei, da wurde nicht „in der Entwicklung der Mathematik ein Schritt vorwärts getan“, sondern es wurde eine ganz neue Mathematik aus der Tiefe des antiken Seelentums geboren, als selbstbewußte Theorie, nachdem sie in metaphysischen Problemen und künstlerischen Formtendenzen sich längst angekündigt hatte. Eine neue Mathematik, wie die stets ungeschrieben gebliebene der ägyptischen und wie die algebraisch-astronomisch gestaltete der babylonischen Kultur mit ihren ekliptischen Koordinatensystemen, die beide in einer großen Stunde der Geschichte einmal geboren worden und damals längst erloschen waren. Die zur Römerzeit[S. 93] schon greisenhafte antike Mathematik verschwand aus dem lebendigen Werden trotz ihres noch heute währenden Scheindaseins in unsrer Bezeichnungsweise, um viel später und in einer entfernten Landschaft der arabischen Platz zu machen; auf diese längst erstorbene folgte nach langer Zwischenzeit, wieder als eine ganz neue Schöpfung eines neuen Bodens, die abendländische, unsere Mathematik, die wir in seltsamer Verblendung als die Mathematik, den Gipfel und das Ziel einer zweitausendjährigen Entwicklung ansehen und deren heute fast abgelaufene Jahrhunderte ebenso streng bemessen sind.
Jener Ausspruch, daß die Zahl das Wesen aller sinnlich greifbaren Dinge darstelle, ist der wertvollste der antiken Mathematik geblieben. Mit ihm ist die Zahl als Maß definiert. Darin liegt das ganze Weltgefühl einer dem Jetzt und Hier leidenschaftlich zugewendeten Seele. Messen in diesem Sinne heißt etwas Nahes und Körperhaftes messen. Denken wir an den Inbegriff des antiken Kunstwerkes, die freistehende Bildsäule eines nackten Menschen: Hier ist alles Wesentliche und Bedeutsame des Daseins, sein ganzes Ethos, erschöpfend durch Flächen, Maße und die sinnlichen Verhältnisse der Teile gegeben. Der pythagoräische Begriff der Harmonie der Zahlen, obwohl vielleicht aus der — monophonen — Musik abgeleitet, scheint durchaus für das Ideal dieser Plastik geprägt zu sein. Der behandelte Stein ist nur insofern ein Etwas, als er abgewogene Grenzen und gemessene Form besitzt, als das, was er unter dem Meißel des Künstlers geworden ist. Abgesehen davon ist er ein Chaos, etwas noch nicht Verwirklichtes, vorläufig also ein Nichts. Dies Gefühl, ins Große übertragen, schafft als Gegensatz zum Chaos den Kosmos, die Außenwelt der antiken Seele, die harmonische Ordnung aller wohlbegrenzten und greifbar gegenwärtigen Einzeldinge. Die Summe dieser Dinge ist bereits die ganze Welt. Der Abstand zwischen ihnen, unser mit dem ganzen Pathos eines großen Symbols erfüllter Weltraum, ist nichts, τὸ μὴ ὄν. Ausdehnung heißt für den antiken Menschen Körperlichkeit, für uns Raum, als dessen Funktion die Dinge „erscheinen“. Von hier aus rückwärts blickend enträtseln wir vielleicht den tiefsten Begriff der antiken Metaphysik, das ἄπειρον Anaximanders, das sich in keine Sprache[S. 94] des Abendlandes übersetzen läßt: es ist das, was keine „Zahl“ im pythagoräischen Sinne besitzt, keine gemessene Größe und Grenze, kein Wesen also; das Maßlose, die Unform, eine Statue, die noch nicht aus dem Blocke herausgemeißelt ist. Dies ist die ἀρχή, das optisch Grenzen- und Formlose, das erst durch Grenzen, sinnliche Vereinzelung ein Etwas, die Welt nämlich, wird. Es ist das, was der antiken Erkenntnis als Form a priori zugrunde liegt, Körperlichkeit an sich, und an dessen Stelle im kantischen Weltbilde genau entsprechend der absolute Raum erscheint, aus dem Kant sich angeblich „alle Dinge fortdenken konnte“.
Man wird jetzt begreifen, was eine Mathematik von der andern, was insbesondere die antike von der abendländischen scheidet. Das reife antike Denken konnte seinem ganzen Weltgefühl nach in der Mathematik nur die Lehre von den Größen-, Maß- und Gestaltverhältnissen leibhafter Körper sehen. Wenn Pythagoras aus diesem Gefühl heraus die entscheidende Formel aussprach, so war eben für ihn die Zahl ein optisches Symbol, nicht Form überhaupt oder abstrakte Beziehung, sondern das Grenzzeichen des Gewordnen, insofern dieses in sinnlich übersehbaren Einzelheiten auftritt. Zahlen werden von der gesamten Antike ohne Ausnahme, als Maßeinheiten, als Größen, Strecken, Flächen aufgefaßt. Eine andre Art Ausdehnung ist ihr nicht vorstellbar. Alle antike Mathematik ist im letzten Grunde Stereometrie. Euklid, der im 3. Jahrhundert ihr System abschloß, meint, wenn er von einem Dreieck spricht, mit innerster Notwendigkeit die Grenzfläche eines Körpers, niemals ein System dreier sich schneidender Geraden oder eine Gruppe dreier Punkte im Raume von drei Dimensionen. Er bezeichnet die Linie als „Länge ohne Breite“ (μῆκος ἀπλατές). In unserm Munde wäre diese Definition kläglich gewesen. Innerhalb der antiken Mathematik ist sie ausgezeichnet.
Auch die abendländische Zahl ist nicht, wie Kant und selbst Helmholtz dachten, aus der „apriorischen Anschauungsform der Zeit“ entwickelt, sondern als Ordnung gleichartiger Einheiten etwas spezifisch Räumliches. Die Zeit hat, wie sich immer deutlicher zeigen wird, mit mathematischen Dingen nicht das Geringste zu tun. Zahlen gehören ausschließlich in die Sphäre des Ausgedehnten. Aber es gibt so viele Möglichkeiten und[S. 95] also Notwendigkeiten, Ausgedehntes geordnet vorzustellen, als es Kulturen gibt. Die antike Zahl ist nicht ein Denken räumlicher Beziehungen, sondern für das leibliche Auge abgegrenzter, greifbarer Einheiten. Die Antike kennt deshalb — das folgt mit Notwendigkeit — nur die „natürlichen“ (positiven ganzen) Zahlen, die unter den vielen, höchst abstrakten Zahlenarten der abendländischen Mathematik, den komplexen, hyperkomplexen, nichtarchimedischen u. a. Systemen eine durch nichts ausgezeichnete Rolle spielen.
Deshalb ist die Vorstellung irrationaler Zahlen, in unsrer Schreibweise also unendlicher Dezimalbrüche, dem griechischen. Geiste unvollziehbar geblieben. Euklid sagt — und man hätte ihn besser verstehen sollen —, daß inkommensurable Strecken sich „nicht wie Zahlen“ verhalten. In der Tat liegt im vollzogenen Begriff der irrationalen Zahl die völlige Trennung des Zahlbegriffs vom Begriff der Größe und zwar deshalb, weil eine solche Zahl, π z. B., niemals abgegrenzt oder exakt durch eine Strecke dargestellt werden kann. Daraus folgt aber, daß in der Vorstellung z. B. des Verhältnisses der Quadratseite zur Diagonale die antike Zahl, die eben sinnliche Grenze, abgeschlossene Größe und nichts andres ist, eine ganz andre Zahlidee berührt, die dem antiken Weltgefühl im tiefsten Innern fremd und darum unheimlich ist, als sei man nahe daran, ein gefährliches Geheimnis des eignen Daseins aufzudecken. Dies verrät ein seltsamer spätgriechischer Mythus, wonach derjenige, welcher zuerst die Betrachtung des Irrationalen aus dem Verborgnen an die Öffentlichkeit brachte, durch einen Schiffbruch umgekommen sei, „weil das Unaussprechliche und Bildlose immer verborgen bleiben solle“. Wer die Angst fühlt, welche diesem Mythus zugrunde liegt — es ist dieselbe, welche den Griechen der reifsten Zeit vor der Ausdehnung seiner winzigen Stadtstaaten zu politisch organisierten Landschaften, vor der Anlage weiter Straßenfluchten und Alleen mit Fernblicken und berechneten Abschlüssen, vor der babylonischen Astronomie mit ihrer Durchdringung endloser Sternenräume und vor dem Verlassen des Mittelmeeres auf Bahnen, welche die Schiffe der Ägypter und Phöniker längst erschlossen hatten, immer wieder zurückschrecken ließ, die tiefe metaphysische Angst vor der[S. 96] Auflösung des Greifbar-Sinnlichen und Gegenwärtigen, mit dem sich das antike Dasein wie mit einer Schutzmauer umgeben hatte, hinter der etwas Unheimliches, ein Abgrund und Urgrund dieses gewissermaßen künstlich geschaffenen und behaupteten Kosmos schlief —, wer dies Gefühl begreift, der hat auch den letzten Sinn der antiken Zahl, des Maßes im Gegensatz zum Unermeßlichen und das hohe religiöse Ethos in ihrer Beschränkung begriffen. Goethe, als Künstler, hat es sich wenigstens in seinen Naturstudien mit Leidenschaft zu eigen gemacht — daher seine fast ängstliche Polemik gegen die Mathematik, die sich in Wirklichkeit, was noch niemand recht verstanden hat, instinktiv durchaus gegen die nichtantike Mathematik, die der Naturlehre seiner Zeit zugrunde liegende Infinitesimalrechnung richtete.
Die antike Religiosität sammelt sich mit steigender Ausdrücklichkeit in
sinnlich gegenwärtigen — ortsgebundenen — Kulten, die allein
jenes bildhafte, immernahe Göttertum repräsentieren. Abstrakte, in den
heimatlosen Räumen des Denkens verschwebende Dogmen sind ihm
immer fern geblieben. Kult und Dogma verhalten sich wie die Statue zur
Orgel im Dom. Es haftet der euklidischen Mathematik zweifellos etwas
Kultisches an. Man denke an die Lehre von den regelmäßigen Polyedern
und ihre Bedeutung für die Esoterik des platonischen Kreises. Dem
entspricht andrerseits eine tiefe Verwandtschaft der Analysis des
Unendlichen von Descartes an mit der gleichzeitigen Dogmatik in ihrem
Fortschreiten zu einem reinen, von allen sinnlichen Bezügen gelösten
Deismus. Voltaire, Lagrange und d’Alembert sind Zeitgenossen. Man
empfand aus dem antiken Seelentum heraus das Prinzip des Irrationalen,
also die Zerstörung der statuarischen Reihe der ganzen Zahlen, der
Repräsentanten einer in sich vollkommenen Weltordnung, als einen Frevel
gegen das Göttliche selbst. Bei Plato, im Timäus, ist dies Gefühl
unverkennbar. Mit der Verwandlung der diskontinuierlichen Zahlenreihe
in ein Kontinuum wird in der Tat nicht nur der antike Zahlbegriff,
sondern der Begriff der antiken Welt selbst in Frage gestellt. Man
begreift nun, daß nicht einmal die uns ohne Schwierigkeit vorstellbaren
negativen Zahlen, geschweige denn die Null als Zahl —
welche für die indische[S. 97] Seele, die sie zuerst konzipiert hat, einen
ganz entscheidenden metaphysischen Akzent besitzt — in der antiken
Mathematik möglich sind. Negative Größen gibt es nicht. Der
Ausdruck −2 . −3 = +6 ist weder anschaulich noch eine Größenvorstellung.
Mit +1 ist die Größenreihe zu Ende. In der graphischen Darstellung
negativer Zahlen 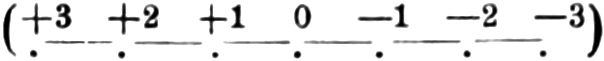 werden von Null an die Strecken plötzlich positive Symbole von
etwas Negativem. Sie bedeuten etwas, sie sind nichts
mehr. Negative Zahlen sind nicht Größen, sondern etwas, das durch
Größen nur angedeutet werden kann. Die Vollziehung dieses Aktes lag
aber nicht in der Richtung des antiken Zahlendenkens.
werden von Null an die Strecken plötzlich positive Symbole von
etwas Negativem. Sie bedeuten etwas, sie sind nichts
mehr. Negative Zahlen sind nicht Größen, sondern etwas, das durch
Größen nur angedeutet werden kann. Die Vollziehung dieses Aktes lag
aber nicht in der Richtung des antiken Zahlendenkens.
Alles aus antikem Geist Geborene ist also allein durch plastische Begrenztheit zum Range eines Wirklichen erhoben worden. Was sich nicht zeichnen läßt, ist nicht „Zahl“. Plato, Archytas und Eudoxos reden von Flächen- und Körperzahlen, wenn sie unsere zweiten und dritten Potenzen meinen, und es versteht sich von selbst, daß der Begriff höherer ganzzahliger Potenzen für sie nicht vorhanden ist. Eine Potenz vierten Grades würde aus dem plastischen Grundgefühl, das sofort eine vierdimensionale Ausgedehntheit substituiert, Unsinn sein. Ein Ausdruck gar wie e-ix, der in unsern Formeln ständig erscheint, oder auch nur die schon im 14. Jahrhundert von Oresme verwandte Bezeichnung 5½ wären ihnen völlig absurd erschienen. Euklid nennt die Faktoren eines Produkts Seiten (πλευραί). Man rechnet mit Brüchen — endlichen, wie sich versteht —, indem man das ganzzahlige Verhältnis zweier Strecken untersucht. Eben deshalb kann die Idee der Zahl Null gar nicht in Erscheinung treten, denn sie hat zeichnerisch keinen Sinn. Man wende nicht von der Gewöhnung unseres anders angelegten Denkens her ein, daß dies eben die „Urstufe“ in der Entwicklung „der“ Mathematik sei. Die antike Mathematik ist innerhalb der Welt, welche die antike Welt um sich herum schuf, etwas Vollkommenes. Sie ist es nur nicht für uns. Die babylonische und die indische Mathematik hatten das für das antike Zahlengefühl Unsinnige längst zu wesentlichen Bestandteilen ihrer Zahlenwelten gemacht, und mancher griechische Denker wußte darum. Die Mathematik, es sei noch einmal gesagt, ist[S. 98] eine Illusion. Wirklich ist, was dem eignen Seelentum adäquat und symbolisch bedeutend ist. Dies allein ist „denknotwendig“, das andre ist unmöglich, verfehlt, unsinnig, oder, wie wir mit dem Hochmut historischer Geister zu sagen vorziehen, „primitiv“. Die moderne Mathematik, ein Meisterstück des abendländischen Geistes — „wahr“ allerdings nur für ihn —, wäre Plato als lächerliche und mühselige Verirrung auf dem Wege erschienen, der wahren Mathematik, der antiken natürlich, beizukommen; und wir machen uns sicherlich kaum eine Vorstellung davon, was alles an großen Konzeptionen fremder Kulturen wir haben untergehen lassen, weil wir es aus unserem Denken und dessen Grenzen heraus nicht assimilieren konnten oder, was dasselbe ist, weil wir es als falsch, überflüssig und sinnlos empfanden.
Die antike Mathematik als Lehre von anschaulichen Größen will ausschließlich die Tatsachen des Gegenwärtigen deuten, und sie beschränkt also ihre Forschung wie ihren Geltungsbereich auf Gegenstände der Nähe und des Kleinen. Dieser Konsequenz gegenüber ergibt sich etwas sehr Unlogisches im praktischen Verhalten der abendländischen Mathematik, was eigentlich erst seit Entdeckung der nichteuklidischen Geometrien recht erkannt worden ist. Zahlen sind reine Formen des erkennenden Geistes. Ihre exakte Anwendbarkeit auf die reale Anschauung ist also ein Problem für sich. Die Kongruenz mathematischer Systeme mit der Empirie ist nichts weniger als selbstverständlich. Trotz des Laienvorurteils von der unmittelbaren mathematischen Evidenz der Anschauung, wie es sich bei Schopenhauer findet, stimmt die euklidische Geometrie, welche mit der populären Geometrie aller Zeiten eine oberflächliche Identität besitzt, nur in sehr engen Grenzen („auf dem Papier“) mit der Anschauung annähernd überein. Wie es bei großen Entfernungen steht, lehrt die einfache Tatsache, daß Parallelen sich am Horizont berühren. Die gesamte malerische Perspektive beruht auf ihr. Trotzdem ging Kant, der für einen abendländischen Denker in unverzeihlicher Weise vor der „Mathematik der Fernen“ auswich und sich stets, ganz „antik“, auf winzige Figuren berief, an denen gerade ihrer[S. 99] Kleinheit wegen das spezifisch abendländische, das infinitesimale Raumproblem gar nicht in Erscheinung treten konnte, von einer naiven Größenvergleichung aus. Euklid vermied es ebenfalls, aber für einen antiken Denker mit Recht, sich für die anschauliche Gewißheit seiner Axiome etwa auf ein Dreieck zu berufen, dessen Punkte durch den Standort des Beobachters und zwei Fixsterne gebildet werden, das also weder gezeichnet noch „angeschaut“ werden kann. Es war hier dasselbe Gefühl wirksam, das vor dem Irrationalen zurückschreckte und das Nichts nicht als Null, als Zahl, zu begreifen wagte, das also auch im Anschauen kosmischer Verhältnisse dem Unermeßlichen aus dem Wege ging, um das Symbol des Maßes zu bewahren.
Aristarch von Samos, der um 270 das Weltsystem entwarf, welches bei seiner Wiederentdeckung durch Kopernikus die metaphysische Leidenschaft des Abendlandes im tiefsten erregte — man denke an Giordano Bruno —, das eine Erfüllung gewaltiger Ahnungen und eine Bestätigung jenes faustischen, gotischen Weltgefühls war, das schon in der Architektur seiner Kathedralen der Idee des unendlichen Raumes ein Opfer dargebracht hatte, wurde mit seinem Gedanken von der Antike völlig gleichgültig aufgenommen und bald — man möchte sagen absichtlich — vergessen. In der Tat ist das aristarchische Weltsystem für diese Kultur seelisch belanglos. Es wäre ihrer Grundidee sogar gefährlich geworden. Und doch war es im Unterschiede von dem des Kopernikus — diese entscheidende Tatsache ist immer unbeachtet geblieben — durch eine besondere Fassung dem antiken Weltgefühl genau angepaßt. Aristarch nahm als Abschluß des Kosmos eine körperlich durchaus begrenzte, optisch zu beherrschende Hohlkugel an, in deren Mitte das kopernikanisch gedachte Planetensystem sich befindet. Damit war das Prinzip des Unendlichen, das den sinnlich-antiken Grenzbegriff gefährdet hätte, überwunden. Kein Gedanke an einen grenzenlosen Weltraum taucht auf, der hier schon unvermeidlich erscheint und dessen Konzeption dem babylonischen Denken längst gelungen war. Im Gegenteil. Archimedes beweist in seiner berühmten Schrift von der „Sandzahl“ — wie schon das Wort verrät, der Widerlegung aller infinitesimalen Tendenzen, obwohl sie immer wieder als erster Schritt[S. 100] auf dem Wege zum modernen Integrationskalkül betrachtet wird —, daß dieser stereometrische Körper, denn etwas anderes ist der aristarchische Kosmos nicht, mit Atomen (Sand) erfüllt, zu sehr großen, aber nicht zu unendlichen Resultaten führe. Das heißt aber gerade alles, was uns die Analysis bedeutet, verneinen. Das Weltall unsrer Physik ist, wie die immer wieder scheiternden und sich dem Geiste von neuem aufdrängenden Hypothesen über den stofflich, d. h. mittelbar anschaulich gedachten Weltäther beweisen, die strengste Verleugnung aller materiellen Begrenztheit. Plato, Apollonius und Archimedes, sicherlich die feinsten und kühnsten Mathematiker der Antike, haben eine rein optische Analysis des Gewordnen auf der Grundlage des plastisch-antiken Grenzwertes vollkommen durchgeführt. Sie gebrauchen tiefdurchdachte und uns schwer zugängliche Methoden einer Integralrechnung, die selbst mit der Methode des bestimmten Integrals von Leibniz nur scheinbare Ähnlichkeit besitzt, und sie wenden geometrische Örter und Koordinaten an, die durchaus benannte Maßzahlen und Strecken und nicht wie bei Fermat und vor allem bei Descartes unbenannte räumliche Beziehungen, Werte von Punkten in bezug auf ihre Lage im Raum sind. Hierher gehört vor allem die Exhaustionsmethode des Archimedes in seiner kürzlich entdeckten Schrift an Eratosthenes, wo er z. B. die Quadratur des Parabelsegments auf der Berechnung eingeschriebener Rechtecke (nicht mehr ähnlicher Polygone) begründet. Aber gerade die geistreiche, unendlich verwickelte Art, wie er in Anlehnung an gewisse geometrische Ideen Platos zum Resultat kommt, macht den ungeheuren Gegensatz zwischen dieser Intuition und der oberflächlich ähnlichen Pascals etwa fühlbar. Es gibt keinen schärferen Gegensatz hierzu — wenn man vom Riemannschen Integralbegriff ganz absieht — als die leider heute noch sogenannten Quadraturen, bei denen die „Fläche“ als durch eine Funktion begrenzt bezeichnet wird und von einer zeichnerischen Handhabe keine Rede mehr ist. Nirgends kommen beide Mathematiken einander so nahe und nirgends läßt sich die unüberschreitbare Kluft zweier Seelen, deren Ausdruck sie sind, gewisser fühlen.
Die reinen Zahlen, deren Phänomen die Ägypter im Stil ihrer Tempelhallen, Pyramiden und Statuenreihen mit einer[S. 101] tiefen Furcht vor ihrem Ursprung gleichsam verbargen, waren auch für die Hellenen der Schlüssel zum Sinn des Gewordenen, Starren und also Vergänglichen. Die mathematische Zahl als formales Grundprinzip der ausgedehnten Welt, die nur aus dem wachen menschlichen Bewußtsein und für dieses da ist, steht durch das Medium der kausalen Notwendigkeit zum Tode in Beziehung, wie die chronologische Zahl zum Werden, zum Leben, zur Notwendigkeit des Schicksals. Dieser Zusammenhang der mathematischen Form mit dem Ende des organischen Seins, mit der Erscheinung seines anorganischen Restes, des Leichnams, wird sich immer deutlicher als der Ursprung aller großen Kunst enthüllen. Wir bemerkten schon die Entwicklung der frühen Ornamentik aus dem Bestattungskult. Zahlen sind Symbole des Vergänglichen. Starre Formen verneinen das Leben. Formeln und Gesetze breiten Starrheit über das Bild der Natur. Zahlen töten. Es sind die Mütter Fausts, die hehr in Einsamkeit thronen, „in der Gebilde losgebundne Reiche
Hier berühren sich Goethe und Plato im Ahnen eines letzten Geheimnisses. Die Mütter, das Unzugängliche — Platos Ideen — bezeichnen die Möglichkeiten eines Seelentums, seine ungeborenen Formen, welche sich in der sichtbaren, aus der Idee dieses Seelentums heraus mit innerster Notwendigkeit geordneten Welt als tätige und geschaffene Kultur, als Kunst, Gedanke, Staat, Religion verwirklicht haben. Hierauf beruht die Verwandtschaft des Zahlensystems einer Kultur mit deren Weltidee, eine Beziehung, die es über das bloße Wissen und Erkennen zur Bedeutung einer Weltanschauung erhebt und die bewirkt, daß es so viele Mathematiken — Zahlenwelten — gibt als es hohe Kulturen gibt. So allein wird es begreiflich und notwendig, daß die größten mathematischen Denker, bildende Künstler im Reiche der Zahlen, aus tief religiöser Intuition zur Auffindung der entscheidenden mathematischen Probleme ihrer Kultur gelangt sind. So hat man sich die Schöpfung der antiken, apollinischen Zahl durch Pythagoras, den Stifter einer Religion, zu denken. Dies Urgefühl hat Nicolaus Cusanus, den[S. 102] großen Bischof von Brixen, geleitet, als er um 1450 von der Betrachtung der Unendlichkeit Gottes in der Natur ausgehend die Grundzüge der Infinitesimalrechnung fand. Leibniz, der ihre Idee zwei Jahrhunderte später vollendete, hat selbst aus rein metaphysischen Betrachtungen über das göttliche Prinzip und seine Beziehung zum unendlichen Ausgedehnten die analysis situs entwickelt, vielleicht die genialste Interpretation des reinen, von allem Sinnlichen befreiten Raumes, deren reiche Möglichkeiten erst im 19. Jahrhundert durch Graßmann in seiner Ausdehnungslehre und Riemann in seiner Symbolik der zweiseitigen Flächen, welche die Natur von Gleichungen repräsentieren, entfaltet worden sind. Descartes, ein tiefer Christ aus dem Kreise von Port Royal, hat, einem innern Bedürfnis folgend, anläßlich seiner philosophisch-mathematischen Unterweisung die Pfalzgräfin Elisabeth und Gustav Adolfs Tochter, Königin Christine von Schweden, wieder zum Katholizismus bekehrt. Und Kepler wie Newton, beide streng religiöse Naturen, blieben sich, wie Plato, durchaus bewußt, gerade durch das Medium der Zahlen das Wesen einer göttlichen Weltordnung intuitiv erfaßt zu haben.
Erst Diophant hat, wie man immer hört, die antike Arithmetik aus ihrer sinnlichen Gebundenheit befreit, sie erweitert und fortgeführt und die Algebra als die Lehre von den unbestimmten Größen geschaffen. Das ist allerdings nicht eine Bereicherung, sondern eine vollkommene Überwindung des antiken Weltgefühls, und allein dies hätte beweisen sollen, daß Diophant der antiken Kultur innerlich nicht mehr angehörte. Ein neues Zahlengefühl oder sagen wir Grenzgefühl dem Wirklichen, Gewordnen gegenüber ist in ihm tätig, nicht mehr jenes hellenische, aus dessen sinnlich-gegenwärtigen Grenzwerten sich neben der euklidischen Geometrie der greifbaren Körper auch die sie nachbildende Plastik der nackten Statue entwickelt hatte. Einzelheiten der Ausbildung dieser neuen Mathematik kennen wir nicht. Bei Diophant taucht unter der Absicht euklidischer Gedankengänge jenes neue Grenzgefühl auf — ich nenne es das magische —, das sich seiner Gegensätzlichkeit zu der[S. 103] angestrebten antiken Fassung gar nicht bewußt ist. Die Idee der Zahl als Größe wird nicht erweitert, sondern unvermerkt aufgelöst. Was eine unbestimmte Zahl a und was eine unbenannte Zahl 3 ist — beides weder Größe noch Maß noch Strecke — hätte ein Grieche gar nicht angeben können. Das neue, in diesen Zahlenarten inkarnierte Grenzgefühl liegt den diophantischen Betrachtungen wenigstens zugrunde; die uns geläufige Buchstabenrechnung selbst, in deren Gewande sich die inzwischen nochmals ganz umgedeutete Algebra heute darstellt, ist erst in fühlbarer, aber unbewußter Opposition gegen die antikisierende Renaissancerechnung 1591 durch Vieta eingeführt worden.
Diophant lebte um 250 n. Chr., also im dritten Jahrhundert der arabischen Kultur, deren geschichtlicher Organismus bisher unter den Oberflächenformen der römischen Kaiserzeit und des „Mittelalters“ verschüttet lag[26] und der alles angehört, was seit Beginn unserer Zeitrechnung in der Landschaft des kommenden Islam entstanden ist. Gerade damals erblich vor dem neuen Raumgefühl der Basiliken, Mosaiken und Sarkophagreliefs altchristlich-syrischen Stils der letzte Schatten der attischen Statuenplastik. Damals gab es wieder eine archaische Kunst und ein streng geometrisches Ornament. Damals gerade vollendete Diokletian den Khalifat des nur noch scheinbar römischen Reiches. 500 Jahre liegen zwischen Euklid und Diophant, zwischen Plato und Plotin, dem letzten, abschließenden Denker — dem Kant — einer vollendeten und dem ersten mystischen Geiste — dem Dante — einer eben erwachten Kultur.
Hier berühren wir zum ersten Male das bisher unbekannte Phänomen jener großen Individuen, deren Werden, Wachsen und Welken unter einer tausendfarbigen verwirrenden Oberfläche die eigentliche Substanz der Weltgeschichte bildet. Das im römischen Geiste dahinschwindende antike Seelentum, dessen „Leib“ die historische Wirklichkeit der antiken Kultur mit ihren Werken, Gedanken, Taten und Trümmern ist, war um 1100 v. Chr. aus der Landschaft des ägäischen Meeres geboren[S. 104] worden. Die seit Augustus im Osten unter der Decke antiker Zivilisation keimende arabische Kultur entstammt durchaus dem Schoße der Landschaft zwischen Nil und Euphrat, Kairo und Bagdad. Als Ausdruck dieser neuen Seele hat man fast die gesamte „spätantike“ Kunst der Kaiserzeit, die sämtlichen, von einer jungen Glut erfüllten Kulte des Ostens, die des Mithras, Serapis, Horus, der Isis, der syrischen Baale von Emesa und Palmyra, das Christentum und den Neuplatonismus, die kaiserlichen Fora in Rom und das dort von einem Syrer erbaute Pantheon, die früheste aller Moscheen, zu betrachten.
Daß man damals griechisch schrieb und griechisch zu denken glaubte, wiegt nicht schwerer als die Tatsache, daß die Wissenschaft des Abendlandes bis zu Kant hinauf die lateinische Sprache vorzog und daß Karl der Große das römische Reich „erneuerte“.
Bei Diophant ist die Zahl nicht mehr das Maß und Wesen von plastischen Dingen. Auf den ravennatischen Mosaiken ist der Mensch nicht mehr Körper. Unvermerkt haben die griechischen Bezeichnungen ihren ursprünglichen Gehalt verloren. Wir verlassen die Sphäre der attischen καλοκἀγαθία, der stoischen ἀταραξία und γαλήνη. Zwar kennt Diophant die Null und die negativen Zahlen noch nicht, aber die plastischen Einheiten pythagoräischer Zahlen kennt er nicht mehr. Andrerseits ist die Unbestimmtheit der unbenannten arabischen Zahlen doch auch etwas ganz andres als die gesetzmäßige Variabilität der spätem abendländischen Zahl, der Funktion.
Die magische Mathematik, die Algebra, hat sich, ohne daß uns Einzelheiten bekannt wären, über Diophant hinaus — der schon eine gewisse Entwicklung voraussetzt — logisch und in großer Linie bis zur Vollendung in der Abassidenzeit des 9. Jahrhunderts entwickelt, wie der Stand der Kenntnisse bei Alchwarizmi und Alsidschzi beweist. Dann erst beginnt, wieder ein halbes Jahrtausend später und in einer neuen, entfernten Landschaft der großartige Prozeß der Umdeutung dieser magischen, uns durch die spanischen Araber überlieferten Zahlenwelt in die funktionale Westeuropas, der mächtige Kampf gegen ein sich andrängendes fremdes Weltgefühl mit seiner innerlich gereiften Raumdeutung, welche die junge, gotische Seele abwehren[S. 105] und brechen mußte, um ihr Eigenstes nicht verkümmern zu lassen, ein heimliches Ringen in allen Architekturen, jeder Fassade, jedem Ornament, jedem Symbol, jedem metaphysischen und mathematischen Problem, das in seiner stummen Erhabenheit noch nie gefühlt worden ist.
Was neben der euklidischen Geometrie die attische Plastik — die gleiche Formensprache in andrem Gewande — was neben der Analysis des Raumes der fugierte Stil der Instrumentalmusik, das bedeutet neben dieser Algebra die magische Kunst der Mosaiken, der vom Sassanidenreich und später von Byzanz aus immer reicher entwickelten Arabeske mit ihrem sinnlich-unsinnlichen Verschweben organischer Formmotive und das Hochrelief konstantinischen Stils mit dem ungewissen Tiefendunkel des zwischen frei herausgearbeiteten Figuren ausgesparten Hintergrundes. Wie die Algebra zur antiken Arithmetik und zur abendländischen Analysis, so verhält sich die Kuppelbasilika zum dorischen Tempel und zum gotischen Dom.
Nicht als ob Diophant ein großer Mathematiker gewesen wäre. Das meiste, woran man bei seinem Namen erinnert wird, steht nicht in seinen Schriften und was darin steht, ist sicherlich nicht ganz sein Eigentum. Seine zufällige Bedeutung liegt darin, daß — nach unsrem Wissen — bei ihm als dem ersten das neue Zahlengefühl unverkennbar vorhanden ist. Man wird, Meistern gegenüber, die eine Mathematik abschließen, wie Apollonius und Archimedes die antike und ihnen entsprechend Gauß, Cauchy, Riemann die abendländische, bei Diophant und Menelaos etwas Primitives finden, das bisher gern als Dekadence angesprochen wurde. Man wird es künftig — nach dem Vorbilde der Umwertung der vermeintlich spätantiken, bisher geradezu verachteten Kunst zur tastenden Äußerung des eben erwachenden früharabischen Weltgefühls — begreifen und schätzen lernen. Ebenso archaisch, primitiv und suchend wirkt die Mathematik des Nikolas von Oresme, Bischofs von Lisieux (1323 bis 1382), der zum ersten Mal im Abendlande eine freie Art von Koordinaten und sogar Potenzen mit gebrochnen Exponenten verwandte, die ein Zahlengefühl voraussetzen, unklar noch, aber doch unverkennbar, das gänzlich unantik, aber auch nicht mehr arabisch ist. Man erinnere sich neben Diophant an frühchristliche[S. 106] Sarkophage der römischen Sammlungen und neben Oresme an gotische Gewandstatuen deutscher Dome, und man wird auch in den mathematischen Gedankengängen, die bei beiden die gleiche frühe Stufe des Intellekts darstellen, etwas Verwandtes bemerken. Das stereometrische Grenzgefühl in der letzten Verfeinerung und Eleganz eines Archimedes war verloren gegangen. Man war dumpf, sehnsüchtig, mystisch, nicht mehr attisch hell und frei gestimmt. Man war der erdgeborne Mensch einer frühen Landschaft, nicht Großstädter, wie Euklid und d’Alembert.[27] Man verstand die tiefen und komplizierten Gebilde des antiken Denkens nicht mehr und besaß verworrene, neue, deren klare städtisch-intellektuelle Fassung noch nicht gefunden werden konnte. Dies ist der gotische Zustand aller jungen Kulturen, den die Antike selbst in ihrer frühdorischen Zeit durchschritten hatte, von welcher außer den Grabvasen des Dipylonstils nichts geblieben ist. Erst in Bagdad, im 9. und 10. Jahrhundert, sind die Konzeptionen der Epoche Diophants von reifen Meistern, die Plato und Gauß nicht nachstehen, durchgeführt und abgeschlossen worden.
Die entscheidende Tat des Descartes, dessen Geometrie 1637 erschien, bestand nicht in der Einführung einer neuen Methode oder Anschauung auf dem Gebiete der überlieferten Geometrie, wie dies immer wieder ausgesprochen wird, sondern in der endgültigen Konzeption einer neuen Zahlenidee, die sich in der Lösung der Geometrie von der optischen Handhabe der Konstruktion, von der gemessenen und meßbaren Strecke überhaupt aussprach. Damit war die Analysis des Unendlichen Tatsache geworden. Das starre, sogenannte kartesische Koordinatensystem, der ideale Repräsentant von meßbaren Größen in halbeuklidischem Sinne, das in der vorhergehenden Periode, bei Oresme z. B., Bedeutung hat, wurde durch Descartes, wenn[S. 107] man in die Tiefe seiner Erwägungen dringt, nicht vollendet, sondern überwunden. Sein Zeitgenosse Fermat war sein letzter klassischer Vertreter.
An Stelle des sinnlichen Elements der konkreten Strecke und Fläche — dem spezifischen Ausdruck antiken Grenzgefühls — tritt das abstrakt-räumliche, mithin unantike Element des Punktes, der von nun an als Gruppe zugeordneter reiner Zahlen charakterisiert wird. Descartes hat den literarisch ererbten Begriff der Größe, der sinnlichen Dimension, zerstört und durch den veränderlichen Beziehungswert der Lagen im Raume ersetzt. Daß dies aber eine Beseitigung der Geometrie überhaupt war, die von nun an innerhalb der Zahlenwelt der Analysis nur noch ein durch antike Reminiszenzen verschleiertes Scheindasein führt, hat man übersehen. Das Wort Geometrie hat einen nicht zu beseitigenden apollinischen Sinn. Von Descartes an ist die vermeintlich „neuere Geometrie“ entweder ein synthetischer Prozeß, welcher die Lage von Punkten in einem nicht mehr notwendig dreidimensionalen Raume (einer „Punktmannigfaltigkeit“) durch Zahlen, oder ein analytischer, welcher Zahlen durch die Lage von Punkten bestimmt. Strecken durch Lagen ersetzen heißt den Begriff der Ausdehnung rein räumlich, nicht mehr körperhaft fassen.
Das klassische Beispiel für diese Zerstörung der als Erbschaft überkommenen optisch-endlichen Geometrie scheint mir die Umkehrung der Winkelfunktionen — welche in einem uns kaum erreichbaren Sinne Zahlen der indischen Mathematik gewesen waren — in cyklometrische Funktionen und weiterhin deren Auflösung in Reihen zu sein, die im unendlichen Zahlenbereich der algebraischen Analysis auch die leiseste Erinnerung an geometrische Gebilde im Stile Euklids verloren haben. Die Kreiszahl π erzeugt wie die Basis der natürlichen Logarithmen e in diesem ganzen Zahlenbereich, überall auftauchend, Beziehungen, die alle Grenzen der ehemaligen Geometrie, Trigonometrie, Algebra auslöschen, die weder arithmetischer noch geometrischer Natur sind — und bei denen niemand mehr an wirklich gezeichnete Kreise oder zu berechnende Potenzen denkt.
[S. 108]
Während die antike Seele durch Pythagoras um 540 zur Konzeption ihrer, der apollinischen Zahl als einer meßbaren Größe gelangt war, fand die Seele des Abendlandes durch Descartes und seine Generation (Pascal, Fermat, Desargues) im genau entsprechenden Zeitpunkte die Idee einer Zahl, die aus dem leidenschaftlichen faustischen Hange zum Unendlichen geboren war. Die Zahl als reine Größe, die sich an die körperliche Gegenwart des Einzeldinges heftet, findet ihr Gegenstück in der Zahl als reiner Beziehung. Darf die antike Welt, der Kosmos, aus jenem tiefen Bedürfnis nach sichtbarer Begrenztheit als abzählbare Summe von stofflichen Dingen definiert werden, so hat sich unser Weltgefühl im Bilde eines unendlichen Raumes verwirklicht, in dem alles Sichtbare als etwas Bedingtes dem Unbedingten gegenüber, beinahe als eine Wirklichkeit zweiten Ranges empfunden wird. Sein Symbol ist der entscheidende, in keiner andern Kultur angedeutete Begriff der Funktion. Die Funktion ist nichts weniger als die Erweiterung irgendeines vorhandenen Zahlbegriffs; sie ist deren völlige Überwindung. Nicht nur die euklidische, d. h. die allgemein menschliche, populäre Geometrie, sondern auch die archimedische Sphäre des elementaren Rechnens, die Arithmetik, hört damit auf, für die wirklich bedeutende Mathematik Westeuropas zu existieren. Es gibt nur noch eine abstrakte Analysis. Für den antiken Menschen waren Geometrie und Arithmetik wissenschaftliche Komplexe vom höchsten Range, beide anschaulich, beide mit Größen zeichnerisch oder rechnerisch verfahrend; für uns sind sie nur noch praktische Hilfsmittel des alltäglichen Lebens. Addition und Multiplikation, die beiden antiken Methoden der Größenrechnung und Schwestern der zeichnerischen Konstruktion, verschwinden völlig in der Unendlichkeit funktionaler Prozesse. Gerade die Potenz, die zunächst prinzipiell nur ein Zahlzeichen für eine bestimmte Gruppe von Multiplikationen (für Produkte gleicher Größen) ist, wird durch das neue Symbol des Exponenten (Logarithmus) und seine Anwendung in komplexen, negativen, gebrochnen Formen vom Größenbegriff gänzlich abgelöst und in eine transzendente Beziehungswelt überführt, die[S. 109] den Griechen, welche nur zwei positive, ganzzahlige Potenzen als Repräsentanten von Flächen und Körpern kannten, unzugänglich bleiben mußte (man denke an Ausdrücke wie e-x, π√x, a1i.
Jede der tiefsinnigen Schöpfungen, welche von der Renaissance an rasch aufeinander folgen, die der imaginären und komplexen Zahlen, welche Cardanus schon 1550 einführt, die der unendlichen Reihen, welche durch Newtons große Entdeckung des Binomialsatzes 1666 theoretisch sicher begründet werden, die der Logarithmen um 1610, der Differentialgeometrie, des bestimmten Integrals durch Leibniz, der Menge als neuer Zahleneinheit, von Descartes schon angedeutet, die neuen Prozesse wie die unbestimmte Integration, die Entwicklung der Funktionen in Reihen, sogar in unendliche Reihen andrer Funktionen, sind ebenso viele Siege über das populär-sinnliche Zahlengefühl in uns, das aus dem Geiste der neuen Mathematik heraus, die ein neues Weltgefühl zu verwirklichen hatte, überwunden werden mußte. Es gab bisher keine zweite Kultur, welche den Leistungen einer andern, längst erloschenen, soviel Verehrung entgegentrug und wissenschaftlich so viel Einfluß gestattete, wie die abendländische gerade der antiken. Es dauerte lange, bevor wir den Mut fanden, unser eignes Denken zu denken. Auf dem Grunde lag der beständige Wunsch, es der Antike gleichzutun. Trotzdem war jeder Schritt in diesem Sinne eine tatsächliche Entfernung von dem erstrebten Ideal. Deshalb ist die Geschichte des abendländischen Wissens die einer fortschreitenden Emanzipation von Fremdem, einer Befreiung, die nicht einmal gewollt, die in den Tiefen des Unbewußten erzwungen wurde. So gestaltete sich die Entwicklung der neuen Mathematik zu einem heimlichen, langen, endlich siegreichen Kampf gegen den Größenbegriff.
Antikisierende Vorurteile haben uns gehindert, die eigentlich abendländische Zahl als solche in neuer Weise zu bezeichnen. Die gegenwärtige Zeichensprache der Mathematik fälscht den[S. 110] Tatbestand und ihr ist es vor allem zuzuschreiben, daß noch heute auch unter Mathematikern der Glaube herrscht, Zahlen seien Größen — auf dieser Voraussetzung ruht allerdings unsre schriftliche Bezeichnungsweise.
Aber nicht die zum Ausdruck der Funktion dienenden einzelnen Zeichen (x, π, 5), die Funktion selbst als Einheit, als Element, die variable, in optische Grenzen nicht mehr einzuschließende Beziehung ist die neue Zahl. Für sie wäre, eine neue, in ihrer Struktur nicht von antiken Anschauungen beeinflußte Symbolik nötig gewesen.
Man vergegenwärtige sich den Unterschied zweier Gleichungen — selbst dies Wort sollte nicht so heterogene Dinge zusammenfassen — wie 3x + 4x = 5x und xn + yn = zn (die Gleichung des Fermatschen Satzes). Die erste besteht aus mehreren „antiken Zahlen“ (Größen), die zweite ist eine Zahl von einer andern Art, was durch die identische Schreibweise, deren Zeichensprache sich unter dem Eindruck euklidisch-archimedischer Vorstellungen entwickelt hat, verdeckt wird. Im ersten Fall ist das Gleichheitszeichen die Feststellung einer starren Verknüpfung bestimmter, greifbarer Größen; im zweiten repräsentiert es eine Beziehung, die innerhalb einer Gruppe variabler Gebilde besteht, derart, daß gewisse Veränderungen gewisse andere notwendig zur Folge haben. Die erste Gleichung bezweckt die Bestimmung (Messung) einer konkreten Größe, dem „Resultat“, die zweite hat überhaupt kein Resultat, sondern ist nur Abbild und Zeichen einer Beziehung, die für n > 2 — das ist das berühmte Fermatproblem — wahrscheinlich nachweisbar ganzzahlige Werte ausschließt. Ein griechischer Mathematiker würde nicht verstanden haben, was man mit Operationen dieser Art, deren Endzweck kein „Ausrechnen“ ist, eigentlich wollte.
Der Begriff der Unbekannten führt vollständig irre, wenn man ihn auf die Buchstaben der Fermatschen Gleichung anwendet. In der ersten, der „antiken“, ist x eine Größe, eine bestimmte und meßbare, die man nur erst zu ermitteln hat. In der zweiten hat für x, y, z, n das Wort „bestimmen“ gar keinen Sinn, folglich will man den „Wert“ dieser Symbole nicht ermitteln, folglich sind sie überhaupt keine Zahlen im plastischen Sinne, sondern Zeichen für einen Zusammenhang, dem die[S. 111] Merkmale der Größe, Gestalt und Eindeutigkeit fehlen, für eine Unendlichkeit möglicher Lagen von gleichem Charakter, die als Einheit begriffen erst die Zahl sind. Die ganze Gleichung ist, in einer Zeichenschrift, die leider viele und irreführende Zeichen verwendet, tatsächlich eine einzige Zahl und x, y, z sind es so wenig, als + und = Zahlen sind.
Denn schon mit dem Begriff der irrationalen, der ganz eigentlich antihellenischen Zahlen ist im tiefsten Grunde der Begriff der konkreten, bestimmten Zahl aufgelöst worden. Von nun an bilden diese Zahlen nicht mehr eine übersehbare Reihe ansteigender, diskreter, plastischer Größen, sondern ein zunächst eindimensionales Kontinuum, in welchem jeder Schnitt (im Sinne Dedekinds) eine „Zahl“ repräsentiert, die kaum die alte Bezeichnung führen sollte. Für den antiken Geist gibt es zwischen 1 und 3 nur eine Zahl, für den abendländischen eine unendliche Menge. Mit der Einführung der imaginären (√−1=i) und komplexen Zahlen (von der allgemeinen Form a + bi) endlich, welche das lineare Kontinuum zu dem höchst transzendenten Gebilde eines Zahlkörpers (des Inbegriffs einer Menge gleichartiger Elemente) erweitern, in dem nun jeder Schnitt eine Zahlebene — eine unendliche Menge von geringerer „Mächtigkeit“, etwa den Inbegriff aller reellen Zahlen — repräsentiert, ist jeder Rest antik-populärer Greifbarkeit zerstört worden. Diese Zahlenebenen, die in der Funktionentheorie seit Cauchy und Gauß eine wichtige Rolle spielen, sind reine Gedankengebilde. Selbst die positive irrationale Zahl wie √2 konnte aus dem antiken Zahlendenken gewissermaßen wenigstens negativ konzipiert werden, indem man sie als Zahl ausschloß — als ἄῥῤητος und ἄλογος; Ausdrücke von der Form x + yi liegen aber jenseits aller Möglichkeiten des antiken Denkens. Auf der Ausdehnung der arithmetischen Gesetze auf das ganze Gebiet des Komplexen, innerhalb dessen sie ständig anwendbar bleiben, beruht die Funktionentheorie, welche nun endlich die abendländische Mathematik in ihrer Reinheit darstellt, indem sie alle Einzelgebiete in sich begreift und auflöst. Erst damit wird diese Mathematik auf das Bild der gleichzeitig sich entwickelnden dynamischen Physik des Abendlandes vollkommen anwendbar, während die antike Mathematik das genaue Korrelat jener Welt plastischer[S. 112] Einzeldinge darstellt, welche die statische Physik des Aristoteles, die exakt wissenschaftliche Interpretation des antiken Kosmos schildert.
Das klassische Jahrhundert dieser Barockmathematik — im Gegensatz zu der ionischen Stils — ist das 18., das von den entscheidenden Entdeckungen Newtons und Leibnizens über Euler, Lagrange, Laplace, d’Alembert zu Gauß führt. Die Entfaltung dieser mächtigen geistigen Schöpfung geschah wie ein Wunder. Man wagte kaum zu glauben, was man sah. Man fand Wahrheiten über Wahrheiten, die den feinen Geistern eines skeptisch gestimmten Zeitalters unmöglich erschienen. Das Wort d’Alemberts gehört hierher: Allez en avant et la foi vous viendra. Es bezog sich auf die Theorie des Differentialquotienten. Die Logik selbst schien Einspruch zu erheben, alle Annahmen auf Fehlern zu beruhen, und man kam doch zum Ziel.
Dies Jahrhundert eines sublimen Rausches in durchgeistigten, dem leiblichen Auge entrückten Formen — denn neben jenen Meistern der Analysis stehen Bach, Gluck, Haydn, Mozart —, in dem ein kleiner Kreis gewählter und tiefer Geister in den raffiniertesten Entdeckungen und Formspielen schwelgte, von denen Goethe und Kant ausgeschlossen blieben, entspricht seinem Gehalte nach genau dem reifsten Jahrhundert der Ionik, dem des Plato, Archytas und Eudoxos (450–350) — man muß wieder hinzufügen des Phidias, Polyklet, Alkamenes und der Akropolisbauten —, in welchem die Formenwelt der antiken Mathematik und Plastik in der ganzen Fülle ihrer Möglichkeiten aufblühte und zu Ende kam.
Jetzt erst läßt sich der elementare Gegensatz antiken und abendländischen Seelentums übersehen. Es gibt innerhalb des Gesamtbildes der Geschichte des höheren Menschentums nichts innerlich Fremderes. Und eben deshalb, weil Gegensätze sich berühren, weil sie auf ein vielleicht Gemeinsames in der letzten Tiefe der Existenz verweisen, finden wir in der abendländischen, faustischen Seele jenes sehnsüchtige Suchen nach dem Ideal der apollinischen, die sie allein von allen andern begriffen und um die Kraft ihrer Hingabe an die sinnlich-reine Gegenwart beneidet hat.
Diesen seelischen, nicht weiter in Worte zu fassenden Gegensatz verwirklichen in der Außenwelt des Gewordnen, Begrenzten,[S. 113] Vergänglichen die historischen Einheiten der antiken und abendländischen Kultur, von denen die eine in spät-mykenischer Zeit, die andre zur Zeit der Sachsenkaiser aufblühte und die in Aristoteles und Kant, Plato und Goethe, Phidias und Beethoven, Alexander und Napoleon ihre Entwicklung zu Ende führten.
Erst jetzt wird auch das ganze Gewicht einer Symbolik fühlbar, die in der Zahlenwelt beider Mathematiken vielleicht ihren unmittelbarsten Ausdruck gefunden hat, deren Bereich aber weit darüber hinausgeht. Es zeigt sich, daß eine Mathematik mit allen sie begleitenden Künsten, mit allen Schöpfungen des tätigen Lebens überhaupt die gleiche Sprache redet, eine Formensprache, in der sich die letzten Möglichkeiten des Seelischen ebenso offenbaren wie verhüllen. Am engsten sind der Mathematik jene mystischen Architekturen aller Frühzeiten verschwistert, die dorische, gotische, frühchristliche wie die ägyptische des Alten Reiches. Hier, in der ägyptischen Kultur, haben beide Formenwelten sich nie getrennt. Die Architektur der großen Pyramidentempel ist eine schweigende Mathematik, wie denn auch die antike Seele eine Scheidung ihrer statuarischen und geometrischen Symbolik nie streng vollzogen hat. Aber auch die Analysis ist eine Architektur größten Stils geblieben und wir begreifen jetzt, warum zwei Zahlensysteme, von denen die eine die Grenzwerte des Augenscheins ebenso leidenschaftlich bejaht, wie die andere sie verneint, als Schwesterkünste die ionische Plastik und die deutsche Musik, die sinnlichste und die unsinnlichste aller Möglichkeiten künstlerischer Gestaltungskraft, an ihrer Seite finden mußten.
Es war bemerkt worden, daß im Urmenschen wie im Kinde ein inneres Erlebnis, die Geburt des Ich, eintritt, mit dem beide das Phänomen der Zahl begreifen, mithin eine auf das Ich bezogene Umwelt besitzen.
Sobald vor dem erstaunten Blick des frühen Menschen diese ertagende Welt des geordneten Ausgedehnten, des sinnvoll Gewordnen sich in großen Umrissen aus einem Chaos von Eindrücken[S. 114] abhebt und der tief empfundene unwiderrufliche Gegensatz dieser Außenwelt zur eignen Seele dem bewußten Leben Richtung und Gestalt gibt, erwacht zugleich mit allen Möglichkeiten einer neuen Kultur das Urgefühl der Sehnsucht in dieser sich plötzlich ihrer Einsamkeit bewußten Seele. Es ist die Sehnsucht nach dem Ziel des Werdens, nach Vollendung und Verwirklichung alles innerlich Möglichen, nach Entfaltung der Idee des eigenen Daseins. Es ist die Sehnsucht des Kindes, die als das Gefühl einer unaufhaltsamen Richtung mit steigender Deutlichkeit ins Bewußtsein tritt, und später als das Rätsel der Zeit unheimlich, verlockend, unlösbar vor dem gereiften Geiste steht. Die Worte Vergangenheit und Zukunft haben plötzlich eine schicksalsvolle Bedeutung erhalten.
Aber diese Sehnsucht aus der Überfülle und Seligkeit des innern Werdens ist in der tiefsten Tiefe einer jeden Seele zugleich Angst. Wie alles Werden sich auf ein Gewordensein richtet, mit dem es endet, so rührt das Urgefühl des Werdens, die Sehnsucht, schon an das andre des Gewordenseins, die Angst. In der Gegenwart fühlt man das Verrinnen; in der Vergangenheit liegt die Vergänglichkeit. Hier ist die Wurzel der ewigen Angst vor dem Unwiderruflichen, Erreichten, Endgültigen, vor der Vergänglichkeit, vor der Welt selbst als dem Verwirklichten, in dem mit der Grenze der Geburt zugleich die des Todes gesetzt ist, die Angst vor dem Augenblicke, wo das Mögliche verwirklicht, das Leben innerlich erfüllt und vollendet ist, wo das Bewußtsein am Ziele steht. Es ist jene tiefe Weltangst der Kinderseele, welche den höheren Menschen, den Gläubigen, den Dichter, den Künstler in seiner grenzenlosen Vereinsamung niemals verläßt, die Angst vor den fremden Mächten, die groß und drohend, in sinnliche Erscheinungen verkleidet, in die ertagende Welt hineinragen. Auch die Richtung in allem Werden wird in ihrer Unerbittlichkeit — Nichtumkehrbarkeit — als ein fremdes Element mit innerster Gewißheit empfunden. Es ist etwas Fremdes, das Zukunft in Vergangenheit verwandelt, und dies gibt der Zeit im Gegensatz zum Raum jenes widerspruchsvoll Unheimliche und drückend Zweideutige, dessen sich kein bedeutender Mensch ganz erwehren kann.
[S. 115]
Die Weltangst ist sicherlich das Schöpferischste aller Urgefühle. Ihr verdankt ein Mensch die reifsten und tiefsten aller Formen und Gestalten nicht nur des bewußten Innenlebens, sondern auch seiner Spiegelung in den zahllosen Bildungen äußerer Kultur. Wie eine geheime Melodie, nicht jedem vernehmbar, geht die Angst durch die Formensprache eines jeden wahren Kunstwerkes, jeder innerlichen Philosophie, jeder bedeutenden Tat und sie liegt, nur den wenigsten noch fühlbar, den großen Problemen jeder Mathematik zugrunde. Nur der innerlich erstorbene Mensch der großen späten Städte, des ptolemäischen Alexandria oder des heutigen Paris und Berlin, nur der rein intellektuelle Sophist, Sensualist und Darwinist verliert oder verleugnet sie, indem er eine geheimnislose „wissenschaftliche Weltanschauung“ zwischen sich und das Fremde stellt.
Knüpft sich die Sehnsucht an jenes unfaßliche Etwas, dessen tausend ungreifbare, proteusartig wechselnde Bildungen durch das Wort Zeit mehr verdeckt als bezeichnet werden, so findet das Urgefühl der Angst seinen Ausdruck in den geistigen, faßlichen, der Gestaltung fähigen Symbolen der Ausdehnung. So finden sich im wachen Bewußtsein jeder Kultur, in jeder anders geartet, die Gegenformen der Zeit und des Raumes, der Richtung und der Ausdehnung, jene dieser zugrunde liegend, wie das Werden dem Gewordnen — denn auch die Sehnsucht liegt der Angst zugrunde; sie wird zur Angst, nicht umgekehrt — jene der geistigen Macht entzogen, diese ihr dienend, jene nur zu erleben, diese nur zu erkennen. „Gott fürchten und lieben“ ist der christliche Ausdruck für den Gegensinn beider Weltgefühle.
Aus der Seele des gesamten Urmenschentums und also auch der frühesten Kindheit erhebt sich der Drang, das Element der fremden Mächte, die in allem Ausgedehnten, im Raume und durch den Raum unerbittlich gegenwärtig sind, zu bannen, zu zwingen, zu versöhnen — zu „erkennen“. Im letzten Grunde ist dies dasselbe. Gott erkennen heißt in der Mystik aller frühen Zeiten ihn beschwören, ihn sich geneigt machen, ihn sich innerlich aneignen. Das geschieht durch ein Wort, den „Namen“, mit dem man das numen benennt[S. 116] anruft, oder durch die Formen eines Kultes, denen eine geheime Kraft innewohnt. Die Ideen der deutschen wie der orientalischen Mystiker, die Entstehung aller antiken Götter, aller Kulte lassen keinen Zweifel darüber zu. Wirkliche Erkenntnis ist geistige Einverleibung des Fremden. Diese Abwehr ist die erste schöpferische Tat jedes erwachten Seelentums. Mit ihr beginnt ganz eigentlich das höhere Innenleben einer Kultur oder eines Einzelnen. Erkenntnis, Grenzsetzung durch Begriffe und Zahlen, ist die feinste, aber auch die mächtigste Form dieser Abwehr. Insofern wird der Mensch erst durch die Sprache ganz zum Menschen. Die Erkenntnis verwandelt mit unbezwinglicher Notwendigkeit das Chaos der ursprünglichen, umgebenden Eindrücke in den Kosmos, den Inbegriff seelischen Ausdrucks, die „Welt an sich“ in die „Welt für uns“.[28] Sie stillt die Weltangst, indem sie das Fremde, Geheimnisvolle bändigt, es zur faßlichen, geordneten Wirklichkeit gestaltet, es durch die ehernen Regeln einer eignen, ihm aufgeprägten intellektuellen Formensprache fesselt.
Dies ist die Idee des „tabu“, das im Seelenleben aller primitiven Völker eine entscheidende Rolle spielt, dessen urmenschlicher Gehalt aber uns so fern liegt, daß das Wort in keine reife Kultursprache mehr übertragbar ist. Ihm liegt ein ursprüngliches Gefühl, vor allem Erkennen und Begreifen der Umwelt, ja vor allem klaren, in Seele und Welt geschiednen Bewußtsein zugrunde, das unter uns Heutigen, intellektuellen Weltstädtern, nur Kindern und wenigen künstlerischen Naturen noch zugänglich ist. Ratlose Angst, heilige Scheu, tiefe Verlassenheit, Schwermut, Haß, dunkle Wünsche nach Annäherung, Vereinigung, Entfernung, all diese formvollen Gefühle gereifter Seelen vorschweben in diesem frühen Zustande in einer dumpfen Unentschiedenheit. Der Doppelsinn des Wortes Beschwören, das bezwingen und anflehen zugleich bedeutet, kann den Sinn jenes mystischen Aktes verdeutlichen, durch den der frühe Mensch das Fremde und Gefürchtete „tabu“ macht. Die ehrfürchtige Scheu vor allem von ihm Unabhängigen, Gesetzten,[S. 117] Gesetzlichen, den fremden Mächten in der Welt, ist der Ursprung aller und jeder elementaren Form. In Urzeiten verwirklicht sie sich in hieratischen Ornamenten und peinlichen Zeremonien, strengen Satzungen einer primitiven Sitte und seltsamen Kulten. Auf der Höhe großer Kulturen sind diese Gestaltungen, ohne innerlich die Merkmale ihrer Herkunft, den Charakter einer Bannung und Beschwörung verloren zu haben, zu den vollendeten Formenwelten der einzelnen Künste, des religiösen, logischen, mathematischen Denkens, des wirtschaftlichen, politischen, sozialen, individuellen Daseins aufgewachsen. Ihr gemeinsames Mittel, das einzige, welches die sich verwirklichende Seele kennt, ist die Symbolisierung des Ausgedehnten, des Raumes oder der Dinge — sei es in den Konzeptionen des absoluten Weltraumes der Physik Newtons, der Innenräume gotischer Dome und maurischer Moscheen, der atmosphärischen Unendlichkeit der Gemälde Rembrandts und ihrer Wiederkehr in den dunklen Tonwelten Beethovenscher Quartette, seien es die regelmäßigen Polyeder Euklids, die Parthenonskulpturen oder die Pyramiden Altägyptens, das Nirwana Buddhas, die Distanz höfischer Sitte unter Sesostris, Justinian I. und Ludwig XIV., sei es endlich die Gottesidee Homers, Plotins, Dantes oder die den Erdball umspannende Raumenergie der heutigen Technik.
Kehren wir zur Mathematik zurück. Der Ausgangspunkt aller antiken Formgebung war, wie wir sahen, die Ordnung des Gewordnen, insofern es sinnlich, gegenwärtig, greifbar, meßbar, zählbar ist. Das abendländische, gotische Formgefühl, das einer einsamen, in alle Fernen schweifenden Seele, hat das Zeichen des reinen, unanschaulichen, grenzenlosen Raumes gewählt. Man täusche sich ja nicht über die enge Bedingtheit solcher Symbole, die uns leicht als identisch, als allgemeingültig erscheinen. Unser unendlicher Weltraum, über dessen Vorhandensein, wie es scheint, kein Wort zu verlieren ist, ist für den antiken Menschen nicht vorhanden. Er ist ihm nicht einmal vorstellbar. Der hellenische Kosmos andrerseits, dessen tiefe[S. 118] Fremdheit für unsre Auffassungsweise nicht so lange hätte unbemerkt bleiben sollen, ist dem Hellenen das Selbstverständliche. In der Tat ist der absolute Raum unserer Physik eine Form, die allein aus unserm Seelentum als dessen Abbild und Ausdruck entstanden und allein für unsre Art des wachen Daseins wirklich, notwendig und natürlich ist. Die gesamte Mathematik von Descartes an dient der theoretischen Interpretation dieses großen, von religiösem Gehalte erfüllten Symbols. Die Physik will seit Galilei nichts andres. Die antike Mathematik und Physik kennen dies Objekt überhaupt nicht.
Auch hier haben antike Namen, die wir aus der literarischen Erbschaft der Griechen beibehalten haben, den Tatbestand verschleiert. Geometrie heißt die Kunst des Messens, Arithmetik die des Zählens. Die Mathematik des Abendlandes hat mit diesen beiden Arten des Begrenzens nichts mehr zu tun, aber sie hat keinen neuen Namen für sich gefunden. Das Wort Analysis sagt bei weitem nicht alles.
Der antike Mensch beginnt und schließt seine Erwägungen mit dem einzelnen Körper und seinen Grenzflächen. Wir kennen im Grunde nur das abstrakte Raumelement des Punktes, das, ohne Anschaulichkeit, ohne die Möglichkeit einer Messung und Benennung, lediglich ein Beziehungszentrum repräsentiert. Die Gerade ist für den Griechen eine meßbare Kante, für uns ein unbegrenztes Punktkontinuum. Leibniz führt als Beispiel für sein Infinitesimalprinzip die Gerade an, die den Grenzfall eines Kreises mit unendlich großem Radius darstellt, während der Punkt den andern Grenzfall bildet. So wurde die Quadratur des Kreises das klassische Grenzproblem für den Geist antiker Menschen. Das schien ihnen das tiefste aller Geheimnisse der Weltform: krummlinig begrenzte Flächen bei unveränderter Größe in Rechtecke zu verwandeln und dadurch meßbar zu machen. Für uns ist daraus das wenig bedeutende Verfahren geworden, die Zahl π durch algebraische Mittel darzustellen, ohne daß dabei von geometrischen Gebilden überhaupt die Rede wäre.
Der antike Mathematiker kennt nur das, was er sieht und greift. Wo die begrenzte, begrenzende Sichtbarkeit, das Thema seiner Gedankengänge, aufhört, findet seine Wissenschaft ein[S. 119] Ende. Der abendländische Mathematiker begibt sich, sobald er von antiken Vorurteilen frei sich selbst gehört, in die gänzlich abstrakte Region einer unendlichen Zahlenmannigfaltigkeit von n — nicht mehr von 3 — Dimensionen, innerhalb deren seine sogenannte Geometrie jeder anschaulichen Hilfe entbehren kann und meistens muß. Greift der antike Mensch zu künstlerischem Ausdruck seines Formgefühls, so sucht er dem menschlichen Körper in Tanz und Ringkampf, in Marmor und Bronze diejenige Haltung zu geben, in der Flächen und Konturen ein Maximum von Maß und Sinn haben. Der echte Künstler des Abendlandes aber schließt die Augen und verliert sich in den Bereich einer körperlosen Musik, in dem Harmonie und Polyphonie zu Bildungen von höchster „Jenseitigkeit“ führen, die weitab von allen Möglichkeiten optischer Bestimmung liegen. Man denke daran, was ein athenischer Bildhauer und was ein nordischer Kontrapunktist unter einer Figur versteht, und man hat den Gegensatz beider Welten, beider Mathematiken vor sich. Die griechischen Mathematiker gebrauchen sogar das Wort σῶμα für Körper. Andrerseits verwendet es die Rechtssprache für Person im Gegensatz zur Sache (σώματα καὶ πράγματα: personae et res).
Deshalb sucht das Phänomen der antiken, ganzen, körperlichen Zahl unwillkürlich eine Beziehung zur Entstehung des leiblichen Menschen, des σῶμα. Die Zahl 1 wird noch kaum als wirkliche Zahl empfunden. Sie ist die ἀρχή, der Urstoff der Zahlenreihe, der Ursprung aller eigentlichen Zahlen und damit aller Größe, allen Maßes, aller Dinglichkeit. Ihr Zahlzeichen war im Kreise der Pythagoräer, gleichviel zu welcher Zeit, zugleich das Symbol des Mutterschoßes, des Ursprungs alles Lebens. Die 2, die erste eigentliche Zahl, welche die 1 verdoppelt, erhielt deshalb eine Beziehung zum männlichen Prinzip, und ihr Zeichen war eine Nachbildung des Phallus. Die heilige Drei der Pythagoräer endlich bezeichnete den Akt der Vereinigung von Mann und Weib, der Zeugung —, die erotische Deutung der beiden einzigen der Antike wertvollen Prozesse der Größenvermehrung, der Größenzeugung, Addition und Multiplikation, ist leicht verständlich — und ihr Zeichen war die Vereinigung der beiden ersten. Von hier aus fällt ein neues[S. 120] Licht auf den erwähnten Mythus vom Frevel der Aufdeckung des Irrationalen. Das Irrationale, in unsrer Ausdrucksweise die Verwendung der unendlichen Dezimalbrüche, bedeutete eine Zerstörung der organisch-leiblichen, zeugenden Ordnung, welche durch die Götter gesetzt war. Es ist kein Zweifel, daß die pythagoräische Reform der antiken Religion den uralten Demeterkult wieder zugrunde legte. Demeter ist der Gaia, der mütterlichen Erde verwandt. Es besteht eine tiefe Beziehung zwischen ihrer Verehrung und dieser erhabenen Auffassung der Zahlen.
So ist die Antike mit innerer Notwendigkeit allmählich die Kultur des Kleinen geworden. Die apollinische Seele hatte den Sinn des Gewordnen durch das Prinzip der übersehbaren Grenze zu bannen gesucht; ihr „tabu“ richtete sich auf die unmittelbare Gegenwart und Nähe des Fremden. Was weit fort, was nicht sichtbar war, war auch nicht da. Der Grieche wie der Römer opferte den Göttern der Gegend, in der er sich aufhielt; alle andern entschwanden seinem Gesichtskreis. Wie die griechische Sprache kein Wort für den Raum besaß — wir werden die gewaltige Symbolik solcher Sprachphänomene immer wieder verfolgen —, so fehlt dem Griechen auch unser Landschaftsgefühl, das Gefühl für Horizonte, Ausblicke, Fernen, Wolken, auch der Begriff des Vaterlandes, das sich weithin erstreckt und eine große Nation umfaßt. Heimat ist dem antiken Menschen, was er von der Burg seiner Vaterstadt aus übersehen kann, nicht mehr. Was jenseits dieser optischen Grenze eines politischen Atoms lag, war fremd, war sogar feindlich. Hier schon beginnt die Angst des antiken Daseins und dies erklärt die furchtbare Erbitterung, mit der diese winzigen Städte einander vernichteten. Die Polis ist die kleinste aller denkbaren Staatsformen und ihre Politik die ausgesprochene Politik der Nähe, sehr im Gegensatz zu unserer Kabinettsdiplomatie, der Politik des Grenzenlosen. Der antike Tempel, mit einem Blick zu umfassen, ist der kleinste aller klassischen Bautypen. Die Geometrie von Archytas bis auf Euklid beschäftigt sich — wie es die unter ihrem Eindruck stehende Schulgeometrie noch heute tut — mit kleinen, handlichen Figuren und Körpern und so blieben ihr die Schwierigkeiten verborgen,[S. 121] welche bei der Zugrundelegung von Figuren mit astronomischen Dimensionen auftauchen und die Anwendung der euklidischen Geometrie nicht mehr überall gestatten.[29] Andernfalls hätte der feine attische Geist vielleicht schon damals etwas von dem Problem der nichteuklidischen Geometrien geahnt, denn die Einwände gegen das bekannte Parallelenaxiom,[30] dessen zweifelhafte und doch nicht zu verbessernde Fassung schon früh Anstoß erregte, rührten nahe an die entscheidende Entdeckung. So selbstverständlich dem antiken Sinn die ausschließliche Betrachtung des Nahen und Kleinen, so selbstverständlich ist dem unsern die des Unendlichen, die Fähigkeiten des Auges Überschreitenden. Alle mathematischen Ansichten, welche das Abendland entdeckte oder entlehnte, wurden mit tiefster Notwendigkeit der Formensprache des Infinitesimalen unterworfen und das, lange bevor die eigentliche Differentialrechnung entdeckt worden war. Arabische Algebra, indische Trigonometrie, antike Mechanik werden ohne weiteres der Analysis einverleibt. Gerade die „evidentesten“ Sätze des elementaren Rechnens — daß etwa 2 × 2 = 4 ist — werden, aus analytischen Gesichtspunkten betrachtet, zu Problemen, deren Lösung erst durch Ableitungen aus der Mengenlehre und in vielen Einzelheiten überhaupt noch nicht gelungen ist, — was Plato und seiner Zeit sicherlich als Wahnsinn und Beweis eines völligen Mangels an mathematischer Begabung erschienen wäre.
Man kann gewissermaßen die Geometrie algebraisch oder die Algebra geometrisch behandeln, das heißt das Auge ausschalten oder herrschen lassen. Das erste haben wir, das andre die Griechen getan. Archimedes, der in seiner schönen Berechnung der Spirale gewisse allgemeine Tatsachen berührt, die auch der Methode des bestimmten Integrals bei Leibniz zugrunde liegen, ordnet sein bei oberflächlicher Betrachtung höchst[S. 122] modern wirkendes Verfahren sofort stereometrischen Prinzipien unter; ein Inder hätte im gleichen Falle mit Selbstverständlichkeit etwa eine trigonometrische Formulierung gefunden. (Was von der uns bekannten indischen Mathematik altindisch, das heißt vor Buddha entstanden ist, läßt sich heute nicht mehr feststellen.)
Aus dem fundamentalen Gegensatz antiker und abendländischer Zahlen entspringt ein ebenso tiefgehender des Verhältnisses, in dem die Elemente jedes dieser Komplexe untereinander stehen. Das Verhältnis von Größen heißt Proportion, das von Beziehungen ist im Wesen der Funktion enthalten. Beide Worte haben, über den Bereich der Mathematik hinausgehend, höchste Bedeutung für die Technik der beiden zugehörigen Künste, Plastik und Musik. Sieht man ganz von dem Sinn ab, den das Wort Proportion für die Gliederung der einzelnen Statue hat, so sind es die typisch antiken Kunstwerke, Statue, Relief und Fresko, welche eine Vergrößerung und Verkleinerung des Maßstabes gestatten — Worte, die für die Musik, die Kunst des Grenzenlosen, keinen Sinn haben. Man denke an die Kunst der Gemmen, deren Gegenstände im wesentlichen Verkleinerungen lebensgroßer Plastiken waren. Innerhalb der Funktionentheorie dagegen ist der Begriff der Transformation von Gruppen von entscheidender Bedeutung, und der Musiker wird bestätigen, daß analoge Bildungen einen wesentlichen Teil der neueren Kompositionslehre ausmachen. Ich erinnere nur an eine der feinsten instrumentalen Formen des 18. Jahrhunderts, das „tema con variazioni“.
Jede Proportion setzt die Konstanz, jede Transformation die Variabilität der Elemente voraus: man vergleiche hier die Kongruenzsätze bei Euklid, deren Beweis tatsächlich auf dem vorliegenden Verhältnis 1 : 1 beruht, mit deren moderner Ableitung mit Hilfe der Winkelfunktionen.
Die Konstruktion — die im weiteren Sinne alle Methoden der elementaren Arithmetik einschließt — ist das A und[S. 123] O der antiken Mathematik: die Herstellung eines einzelnen und sichtbar vorliegenden Objekts. Der Zirkel ist der Meißel dieser zweiten bildenden Kunst. Die Arbeitsweise bei funktionstheoretischen Untersuchungen, deren Zweck kein Resultat vom Charakter einer Größe, sondern die Diskussion allgemeiner formaler Möglichkeiten ist, läßt sich als eine Art Kompositionslehre von naher Verwandtschaft zur musikalischen bezeichnen. Eine ganze Reihe von Begriffen der Musiktheorie ließe sich ohne weiteres auf analytische Operationen auch der Physik anwenden — Tonart, Phrasierung, Chromatik und andere — und es ist die Frage, ob nicht manche Beziehungen dadurch an Übersichtlichkeit gewinnen würden.
Jede Konstruktion bejaht, jede Operation verneint den Augenschein, indem jene das optisch Gegebene herausarbeitet, diese es auflöst. So erscheint ein weiterer Gegensatz in den beiden Arten des mathematischen Verfahrens: die antike Mathematik des Kleinen betrachtet den konkreten Einzelfall, berechnet die bestimmte Aufgabe, führt die einmalige Konstruktion aus. Die Mathematik des Unendlichen behandelt ganze Klassen formaler Möglichkeiten, Gruppen von Funktionen, Operationen, Gleichungen, Kurven, und zwar überhaupt nicht hinsichtlich irgendeines Resultates, sondern hinsichtlich ihres Verlaufes. Es ist so seit zwei Jahrhunderten — was den Mathematikern der Gegenwart kaum zum Bewußtsein kommt — die Idee einer allgemeinen Morphologie mathematischer Operationen entstanden, welche man als den eigentlichen Sinn der gesamten neueren Mathematik bezeichnen darf. Es offenbart sich hier eine umfassende Tendenz abendländischer Geistigkeit überhaupt, die im folgenden immer deutlicher werden wird, eine Tendenz, die ausschließlich Eigentum des faustischen Geistes und seiner Kultur ist und in keiner andern verwandte Absichten findet. Die große Mehrzahl der Fragen, welche unsere Mathematik als deren eigenste Probleme beschäftigen — der Quadratur des Kreises bei den Griechen entsprechend — wie die Untersuchung der Konvergenzkriterien unendlicher Reihen (Cauchy) oder die Umkehrung elliptischer und allgemein algebraischer Integrale zu mehrfach periodischen Funktionen (Abel, Gauß) wäre den „Alten“, die einfache bestimmte Größen als[S. 124] Resultate suchten, vermutlich als eine geistreiche, etwas abstruse Spielerei erschienen — was dem populären Urteil weiter Kreise auch heute durchaus entsprechen würde. Es gibt nichts Unpopuläreres als die moderne Mathematik, und auch darin liegt ein Stück Symbolik der unendlichen Ferne, der Distanz. Alle großen Werke des Abendlandes von Dante bis zum Parsifal sind unpopulär, alle antiken von Homer bis zum pergamenischen Altar sind populär im höchsten Grade.
Und so sammelt sich endlich der ganze Gehalt des abendländischen Zahlendenkens in einem klassischen Problem, das den Schlüssel zu jenem schwer zugänglichen Begriff des Unendlichen — des faustisch Unendlichen — bildet, welches von der Unendlichkeit des arabischen und indischen Weltgefühls weit entfernt bleibt. Es handelt sich um die Theorie des Grenzwertes, möge die Zahl im einzelnen als unendliche Reihe, Kurve oder Funktion enger gefaßt sein. Dieser Grenzwert ist das strengste Gegenteil des antiken, bisher nicht so genannten, der sich in einer starr begrenzten Fläche von meßbarer Größe darstellt. Bis ins 18. Jahrhundert haben euklidisch-populäre Vorurteile den Sinn des Differentialprinzips verdunkelt. Mag man den zunächst naheliegenden Begriff des unendlich Kleinen noch so vorsichtig anwenden, es haftet ihm ein leises Moment antiker Konstanz an, der Anschein einer Größe, wenn auch Euklid sie als solche nicht erkannt, anerkannt haben würde. Die Null ist eine Konstante, eine ganze Zahl im linearen Kontinuum zwischen +1 und −1; es hat Eulers analytischen Untersuchungen geschadet, daß er — wie viele nach ihm — die Differentiale für Nullen hielt. Erst der von Cauchy endgültig aufgeklärte Begriff des Grenzwertes beseitigt diesen Rest antiken Zahlengefühls und macht die Infinitesimalrechnung zu einem widerspruchslosen System. Erst der Schritt von der „unendlich kleinen Größe“ zu dem „untern Grenzwert jeder möglichen endlichen Größe“ führt zur Konzeption einer veränderlichen Zahl, die unterhalb jeder von Null verschiedenen endlichen Größe sich bewegt, selbst also nicht den geringsten[S. 125] Zug einer Größe mehr trägt. Der Grenzwert in dieser endgültigen Fassung ist überhaupt nicht mehr das, was angenähert wird. Er stellt die Annäherung — den Prozeß, die Operation — selbst dar. Er ist kein Zustand, sondern ein Verhalten. Hier, im entscheidenden Problem der abendländischen Mathematik, verrät sich plötzlich, daß unser Seelentum ein historisch angelegtes ist.[31]
Die Geometrie von der Anschauung, die Algebra vom Begriff der Größe zu befreien und beide jenseits der elementaren Schranken von Konstruktion und Rechnung zu dem mächtigen Gebäude der Funktionstheorie zu vereinigen, das war der große Weg des abendländischen Zahlendenkens. So wurde die antike, konstante Zahl zur veränderlichen aufgelöst. Die analytisch gewordene Geometrie löste alle konkreten Formen auf. Sie ersetzt den mathematischen Körper, an dessen starrem Bilde geometrische Werte gefunden werden, durch abstrakt räumliche Beziehungen, die zuletzt auf Tatsachen der sinnlich-gegenwärtigen Anschauungen überhaupt nicht mehr anwendbar sind. Sie ersetzt zunächst die optischen Gebilde Euklids durch geometrische Örter in bezug auf ein Koordinatensystem, dessen Anfangspunkt willkürlich gewählt werden kann, und reduziert das gegenständliche Dasein des geometrischen Objekts auf die Forderung, daß während der Operation, die sich nicht mehr auf Messungen, sondern auf Gleichungen richtet, das gewählte System nicht verändert werden darf. Alsbald werden aber die Koordinaten nur noch als reine Werte aufgefaßt, welche die Lage der Punkte als abstrakter Raumelemente nicht sowohl bestimmen, als repräsentieren und ersetzen. Die Zahl, die Grenze des Gewordnen, wird nicht mehr durch das Bild einer Figur, sondern durch das Bild einer Gleichung symbolisch dargestellt. Die „Geometrie“ kehrt ihren Sinn um: das Koordinatensystem als Bild verschwindet, und der Punkt ist nunmehr eine vollkommen abstrakte Zahlengruppe. Wie die Architektur der[S. 126] Renaissance durch die konstruktiven Neuerungen Michelangelos und Vignolas in die des Barock übergeht — das ist das genaue Abbild dieser innern Wandlung der Analysis. An den Palast- und Kirchenfassaden werden die sinnlich reinen Linien unwirklich. An Stelle der klaren Koordinaten florentinisch-römischer Säulenstellungen und Geschoßgliederungen tauchen die „infinitesimalen“ Elemente geschwungener, flutender Bauteile, Voluten, Kartuschen auf. Die Konstruktion verschwindet in der Fülle des Dekorativen — mathematisch gesprochen des Funktionalen; Säulen und Pilaster, in Gruppen und Bündel zusammengefaßt, durchziehen ohne Ruhepunkte für das Auge die Fronten, sammeln und zerstreuen sich; die Flächen der Wände, Decken, Geschosse lösen sich in der Flut von Stukkaturen und Ornamenten auf, verschwinden und zerfallen unter farbigen Lichtwirkungen. Das Licht aber, das nun über dieser Formwelt des reifen Barock spielt — von Bernini um 1650 an bis zum Rokoko in Dresden, Wien, Paris —, ist ein rein musikalisches Element geworden. Der Dresdner Zwinger ist eine Sinfonie. Mit der Mathematik hat sich im 18. Jahrhundert auch die Architektur zu einer Formenwelt von musikalischem Charakter entwickelt.
Auf dem Wege dieser Mathematik mußte endlich der Augenblick auftreten, wo nicht nur die Grenzen künstlicher geometrischer Gebilde, sondern die Grenzen des Sehsinnes überhaupt seitens der Theorie wie der Seele selbst in ihrem Drange nach rückhaltlosem Ausdruck ihrer innern Möglichkeiten als Grenzen, als Hindernis empfunden wurden, wo also das Ideal transzendenter Ausgedehntheit zu den beschränkten Möglichkeiten des unmittelbaren Augenscheins in grundsätzlichen Widerspruch trat. Die antike Seele, welche mit der vollen Hingabe der platonischen und stoischen ἀταραξία das Sinnliche gelten und walten ließ und ihre großen Symbole, wie es der erotische Hintersinn der pythagoräischen Zahlen beweist, eher empfing als gab, konnte auch das körperliche Jetzt und Hier niemals überschreiten wollen. Hatte sich aber die pythagoräische Zahl im Wesen gegebener Einzeldinge in der Natur offenbart, so[S. 127] war die Zahl des Descartes und der Mathematiker nach ihm etwas, das erobert und erzwungen werden mußte, eine herrische abstrakte Beziehung, unabhängig von aller sinnlichen Gegebenheit und jederzeit bereit, diese Unabhängigkeit der Natur gegenüber geltend zu machen. Der Wille zur Macht — um Nietzsches große Formel zu gebrauchen —, der von der frühesten Gotik der Edda, der Kathedralen und Kreuzzüge, ja von den erobernden Wikingern und Goten an das Verhalten der nordischen Seele ihrer Welt gegenüber bezeichnet, liegt auch in dieser Energie der abendländischen Zahl gegenüber der Anschauung. Das ist „Dynamik“. In der apollinischen Mathematik dient der Geist dem Auge, in der faustischen überwindet er es.
Der mathematische, „absolute“, so gänzlich unantike Raum selbst war von Anfang an, was die Mathematik in ihrer Ehrfurcht vor hellenischen Traditionen nicht zu bemerken wagte, nicht die vage Räumlichkeit der täglichen Eindrücke, der landläufigen Malerei, der vermeintlich so eindeutigen und gewissen apriorischen Anschauung Kants, sondern ein reines Abstraktum, ein ideales und unerfüllbares Postulat einer Seele, der die Sinnlichkeit als Mittel des Ausdruckes immer weniger genügte und die sich endlich leidenschaftlich von ihr abwandte. Das innere Auge erwachte.
Jetzt erst mußte es tiefen Denkern fühlbar werden, daß die euklidische Geometrie, die einzige und richtige für den naiven Blick aller Zeiten, von diesem hohen Standpunkt aus betrachtet nichts als eine Hypothese ist, deren Alleingültigkeit gegenüber anderen, auch ganz unanschaulichen Arten von Geometrien, wie wir seit Gauß bestimmt wissen, sich niemals beweisen läßt, von der vielberufenen „Übereinstimmung“ mit der Wirklichkeit, diesem Laiendogma, das durch jeden Blick in die Ferne — wo alle Parallelen einander berühren — widerlegt wird, zu schweigen. Der Kernsatz dieser Geometrie, das Parallelenaxiom Euklids, ist eine Behauptung, die sich durch andere ersetzen läßt, daß es nämlich durch einen Punkt zu einer Geraden keine, zwei oder viele Parallelen gibt, Behauptungen, die sämtlich zu vollkommen widerspruchslosen dreidimensionalen geometrischen Systemen führen, die in der Physik[S. 128] und vor allem der Astronomie angewendet werden können und zuweilen den euklidischen vorzuziehen sind.
Schon die einfache Forderung der Unbegrenztheit des Ausgedehnten — die man seit Riemann und dessen Theorie unbegrenzter, aber infolge ihrer Krümmung nicht unendlicher Räume eben von der Unendlichkeit zu scheiden hat — widerspricht dem eigentlichen Charakter aller unmittelbaren Anschauung, welche von dem Vorhandensein von Lichtwiderständen, also materiellen Grenzen abhängt. Es sind aber abstrakte Prinzipien der Grenzsetzung denkbar, die in einem ganz neuen Sinne die Möglichkeiten optischer Begrenzung überschreiten. Für den Tieferblickenden liegt schon in der kartesischen Geometrie die Tendenz, über die drei Dimensionen des erlebten Raumes als einer für die Symbolik der Zahlen nicht notwendigen Schranke hinauszugehen. Und wenn auch erst seit 1800 etwa die Vorstellung mehrdimensionaler Räume — man hätte das Wort besser durch ein neues ersetzt — zur erweiterten Grundlage des analytischen Denkens wurde, so war doch der erste Schritt dazu in dem Augenblick getan, wo die Potenzen, eigentlicher die Logarithmen, von ihrer ursprünglichen Beziehung auf sinnlich realisierbare Flächen und Körper abgelöst und — unter Verwendung irrationaler und komplexer Exponenten — als Beziehungswerte von ganz allgemeiner Art in das Gebiet des Funktionalen eingeführt wurden. Wer hier überhaupt folgen kann, wird auch begreifen, daß schon mit dem Schritt von der Vorstellung a3, als einem natürlichen Maximum, zu an die Unbedingtheit eines Raumes von drei Dimensionen aufgehoben ist.
Nachdem einmal das Raumelement des Punktes den immerhin noch optischen Charakter eines Koordinatenschnittes in einem anschaulich vorstellbaren System verloren hatte und als Gruppe dreier unabhängiger Zahlen definiert worden war, lag kein inneres Hindernis mehr vor, die Zahl 3 durch die allgemeine n zu ersetzen. Es tritt eine Umkehrung des Dimensionsbegriffes ein: Es bezeichnen nicht mehr Maßzahlen optische Eigenschaften eines Punktes hinsichtlich seiner Lage in einem System, sondern Dimensionen von unbeschränkter Anzahl stellen vollkommen abstrakte Eigenschaften einer Zahlengruppe dar. Diese Zahlengruppe — von n unabhängigen geordneten Elementen —[S. 129] ist das Bild des Punktes; sie heißt ein Punkt. Eine daraus logisch entwickelte Gleichung heißt Ebene, ist das Bild einer Ebene. Der Inbegriff aller Punkte von n Dimensionen heißt ein n-dimensionaler Raum.[32] In diesen transzendenten Raumwelten, die zu keiner wie immer gearteten Sinnlichkeit mehr in Beziehung stehen, herrschen die von der Analysis aufzufindenden Beziehungen, welche sich mit den Ergebnissen der experimentellen Physik in ständiger Übereinstimmung befinden. Diese Räumlichkeit höheren Ranges ist ein Symbol, das durchaus Eigentum des abendländischen Geistes bleibt. Nur dieser Geist hat das Gewordene und Ausgedehnte in diese Formen zu bannen, das Fremde durch diese Art der Aneignung — man erinnere sich des Begriffes „tabu“ — zu beschwören, zu zwingen, mithin zu „erkennen“ versucht und verstanden. Erst in dieser Sphäre des Zahlendenkens, die nur einem sehr kleinen Kreis von Menschen noch zugänglich ist — aber das gilt auch von den tiefsten Momenten unserer Musik, unserer Malerei, unserer Dogmatik —, erhalten selbst Bildungen wie die Systeme der hyperkomplexen Zahlen (etwa die Quaternionen der Vektorenrechnung) und zunächst ganz unverständliche Zeichen wie ∞n den Charakter von etwas Wirklichem. Man hat eben zu begreifen, daß Wirklichkeit nicht nur sinnliche Wirklichkeit ist, daß vielmehr das Seelische seine Idee in noch ganz anderen als anschaulichen Bildungen verwirklichen kann.
Aus dieser großartigen Intuition symbolischer Raumwelten folgt die letzte und abschließende Fassung der gesamten abendländischen Mathematik, die Erweiterung und Vergeistigung der Funktionentheorie zur Gruppentheorie. Gruppen sind Mengen oder Inbegriffe gleichartiger mathematischer Gebilde, also z. B. die Gesamtheit aller Differentialgleichungen von einem gewissen[S. 130] Typus, Mengen, die dem Dedekindschen Zahlenkörper analog gebaut und geordnet sind. Es handelt sich, wie man fühlt, um Welten ganz neuer Zahlen, die für das innere Auge des Eingeweihten doch nicht ganz ohne eine gewisse Sinnlichkeit sind. Es werden nun Untersuchungen gewisser Elemente dieser ungeheuer abstrakten Formsysteme notwendig, welche in bezug auf eine einzelne Gruppe von Operationen — von Transformationen des Systems — von deren Wirkungen unabhängig bleiben, Invarianz besitzen. Die allgemeine Aufgabe dieser Mathematik erhält also (nach Klein) die Form: „Es ist eine n-dimensionale Mannigfaltigkeit („Raum“) und eine Gruppe von Transformationen gegeben. Die der Mannigfaltigkeit angehörigen Gebilde sollen hinsichtlich solcher Eigenschaften untersucht werden, die durch Transformationen der Gruppe nicht geändert werden.“
Auf diesem höchsten Gipfel schließt nunmehr — nach Erschöpfung ihrer sämtlichen inneren Möglichkeiten und nachdem sie ihre Bestimmung, Abbild und reinster Ausdruck der Idee des faustischen Seelentums zu sein, erfüllt hat — Mathematik des Abendlandes ihre Entwicklung ab, in demselben Sinne, wie es die Mathematik der antiken Kultur im 3. Jahrhundert tat. Beide Wissenschaften — es sind die einzigen, deren organische Struktur sich heute schon historisch durchschauen läßt — sind aus der Konzeption einer völlig neuen Zahl durch Pythagoras und Descartes entstanden, beide haben in prachtvollem Aufschwung ein Jahrhundert später ihre Reife erlangt und beide vollendeten nach einer Blüte von drei Jahrhunderten das Gebäude ihrer Ideen, in derselben Epoche, durch welche die Kultur, der sie angehören, in eine weltstädtische Zivilisation überging. Dieser tiefbedeutsame Zusammenhang wird später aufgeklärt werden. Sicher ist, daß für uns die Zeit der großen Mathematiker vorüber ist. Es ist heute dieselbe Arbeit des Erhaltens, Abrundens, Verfeinerns, Auswählens, die talentvolle Kleinarbeit an Stelle der großen Schöpfungen im Gange, wie sie auch die alexandrinische Mathematik des spätem Hellenismus kennzeichnet.
Ein historisches Schema wird dies deutlicher machen:
[S. 131]
|
Antike
|
Abendland
|
|
1. Konzeption einer neuen
Zahl.
|
|
|
um 540
Die Zahl als Größe Die Pythagoräer (Um 470 Sieg der Plastik über die Freskomalerei) |
um 1630
Die Zahl als Beziehung Descartes, Fermat, Pascal; Newton, Leibniz (1670) (Um 1670 Sieg der Musik über die Ölmalerei) |
|
2. Höhepunkt der
systematischen Entwicklung.
|
|
|
430–350
Archytas, Plato, Eudoxos (Phidias, Praxiteles) |
1750–1800
Euler, Lagrange, Laplace (Haydn, Mozart) |
|
3. Innerer Abschluß der
Zahlenwelt.
|
|
|
300–250
Euklid, Apollonius, Archimedes (Lysippos, Leochares) |
nach 1800
Gauß, Cauchy, Riemann (Beethoven) |
[25] Von der periodischen Unterbrechung durch den Schlaf soll hier abgesehen werden.
[26] Siehe die vorangehenden Tafeln 1–3.
[27] Alexandria hört im 2. Jahrhundert n. Chr. auf, Weltstadt zu sein und wird eine aus der Zeit antiker Zivilisation stehen gebliebene Häusermasse, in der eine primitiv fühlende, seelisch anders geartete Bevölkerung haust. Das hier vorliegende Phänomen wird später behandelt werden.
[28] Vom „Namenzauber“ der Wilden bis zur modernsten Wissenschaft, welche sich ihre Objekte unterwirft, indem sie Namen, Begriffe und Definitionen für sie prägt, hat sich der Form nach nichts geändert.
[29] In der modernen Astronomie wird die Verwendung nicht euklidischer Geometrien ernstlich erwogen. Die Annahme eines unbegrenzten, aber endlichen, gekrümmten Raumes, den das Sternensystem mit einem Durchmesser von etwa 470 Millionen Erdabständen füllt, würde zur Annahme eines Gegenbildes der Sonne führen, das uns als Stern mittlerer Helligkeit erscheint.
[30] Daß durch einen Punkt zu einer Geraden nur eine Parallele möglich sei, ein Satz, der sich nicht beweisen läßt.
[31] „Funktion, recht begriffen, ist das Dasein in Tätigkeit gedacht“ (Goethe).
[32] Vom Standpunkt der Mengenlehre aus heißt eine wohlgeordnete Punktmenge, ohne Rücksicht auf die Dimensionenzahl, ein Körper, eine Menge von n - 1 Dimensionen also im Verhältnis dazu eine Fläche. Die „Begrenzung“ (Wand, Kante) einer Punktmenge stellt eine Punktmenge von geringerer Mächtigkeit dar.
[S. 133]
[S. 135]
Es ist jetzt endlich möglich, den entscheidenden Schritt zu tun und ein Bild der Geschichte zu entwerfen, das nicht mehr vom zufälligen Standort des Betrachters in irgendeiner — seiner — „Gegenwart“ und von seiner Eigenschaft als interessiertem Gliede einer einzelnen Kultur abhängig ist, deren religiöse, geistige, politische, soziale Tendenzen ihn verführen, das historische Material aus einer zeitlich beschränkten Perspektive anzuordnen und dem Organismus des Geschehens damit eine willkürliche und an der Oberfläche haftende Form aufzudrängen, die ihm innerlich fremd ist.
Was bisher fehlte, war die Distanz vom Objekt. Der Natur gegenüber war sie längst erreicht. Allerdings war sie hier auch leichter erreichbar. Der Physiker konstruiert mit Selbstverständlichkeit das mechanisch-kausale Bild seiner Welt so, als ob er selbst gar nicht da wäre.
Aber in der Formenwelt der Historie ist dasselbe möglich. Wir haben das nur bis jetzt nicht gewußt. Man darf deshalb vielleicht sagen, und man wird es später einmal tun, daß es an einer wirklichen Geschichtsschreibung faustischen Stils überhaupt gefehlt hat, einer solchen nämlich, die Distanz genug besitzt, um im Gesamtbilde der Weltgeschichte auch die Gegenwart — die es ja nur in bezug auf eine einzige von unzähligen menschlichen Generationen ist — wie etwas unendlich Fernes und Fremdes zu betrachten, als eine Epoche, die nicht schwerer wiegt als alle andern, ohne den Maßstab irgendwelcher Ideale, ohne Bezug auf sich selbst, ohne Wunsch, Sorge und persönliche innere Beteiligung, wie sie das praktische Leben in[S. 136] Anspruch nimmt; eine Distanz also, die — mit Nietzsche zu reden, der bei weitem nicht genug von ihr besaß — es erlaubt, das ganze Phänomen der historischen Menschheit wie mit dem Auge eines Gottes zu überblicken, wie die Gipfelreihe eines Gebirges am Horizont, als ob man selbst gar nicht zu ihr gehörte.
Hier war noch einmal die Tat des Kopernikus zu vollbringen, jener Akt der Befreiung vom Augenschein im Namen des unendlichen Raumes, den der abendländische Geist der Natur gegenüber längst vollzogen hatte, als er vom ptolemäischen Weltsystem zu dem für ihn heute allein gültigen überging und damit den zufälligen Standort des Betrachters auf einem einzelnen Planeten als formbestimmend ausschaltete.
Die Weltgeschichte ist derselben Ablösung von einem zufälligen Beobachtungsorte — der jeweiligen „Neuzeit“ — fähig und bedürftig. Uns erscheint das 19. Jahrhundert unendlich viel reicher und wichtiger als etwa das 19. vor Christus, aber auch der Mond erscheint uns größer als Jupiter und Saturn. Der Physiker hat sich vom Vorurteil der relativen Entfernung längst befreit, der Historiker nicht. Wir erlauben uns, die Kultur der Griechen als Altertum, relativ zu unserer Neuzeit, zu bezeichnen. War sie das auch für die feinen und historisch hochgebildeten Ägypter am Hofe des großen Thutmosis — ein Jahrtausend vor Homer? Für uns füllen die Ereignisse, die sich 1500–1800 auf dem Boden Westeuropas abspielen, das wichtigste Drittel „der“ Weltgeschichte. Für den chinesischen Historiker, der auf 6000 Jahre chinesischer Geschichte zurückblickt und von ihr aus urteilt, sind sie eine kurze und wenig bedeutende Episode, nicht entfernt so schwerwiegend wie z. B. die Jahrhunderte der Handynastie (206 v. bis 220 n. Chr.), die in seiner Weltgeschichte Epoche machen.
Die Geschichte also von den persönlichen Vorurteilen des Betrachters zu lösen, der sie in unserem Falle wesentlich zur Geschichte eines Fragments des Vergangenen mit dem in Westeuropa fixierten Zufällig-Gegenwärtigen als Ziel und den augenblicklichen öffentlichen Idealen und Interessen als Wertmessern für die Entwicklung des Erreichten und zu Erreichenden macht — das ist die Absicht alles Folgenden.
[S. 137]
Erinnern wir uns der grundlegenden Tatsache des wachen Bewußtseins, aus dem heraus ein geordnetes Weltbild im Sinne von Natur oder Geschichte überhaupt erst möglich wird. Mit den Worten Seele und Welt war der Urgegensatz bezeichnet worden, dessen Vorhandensein mit der Tatsache des menschlichen Tagesbewußtseins völlig identisch ist. Seele und Welt wurden im Hinblick auf die in jedem einzelnen und in jeder Kultur liegende Idee des Daseins das Mögliche und das Wirkliche genannt, um das Phänomen des Lebens als der Verwirklichung dieses Möglichen und das ihm innewohnende Merkmal der Richtung vor Augen stellen zu können.
Danach ist für jeden seine Welt verwirklichtes Seelentum, Ausdruck, Zeichen, Bild der Idee seines individuellen Daseins. „Jeder spricht nur sich selbst aus, indem er von der Natur spricht“ (Goethe). Diese Wirklichkeit darf auf der seelischen Stufe des Urmenschen und des Kindes noch als verschleiert, chaotisch, als noch nicht entfaltet, als im tieferen Sinne formlos angenommen werden. In den höheren Zuständen menschlichen Daseins ist sie exakter Fassungen fähig, deren Skala zwischen den Extremen reinsten Anschauens und reinsten Erkennens eine unbegrenzte Menge nie sich genau wiederholender Strukturen zuläßt. „Die Welt“ ist für jeden einzelnen sein eigenstes, einmaliges, notwendiges und durchaus willenloses Erlebnis. Schopenhauer nannte es die Welt als Vorstellung, aber er setzte die Konstanz dieser Vorstellung und ihre Identität für alle Menschen als selbstverständlich voraus.
Natur und Geschichte: so stehen zwei extreme Arten, die Wirklichkeit als Weltbild zu ordnen, einander gegenüber. Eine Wirklichkeit ist Natur, insofern sie alles Werden dem Gewordnen, sie ist Geschichte, insofern sie alles Gewordne dem Werden einordnet. Eine Wirklichkeit wird in ihrer Gestalt erschaut — so entsteht die Welt Platos, Rembrandts, Goethes, Beethovens — oder in ihrem Element begriffen — dies sind die Welten von Parmenides und Descartes, Kant und Newton. Erkennen im prägnanten Sinne des Wortes ist derjenige Erlebnisakt, dessen vollzogenes Resultat „Natur“ heißt. Erkanntes[S. 138] und Natur sind identisch. Alles Erkannte ist, wie das Symbol der mathematischen Zahl bewies, gleichbedeutend mit dem mechanisch Begrenzten, Gesetzten. Natur ist der Inbegriff des gesetzlich Notwendigen. Es gibt nur Naturgesetze. Kein Physiker, der seine Bestimmung begreift, wird über diese Grenze hinausgehen wollen. Seine Aufgabe ist, die Gesamtheit, das wohlgeordnete System aller Gesetze festzustellen, die im Bilde der Natur auffindbar sind, mehr noch, die das Bild der Natur erschöpfend und ohne Rest darstellen.
Andrerseits: Anschauen — ich erinnere an das Wort Goethes: „Das Anschauen ist vom Ansehen sehr zu unterscheiden“ — ist derjenige Erlebnisakt, der, als Phänomen, indem er sich vollzieht, selbst Geschichte ist. Erlebtes ist Geschehenes, ist Geschichte.
Alles Geschehen ist einmalig und nie sich wiederholend. Es unterliegt dem Prinzip der Richtung (der „Zeit“), der Nichtumkehrbarkeit. Das Geschehene, als nunmehr Gewordnes dem Werden, als Erstarrtes dem Lebendigen entgegengesetzt, gehört unwiderruflich der Vergangenheit an. Das Gefühl hiervon ist die Weltangst. Alles Erkannte aber ist zeitlos, weder vergangen noch zukünftig, von dauernder Gültigkeit. Dies gehört zur innern Beschaffenheit des Naturgesetzlichen. Das Gesetz, das Gesetzte, ist antihistorisch. Es schließt den Zufall aus. Naturgesetze sind Formen anorganischer Notwendigkeit. Es wird klar, weshalb Mathematik als die Ordnung des Gewordnen durch die Zahl sich immer auf Gesetze und Kausalität und nur auf sie bezieht.
Das Werden „hat keine Zahl“. Nur Lebloses kann gezählt, gemessen, zerlegt werden. Das reine Werden, das Leben ist in diesem Sinne grenzenlos. Es liegt jenseits des Bereiches von Ursache und Wirkung, Gesetz und Maß. Keine tiefe und echte Geschichtsforschung wird nach kausaler Gesetzlichkeit forschen; andernfalls hat sie ihr eigentliches Wesen nicht begriffen.
Indes: Geschichte ist kein reines Werden; sie ist nur ein Weltbild, eine vom einzelnen ausstrahlende Weltform, in der das Werden das Gewordne beherrscht. Auf dem Gehalt an Gewordenem beruht die Möglichkeit, ihr wissenschaftlich etwas abzugewinnen. Und je höher dieser Gehalt ist, desto[S. 139] mechanischer, desto verstandesmäßiger, desto kausaler erscheint sie. Auch Goethes „lebendige Natur“, ein völlig unmathematisches Weltbild, hatte noch so viel Gehalt an Totem und Starrem, daß er sie wissenschaftlich behandeln konnte. Sinkt dieser Gehalt sehr tief, ist sie beinahe nur reines Werden, so haben wir eine echte Vision vor uns, die nur noch Arten künstlerischer Rezeption gestattet. Was Dante als Welthistorie vor seinem geistigen Auge sah, hätte er nicht wissenschaftlich realisieren können, auch Goethe nicht, was er in den Momenten seiner Faustentwürfe sah, ebensowenig Plotin und Giordano Bruno. Hier liegt die wichtigste Ursache des Streites um die Struktur der Geschichte. Vor demselben Objekt, vor demselben Tatsachenmaterial hat doch jeder Betrachter seiner Anlage nach einen anderen Eindruck des Ganzen, ungreifbar und nicht mitteilbar, der seiner Denkart zugrunde liegt und ihr die spezifische persönliche Farbe gibt. Der Grad von Gewordnem wird bei zwei Menschen immer verschieden sein, Grund genug, daß sie sich niemals über das Thema und die Methode verständigen können. Jeder gibt dem Mangel an Denken bei dem andern Schuld, und doch ist das mit diesem Wort bezeichnete Etwas, worüber niemand Gewalt hat, kein Schlechtersein, sondern ein notwendiges Anderssein. Dasselbe gilt von aller Naturwissenschaft.
Aber man halte fest: Geschichte wissenschaftlich behandeln wollen ist im letzten Grunde immer etwas Widerspruchsvolles und deshalb ist jede pragmatische Geschichtsschreibung, sie sei so groß wie sie wolle, ein Kompromiß. Natur soll man wissenschaftlich traktieren, über Geschichte soll man dichten. Alles andere sind unreine Lösungen — aus denen allerdings die große Mehrzahl aller Geistesprodukte besteht.
Auf der andern Seite, dort, wo das Reich der Zahlen und des exakten Wissens herrschen sollte, hatte Goethe „lebendige Natur“ gerade das genannt, was ein unmittelbares Anschauen des reinen Werdens und Sichgestaltens, mithin im hier festgelegten Sinne Geschichte war. Seine Welt war zunächst ein Organismus, ein Wesen, und man begreift, daß seine Forschungen, selbst wenn sie ein äußerlich physikalisches Gepräge tragen, weder Zahlen noch Gesetze noch eine in Formeln gebannte[S. 140] Kausalität bezwecken, daß sie vielmehr Morphologie im höchsten Sinne sind und damit das spezifisch abendländische (und sehr unantike) Mittel aller kausalen Betrachtung, das messende Experiment, vermeiden, es aber auch nirgends vermissen lassen. Seine Betrachtung der Erdoberfläche ist stets Geologie, nie Mineralogie (die er die Wissenschaft von etwas Totem nannte).
Es sei noch einmal gesagt: Es gibt keine genaue Grenze zwischen beiden Arten der Weltfassung. So sehr Werden und Gewordnes Gegensätze sind, so sicher ist in jedem Erlebnisakte beides vorhanden. Geschichte erlebt, wer beides als werdend, als sich vollendend, anschaut, Natur erkennt, wer beides als geworden, als vollendet, zergliedert.
Es liegt eine ursprüngliche Anlage in jedem Menschen, jeder Kultur, jeder Kulturstufe vor, eine ursprüngliche Neigung und Bestimmung, eine der beiden Formen als Ideal vorzuziehen. Der Mensch des Abendlandes ist in hohem Grade historisch gestimmt,[33] der antike Mensch war es um so weniger. Wir verfolgen alles Gegebene im Hinblick auf Vergangenheit und Zukunft, die Antike erkannte nur die punktförmige Gegenwart als seiend an. Der Rest wurde Mythus. Wir haben in jedem Takte unsrer Musik von Palestrina bis Wagner auch ein Symbol des Werdens vor uns, die Griechen in jeder ihrer Statuen ein Bild des Momentes. Der Rhythmus eines Körpers liegt im Augenblick, der Rhythmus einer Fuge im Verlauf.
So treten die Prinzipien der Gestalt und des Gesetzes vor uns hin als der beiden Grundformen aller Weltbildung. Je entschiedener ein Weltbild die Züge der Natur trägt, desto unumschränkter gilt in ihm das Gesetz und die Zahl. Je reiner[S. 141] eine Welt als ein ewig Werdendes angeschaut wird, desto zahlenfremder ist die ungreifbare Fülle ihrer Gestaltung. So unterscheidet sich hinsichtlich der Methode Goethes vielberufene „exakte sinnliche Fantasie“, die das Lebendige unberührt läßt,[34] von dem exakten, tötenden Verfahren der modernen Physik. Der Rest des andern Elements, den man immer finden wird, erscheint in der strengen Naturwissenschaft unter dem Phänomen nie zu vermeidender Theorien und Hypothesen, deren anschaulicher Gehalt alles starr Zahlenmäßige und Formelhafte füllt und trägt, in der Geschichtsforschung als Chronologie, jenes seltsame und doch nie als dunkles Rätsel empfundene Phänomen eines Zahlennetzes, das — als Kette von Jahreszahlen, als Statistik — die Gestaltenwelt umspinnt und durchdringt, ohne mit dem Charakter von mathematischen Zahlen etwas zu tun zu haben.
Noch etwas andres ist hier zu bemerken. Da ein Werden immer dem Gewordnen zugrunde liegt und Geschichte eine Ordnung des Weltbildes im Sinne des Werdens darstellt, so ist Geschichte die ursprüngliche und Natur eine späte, erst dem Menschen reifer Kulturen vollziehbare Weltform, nicht umgekehrt, zu welcher Annahme das Vorurteil des städtischen wissenschaftlichen Verstandes neigt. In der Tat ist die dunkle, urseelenhafte Umwelt der frühesten Menschheit, wovon heute noch ihre religiösen Gebräuche und Mythen zeugen, jene Welt voller Willkür, feindlicher Dämonen und launischer Mächte, durchaus ein lebendiges, ungreifbares, rätselhaft wogendes und unberechenbares Ganze. Mag man sie Natur nennen, so ist sie doch nicht unsre Natur, der starre Reflex eines wissenden Geistes. Diese Urwelt klingt als ein Stück längst vergangenen Menschentums nur in der Kinderseele und in den großen Künstlern noch manchmal an, inmitten einer strengen „Natur“, welche der Geist reifer Kulturen mit tyrannischer Nachdrücklichkeit um den einzelnen aufbaut. Hierin liegt der Grund für die gereizte Spannung zwischen wissenschaftlicher („moderner“) und künstlerischer („unpraktischer“) Weltanschauung, die jede Spätzeit kennt. Der Tatsachenmensch[S. 142] und der Dichter werden einander nie verstehen. Hier ist auch der Grund zu suchen, weshalb jede angestrebte Geschichtsforschung, die immer etwas von Kindheit und Traum, etwas Goethesches in sich tragen müßte, an der Gefahr vorüberstreift, eine bloße Physik des öffentlichen Lebens zu werden, „materialistisch“, wie sie sich selbst ahnungslos genannt hat.
„Natur“ im exakten Sinne ist die seltnere, auf den Menschen der großen Städte später Kulturen beschränkte, männliche, vielleicht schon greisenhafte Art, Wirklichkeit zu besitzen, Geschichte die naive und jugendliche, auch die unbewußtere, die der ganzen Menschheit eigen ist. So wenigstens steht die zahlenmäßige, geheimnislose Natur des Aristoteles und Kant, der Sophisten und Darwinisten, der modernen Physik, der erlebten, grenzenlosen, gefühlten Natur Homers und der Edda, des dorischen und gotischen Menschen gegenüber. Es heißt das Wesen aller Geschichtsbetrachtung verkennen, wenn man dies übersieht. Sie ist die eigentlich natürliche, die exakte, mechanisch geordnete Natur die künstliche Fassung der Seele ihrer Welt gegenüber. Trotzdem oder gerade deshalb ist dem modernen Menschen die Naturwissenschaft leicht, die Geschichtsbetrachtung schwer.
Regungen eines abstrakten, das heißt eben erzwungenen, künstlichen, dem naiven Seelentum fremden Denkens, dessen Tendenz ganz und gar auf mathematische Begrenzung, logische Unterscheidung, auf Gesetz und Kausalität hinausgeht, tauchen früh genug auf. Man findet sie in den ersten Jahrhunderten aller Kulturen, noch schwach, vereinzelt, noch in der Fülle des Trieblebens verschwindend. Ich nenne den Namen Roger Bacons. Sie nehmen bald einen strengeren Charakter an; es fehlt ihnen, wie allem geistig Erkämpften und von der menschlichen Natur ständig Bedrohten, das Herrische und Ausschließende nicht. Unvermerkt durchdringt das Reich des Räumlich-Begrifflichen — denn die Begriffe sind ihrem Wesen nach Zahlen, von rein quantitativer Beschaffenheit — die Außenwelt des Einzelnen, bewirkt in, mit und unter den schlichten Eindrücken der Sinnlichkeit einen mechanischen Zusammenhang kausaler und zahlengesetzlicher Art und unterwirft zu guter Letzt das wache Bewußtsein des großstädtischen[S. 143] Kulturmenschen — sei es im ägyptischen Theben oder in Babylon, in Benares, Alexandria oder in westeuropäischen Weltstädten — einem so anhaltenden Zwange des naturgesetzlichen Denkens, daß das Vorurteil aller Philosophie und Wissenschaft — denn es ist ein Vorurteil — kaum Widerspruch findet, dieser Zustand sei der menschliche Geist und sein alter ego, das mechanische Bild der Umwelt, sei die Welt. Aristoteles und Kant haben das Urteil sakrosankt gemacht. Plato und Goethe widerlegen es.
Die große Aufgabe der Welterkenntnis, wie sie dem Menschen hoher Kulturen ein Bedürfnis ist, eine Art Durchdringung seiner Existenz, die er sich und ihr schuldig zu sein glaubt, mag man ihre Lösung nun Wissenschaft oder Philosophie nennen, mag man ihre Verwandtschaft zu künstlerischer Schöpfung und gläubiger Intuition mit innerster Gewißheit fühlen oder bestreiten — diese Aufgabe ist sicherlich in jedem Falle die gleiche: die Formensprache des Weltbildes, das dem Dasein des einzelnen vorbestimmt ist, das er, solange er nicht vergleicht, für die Welt halten muß, in ihrer Reinheit darzustellen. Diese Auflösung der uns umgebenden Wirklichkeit in ihre — wie wir glauben — einfachen Elemente empfinden wir als die Lösung des Rätsels. Wir nennen sie Offenbarung, Entdeckung, Erkenntnis, Erfahrung und sind gewiß, mit ihr den Inhalt unseres Daseins bereichert, ein Stück von ihm vollendet zu haben.
Angesichts der Zweiheit von Natur und Geschichte kann diese Aufgabe eine doppelte sein. Beide reden ihre eigene, in jedem Betracht verschiedene Formensprache und in einem Weltbilde von unentschiedenem Charakter — wie es die Regel ist — können beide einander wohl überlagern und verwirren, sich aber niemals zur Einheit verbinden.
Richtung und Ausdehnung sind die Merkmale, durch die sich historische und naturhafte Welteindrücke unterscheiden. Der Mensch ist gar nicht imstande, beides gleichzeitig, im selben Augenblick entschieden in Wirkung zu setzen. Das Wort Ferne hat einen bezeichnenden Doppelsinn. Dort bedeutet es Zukunft,[S. 144] hier eine räumliche Distanz. Man wird bemerken, daß der historische Materialist die Zeit mit Notwendigkeit als Dimension empfindet. Für den geborenen Künstler sind umgekehrt, wie die Lyrik aller Völker beweist, landschaftliche Fernen, Wolken, der Horizont, die sinkende Sonne Eindrücke, die sich unbezwinglich mit dem Gefühl von etwas Künftigem verbinden. Der griechische Dichter verneint die Zukunft, folglich sieht, folglich besingt er dies alles nicht. Weil er ganz der Gegenwart angehört, so gehört er auch ganz der Nähe. Der Naturforscher, der produktive Verstandesmensch im eigentlichen Sinne, sei er Experimentator wie Faraday, Theoretiker wie Galilei oder Rechner wie Newton, findet in seiner Welt nur richtungslose Quantitäten, die er mißt, prüft und ordnet. Nur Quantitatives unterliegt der Fassung durch Zahlen, ist kausal determiniert, kann begrifflich zugänglich gemacht und gesetzlich formuliert werden. Damit sind die Möglichkeiten aller reinen Naturerkenntnis erschöpft. Alle Gesetze sind quantitative Zusammenhänge oder, wie der Physiker es ausdrückt, alle physikalischen Vorgänge verlaufen im Raume. Der antike Physiker würde diesen Ausdruck im Sinne des antiken raumverneinenden Weltgefühls, ohne die Tatsache zu ändern, dahin korrigiert haben, daß alle Vorgänge „unter Körpern stattfinden“.
Historischen Eindrücken ist alles Quantitative fremd. Ihr Organ ist ein andres. Die beiden Arten von Rezeption, welche der Welt als Natur und der Welt als Geschichte entsprechen, sind uns wohlbekannt, so wenig wir uns auch bis jetzt ihres Gegensatzes bewußt gewesen sind. Es gibt Naturerkenntnis und Menschenkenntnis. Es gibt wissenschaftliche Erfahrung und Lebenserfahrung. Man verfolge den Gegensatz bis in seine letzten Konsequenzen und man wird verstehen, was ich meine.
Alle Arten, die Welt zu begreifen, dürfen letzten Endes als Morphologie bezeichnet werden. Die Morphologie des Mechanischen und Ausgedehnten, eine Wissenschaft, die Naturgesetze und Kausalbeziehungen entdeckt und ordnet, heißt Systematik. Die Morphologie des Organischen, der Geschichte und des Lebens, alles dessen,[S. 145] was Richtung und Schicksal in sich trägt, heißt Physiognomik.
Je historischer ein Mensch veranlagt ist, desto mehr wird alles, was er begreift, mitteilt, bildet, physiognomischen Charakter tragen. Der hellenischen Statuenkunst lag alles Physiognomische fern, nicht weniger dem attischen Drama. Das hat der Klassizismus Winckelmanns und Lessings als das „Allgemein Menschliche“ mißverstanden. Goethe war in seiner Pflanzenlehre wie im Tasso, in seiner Lyrik wie im persönlichen Umgang ein Meister der Physiognomik.
Diese Art, die Welt zu sehen, hat in den letzten Stadien der abendländischen Zivilisation ihre große Zeit noch vor sich. In hundert Jahren werden alle Wissenschaften, die auf diesem Boden dann noch möglich sind, Bruchstücke einer einzigen ungeheuren Physiognomik alles Menschlichen sein. Das bedeutet „Morphologie der Weltgeschichte“. In jeder Wissenschaft, dem Ziel wie dem Stoffe nach, erzählt der Mensch sich selbst. Wissenschaftliche Erfahrung ist Selbsterkenntnis. Aus diesem Gesichtspunkte war soeben die Mathematik als Kapitel der Physiognomik behandelt worden. Nicht was der einzelne Mathematiker beabsichtigt, kam in Betracht. Der Fachmann als solcher mit seinen Tatsachen und Leistungen scheidet aus. Der Mathematiker als Mensch, dessen Wirksamkeit einen Teil seiner Erscheinung, dessen Wissen und Meinen einen Teil seiner Gebärde bildet, ist das Organ einer Kultur. Durch ihn redet sie von sich. Er gehört als Person, als Geist, entdeckend, erkennend, formend zu ihrer Physiognomie.
Jede Mathematik, die als wissenschaftliches System oder, wie im Falle Ägyptens, in Form einer Architektur die Idee einer Zahl allen sichtbar zur Erscheinung bringt, ist das Bekenntnis einer Seele. So gewiß ihre beabsichtigte Leistung nur der historischen Oberfläche angehört, so gewiß ist ihr Unbewußtes, die Zahl selbst als Urphänomen und der Stil ihrer Entwicklung zu einer abgeschlossenen Formenwelt, Ausdruck des Daseins, des Blutes. Ihre Lebensgeschichte, ihr Aufblühen[S. 146] und Verdorren, ihre tiefe Beziehung zu den bildenden Künsten, zu Mythen und Kulten derselben Kultur, das alles gehört zu einer noch kaum für möglich gehaltenen Morphologie der zweiten, der historischen Art.
Die sichtbare Außenseite aller Historie hat demnach dieselbe Bedeutung wie die äußere Erscheinung des einzelnen Menschen, Wuchs, Miene, Haltung, Gang, Sprache, Tätigkeit. Das alles ist für den Menschenkenner da. Der Leib, das Begrenzte, Gewordne, Vergängliche ist Ausdruck der Seele. Aber Menschenkenner sein bedeutet auch jene menschlichen Organismen größten Stils, die ich Kulturen nenne, kennen, ihre Miene, ihre Sprache, ihre Handlungen begreifen, wie man die eines einzelnen Menschen begreift. Geschichte als Philosoph schreiben heißt das tun, was Shakespeare tat, als er seine Tragödien einzelner Menschen schrieb.
Physiognomik ist die ins Geistige übersetzte Kunst des Porträts. Don Quijote, Werther, Julian Sorel sind die Porträts einer Epoche. Faust ist das Porträt einer ganzen Kultur. Der Naturforscher, der Morphologe als Systematiker, kennt das Porträt der Welt nur als imitative Aufgabe. Das bedeutet „Naturtreue“, „Ähnlichkeit“ für den malenden Handwerker, der im Grunde ganz mathematisch zu Werke geht. Ein echtes Porträt im Sinne Rembrandts ist Physiognomik, ist Historie. Die Reihe seiner Selbstbildnisse ist nichts andres als eine — echt Goethesche — Selbstbiographie. So soll die Biographie der großen Kulturen geschrieben werden. Der imitative Teil, die Arbeit des Fachhistorikers an Daten und Zahlen, ist nur Mittel, nicht Ziel. Zu den Zügen im Antlitz der Historie gehört alles, was man bis jetzt nur nach persönlichen Maßstäben, nach Nutzen und Schaden, Gut und Böse, Gefallen und Mißfallen zu werten verstanden hat, eine Staatsform wie eine Wirtschaftsform, Schlachten wie Künste, Wissenschaften wie Götter, Mathematik wie Moral. Alles, was überhaupt geworden ist, alles, was erscheint, ist Symbol, ist Ausdruck einer Seele. Es will mit dem Auge des Menschenkenners betrachtet, es will nicht in Gesetze gebracht, es will in seiner Bedeutung gefühlt werden. Und so erhebt sich die Untersuchung zu einer letzten und höchsten Gewißheit: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.
[S. 147]
Zur Naturerkenntnis kann man erzogen werden, der Geschichtskenner wird geboren. Er begreift und durchdringt mit einem Schlage, aus einem Gefühl heraus, das man nicht lernt, das jeder absichtlichen Einwirkung entzogen ist, das dem Willen nicht unterliegt, das in seinen höchsten Momenten sich selten genug einstellt. Zerlegen, definieren, ordnen, nach Ursache und Wirkung abgrenzen kann man, wenn man will. Das ist eine Arbeit, das andre ist eine Schöpfung. Gestalt und Gesetz, Gleichnis und Begriff, Symbol und Formel haben ein sehr verschiedenes Organ. Es ist das Verhältnis von Leben und Tod, von Zeugen und Zerstören, das hier erscheint. Der Verstand, der Begriff tötet, indem er „erkennt“. Er macht das Erkannte zum starren Gegenstand, der sich messen und teilen läßt. Das Anschauen beseelt. Es verleibt das Einzelne einer lebendigen, innerlich gefühlten Einheit ein. Dichten und Geschichtsforschung sind verwandt, Rechnen und Erkennen sind es auch. Aber — wie Hebbel einmal sagt: „Systeme werden nicht erträumt, Kunstwerke nicht errechnet oder, was dasselbe ist, erdacht.“ Der Künstler, der echte Historiker schaut, wie etwas wird. Er erlebt das Werden in den Zügen des Betrachteten noch einmal. Der Systematiker, sei er Physiker, Darwinist, oder schreibe er pragmatische Historie, erfährt, was geworden ist. Die Seele eines Künstlers ist wie die Seele einer Kultur etwas, das sich verwirklichen möchte, etwas vollständiges und vollkommenes, in der Sprache einer altern Philosophie: Mikrokosmos. Der Geist des Physikers, eine späte, engere und vorübergehende Erscheinung, gehört in die reifsten Stadien einer Kultur. Er ist an das Phänomen der Städte gebunden, in denen sich ihr Leben mehr und mehr zusammendrängt, und er verschwindet wieder mit ihnen. Antike Wissenschaft gibt es nur von den Ioniern des 6. Jahrhunderts an bis zur Römerzeit. Antike Künstler gibt es, solange es eine Antike gibt.
Ein Schema möge wieder zur Verdeutlichung dienen:
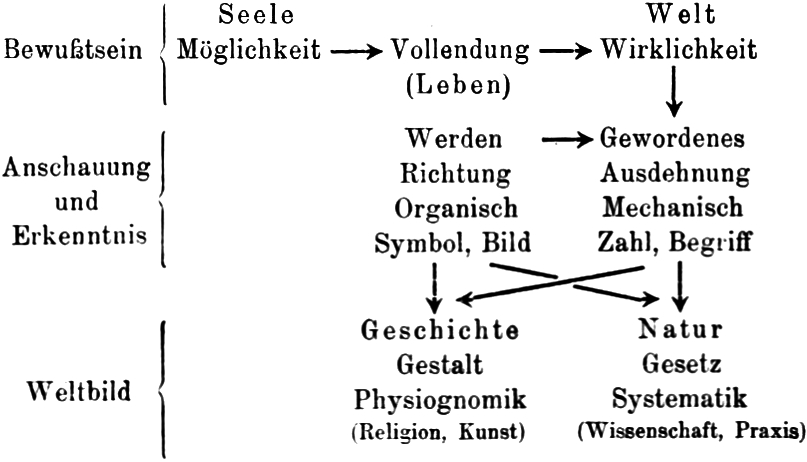
Versucht man sich über das Prinzip der Einheit klar zu werden, aus welcher jede der beiden Welten aufgefaßt wird, so findet man, daß mathematisch geregelte Erkenntnis, und zwar desto entschiedener, je reiner sie ist, sich durchaus auf ein beständig Gegenwärtiges bezieht. Das Bild der Natur, wie es der Physiker betrachtet, ist das augenblicklich vor seinen Sinnen sich entfaltende. Zu den meist verschwiegenen, aber um so festeren Voraussetzungen aller Naturforschung gehört die, daß die Natur für alle und zu allen Zeiten dieselbe sei. Ein Experiment entscheidet „für immer“. Wirkliche Geschichte aber beruht auf dem ebenso gewissen innern Gefühl des Gegenteils. Geschichte setzt als ihr Organ eine schwer zu beschreibende Art innerer Sinnlichkeit voraus, deren Eindrücke in unendlicher Wandlung begriffen sind, mithin in einem Zeitpunkte gar nicht zusammengefaßt werden können. (Von der vermeintlichen „Zeit“ der Physiker wird später die Rede sein.) Das Bild der Geschichte — sei es die der Menschheit, der Organismenwelt, der Erde, der Fixsternsysteme — ist ein Gedächtnisbild. Und zwar kann man die frühere Unterscheidung wiederholen und sagen, daß „Natur“ ein Weltbild sei, in welchem das Gedächtnis der Einheit des unmittelbar Sinnlichen unterworfen ist, „Geschichte“ dasjenige, in welchem das Gedächtnis die Eindrücke der Sinne sich einverleibt. Gedächtnis wird hier als ein höherer Zustand aufgefaßt, der durchaus nicht jeder Seele eigen und vielen nur in geringem Grade verliehen ist, eine Art Einbildungskraft, die jeden Augenblick sub specie aeternitatis, in steter Beziehung auf alles Vergangene und Zukünftige durchlebt werden läßt; es ist die Voraussetzung jeder[S. 149] Art von reflektierender Beschaulichkeit, von Selbsterkenntnis und Selbstbekenntnis. In diesem Sinne besitzt der antike Mensch kein Gedächtnis, mithin keine Geschichte, weder in sich noch um sich. („Über Geschichte kann niemand urteilen, als wer an sich selbst Geschichte erlebt hat.“ Goethe.) Im antiken Weltbewußtsein wird alles Vergangene im Augenblicklichen aufgesaugt. Man vergleiche die äußerst „historischen“ Köpfe der Naumburger Domskulpturen, Dürers, Rembrandts mit denen hellenistischer Bildnisse, etwa der bekannten Sophoklesstatue. Die einen erzählen die ganze Geschichte einer Seele, die Züge des andern beschränken sich streng auf den Ausdruck eines augenblicklichen innern Zustandes. Sie schweigen von allem, was im Laufe eines Lebens zu diesem Zustande geführt hat — wenn davon bei einem echt antiken Menschen, der immer fertig, nie ein Werdender ist, überhaupt die Rede sein kann.
Und nun ist es möglich, die letzten Elemente der historischen Formenwelt aufzufinden. Unzählige Gestalten, in endloser Fülle auftauchend, verschwindend, sich abhebend, wieder verfließend, ein in tausend Farben und Lichtern blinkendes Gewirr von anscheinend freiester Zufälligkeit — das ist zunächst das Bild der Weltgeschichte, wie sie als Ganzes vor dem anschauenden Geiste sich ausbreitet. Der tiefer ins Wesenhafte dringende Blick aber hebt aus dieser Willkür reine Formen hervor, die dicht verhüllt und nur widerwillig sich entschleiernd allem menschlichen Werden zugrunde liegen.
Vom Bilde des gesamten Weltwerdens, wie es das faustische Auge umfaßt, dem Werden der Sternensysteme, der Erdoberfläche, der Lebewesen, betrachten wir jetzt nur die äußerst kleine morphologische Einheit der „Weltgeschichte“ im landläufigen Sinne, der von Goethe wenig geachteten Geschichte des höheren Menschentums, die wenig mehr als 6000 Jahre umfaßt, ohne auf das tiefe Problem der Symmetrie all dieser Gebilde einzugehen. Was dieser flüchtigen Formenwelt Sinn und Gehalt gibt und was bis jetzt tief verschüttet unter der kaum verstandenen Masse handgreiflicher „Daten“ und „Tatsachen“ lag, ist das[S. 150] Phänomen der großen Kulturen. Erst nachdem diese Urformen in ihrer physiognomischen, organischen Bedeutsamkeit erschaut, gefühlt, herausgearbeitet worden sind, kann das Wesen der Geschichte — gegenüber dem Wesen der Natur — als verstanden gelten. Erst von diesem Ein- und Ausblicke an darf von einer Philosophie der Geschichte ernsthaft die Rede sein. Erst dann ist es möglich, jedes Faktum im historischen Bilde, jeden Gedanken, jede Kunst, jeden Krieg, jede Persönlichkeit, jede Epoche ihrem symbolischen Gehalte nach zu begreifen und die Geschichte selbst nicht mehr als bloße Summe von Vergangenem ohne eigentliche Ordnung und innere Notwendigkeit zu begreifen, sondern als einen Organismus von strengstem Bau und sinnvollster Gliederung, in dessen Entwicklung die zufällige Gegenwart des Betrachters keinen Abschnitt bezeichnet und die Zukunft nicht mehr formlos und unbestimmbar erscheint.
Kulturen sind Organismen. Kulturgeschichte ist ihre Biographie. Die in historischer Erscheinung — im Gedächtnisbilde — uns vorliegende Geschichte der chinesischen oder antiken Kultur ist morphologisch das genaue Seitenstück zur Geschichte des einzelnen Menschen, eines Tieres, eines Baumes oder einer Blume. Will man ihre Struktur kennen lernen, so hat die vergleichende Morphologie der Pflanzen und Tiere längst die Methode dazu vorbereitet.[35] Im Phänomen der einzelnen, aufeinander folgenden, nebeneinander aufwachsenden, sich berührenden, überschattenden, erdrückenden Kulturen erschöpft sich der Gehalt aller Historie. Und läßt man ihre Gestalten, die bis jetzt nur allzu gut unter der Oberfläche einer trivial fortlaufenden „Geschichte der Menschheit“ verborgen lagen, im Geiste vorüberziehen, so muß es gelingen, den Typus, die Urgestalt der Kultur, frei von allem Trübenden und Unbedeutenden, aufzufinden, die allen einzelnen Kulturen als Formideal zugrunde liegt.
Ich unterscheide die Idee einer Kultur, ihre inneren Möglichkeiten, von ihrer sinnlichen Erscheinung im Bilde der Geschichte als der vollzogenen Verwirklichung. Es ist das Verhältnis der Seele zum Körper, ihrem Ausdruck im Bereiche[S. 151] des Ausgedehnten und Gewordenen. Geschichte einer Kultur ist die Verwirklichung ihres Möglichen. Die Vollendung ist gleichbedeutend mit dem Ende. So verhält sich die apollinische Seele, deren Idee einige von uns vielleicht noch einmal fühlen und nacherleben können, zu ihrer räumlichen Entfaltung, der wissenschaftlich zugänglichen „Antike“, deren Physiognomie der Archäologe, der Philologe, der Ästhetiker und der Historiker studieren.
Kultur ist das Urphänomen aller vergangenen und künftigen Weltgeschichte. Die tiefe und wenig gewürdigte Idee Goethes, die er in seiner lebendigen Natur fand und seinen morphologischen Forschungen stets zugrunde gelegt hat, soll hier in ihrem genauesten Sinne auf all die vollkommen ausgereiften, in der Blüte erstorbenen, halbentwickelten, im Keim erstickten Bildungen der menschlichen Geschichte angewendet werden. Hier redet nicht der analysierende Verstand, sondern das unmittelbare Weltgefühl, das Anschauen. „Das Höchste, wozu der Mensch gelangen kann, ist das Erstaunen, und wenn ihn das Urphänomen in Erstaunen setzt, so sei er zufrieden, ein Höheres kann es ihm nicht gewähren und ein Weiteres soll er nicht dahinter suchen: hier ist die Grenze.“ Ein Urphänomen ist dasjenige, in welchem die Idee des Werdens rein vor Augen liegt. Goethe sah die Idee der Urpflanze in der Gestalt jeder einzelnen, zufällig entstandenen oder überhaupt möglichen Pflanze klar vor seinem geistigen Auge. Er fühlte hier den Sinn des Werdens mit aller Deutlichkeit. Er ging bei seiner großen Entdeckung des os intermaxillare, die allein alle Leistungen Darwins aufwiegt, vom Urphänomen des Wirbeltiertypus, auf anderem Gebiete von der geologischen Schichtung, vom Blatt als der Urform aller pflanzlichen Organe, von der Metamorphose der Pflanzen als dem Urbild alles organischen Werdens aus. „Dasselbe Gesetz wird sich auf alles übrige Lebendige anwenden lassen“, schrieb er aus Neapel an Herder, als er ihm seine Entdeckung mitteilte. Das 19. „historische“ Jahrhundert hat ihn nicht verstanden.
Das Urphänomen ist, wie Goethe mit Entschiedenheit betont, reine Anschauung einer Idee, nicht Erkenntnis eines Begriffes. Alle Geschichtsschreibung aber ist bisher eine durchaus[S. 152] anorganische Kombination objektiver Tatsachen und Beobachtungen gewesen, die sich bestenfalls aus einem Erkenntnisprinzip von sozialer oder politischer, jedenfalls kausaler Formulierung ergab, das man in Wirklichkeit der Naturforschung und zwar der materialistischen abgelauscht hatte. Wenn man sich nicht im Stile Hegels und Schellings in Abstrusitäten verlor, so trieb man Systematik. Der Darwinismus mit seinen möglichst massiven, möglichst praktischen „Ursachen“ — die der westeuropäische Großstadtmensch sonst nicht als Ursachen von Wirkungen begriffen hätte — ist tatsächlich die Übertragung parteipolitischer Plattheiten auf die Erscheinungen der Tierwelt, aber andererseits sind die Prinzipien der heute so „wirtschaftlich“ gestimmten Geschichtsschreibung biologische, vom Darwinismus zurückeroberte Plattheiten. Von einer strengen und klaren Physiognomik, deren exakte Methoden erst noch zu finden waren, ist niemals die Rede gewesen. Hier liegt die Aufgabe des 20. Jahrhunderts vor, die Struktur der historischen Organismen bloßzulegen, das morphologisch Notwendige vom Zufälligen zu unterscheiden, den Ausdruck aller historischen Züge zu entziffern und den letzten Sinn dieser stummen Sprache aufzufinden.
Die bisher abgelaufene Geschichte ist nicht übersichtlich. Als ganz ausgereifte Gebilde, deren jedes also den Körper eines zur inneren Vollendung gelangten Seelentums repräsentiert, darf man die chinesische, babylonische, ägyptische, indische, antike, arabische, abendländische und die Mayakultur betrachten. Als im Entstehen begriffen kommt die russische in Betracht. Die Zahl der nicht zur Reife gelangten Kulturen ist gering; die persische, hettitische und die der Kitschua befinden sich darunter. Für das Verständnis des Urphänomens selbst sind sie ohne Bedeutung.
Eine unübersehbare Masse menschlicher Wesen, ein uferloser Strom, der aus dunkler Vergangenheit hervortritt, dort, wo unser Zeitgefühl seine ordnende Wirksamkeit verliert und die ruhelose Phantasie — oder Angst — in uns das Bild geologischer Erdperioden hingezaubert hat, um ein nie zu lösendes[S. 153] Rätsel dahinter zu verbergen, der sich in eine ebenso dunkle und zeitlose Zukunft verliert: das ist der Untergrund des Bildes der Menschengeschichte. Der einförmige Wellenschlag zahlloser Generationen bewegt die weite Fläche. Glitzernde Streifen breiten sich aus. Flüchtige Lichter ziehen und tanzen darüber hin, verwirren und trüben den klaren Spiegel, verwandeln sich, blitzen auf und verschwinden. Wir haben sie Geschlechter, Stämme, Völker, Rassen genannt. Sie fassen eine Reihe von Generationen in einem beschränkten Kreise der historischen Oberfläche zusammen. Wenn die gestaltende Kraft in ihnen erlischt — und diese Kraft ist eine sehr verschiedene und bestimmt eine sehr verschiedene Dauer und Plastizität dieser Phänomene im voraus —, erlöschen auch die physiognomischen, sprachlichen, geistigen Merkmale und die Erscheinung löst sich wieder in dem Chaos der Generationen auf. Arier, Mongolen, Germanen, Kelten, Parther, Franken, Karthager, Berber, Bantu sind Namen für höchst verschiedenartige Gebilde dieser Ordnung.
Über diese Fläche hin aber ziehen die großen Kulturen ihre majestätischen Wellenkreise. Sie tauchen plötzlich auf, verbreiten sich in prachtvollen Linien, glätten sich, verschwinden und der Spiegel der Flut liegt wieder einsam und schlafend da.
Eine Kultur wird in dem Augenblick geboren, wo eine große Seele aus dem urseelenhaften Zustande ewig-kindlichen Menschentums erwacht, sich ablöst, eine Gestalt aus dem Gestaltlosen, ein Begrenztes und Vergängliches aus dem Grenzenlosen und Verharrenden. Sie erblüht auf dem Boden einer genau abgrenzbaren Landschaft, an die sie pflanzenhaft gebunden bleibt. Eine Kultur stirbt, wenn diese Seele die volle Summe ihrer Möglichkeiten in der Gestalt von Völkern, Sprachen, Glaubenslehren, Künsten, Staaten, Wissenschaften verwirklicht hat und damit wieder ins Urseelentum zurückkehrt. Ihr lebendiges Dasein aber, jene Folge großer Epochen, die in strengem Umriß die fortschreitende Vollendung bezeichnen, ist ein tiefinnerlicher, leidenschaftlicher Kampf um die Behauptung der Idee gegen die Mächte des Chaos nach außen, gegen das Unbewußte nach innen, in das sie sich grollend zurückgezogen haben. Nicht nur der Künstler kämpft gegen den Widerstand der Materie und gegen die Vernichtung der Idee in sich. Jede[S. 154] Kultur steht in einer tief symbolischen Beziehung zu Stoff und Raum, in dem, durch den sie sich realisieren will. Ist das Ziel erreicht und die Idee, die ganze Fülle innerer Möglichkeiten vollendet und nach außen hin verwirklicht, so erstarrt die Kultur plötzlich, sie stirbt ab, ihr Blut gerinnt, ihre Kräfte brechen — sie wird zur Zivilisation. So kann sie, ein abgestorbener Baumriese im Urwald, noch Jahrhunderte hindurch die morschen Äste emporstrecken. Wir sehen es an Ägypten, an China, an Indien, an der Welt des Islam. So ragte die antike Zivilisation der Kaiserzeit mit einer scheinbaren Jugendkraft und Fülle riesenhaft auf und nahm der jungen arabischen Kultur des Ostens Luft und Licht.
Dies ist der Sinn aller Untergänge in der Geschichte, von denen der in seinen Umrissen deutlichste als „Untergang der Antike“ vor uns steht, während wir die frühesten Anzeichen des eignen, eines nach Verlauf und Dauer jenem völlig kongruenten Ereignisses, das den ersten Jahrhunderten des nächsten Jahrtausends angehört, den „Untergang des Abendlandes“, heute schon deutlich in und um uns spüren.
Jede Kultur durchläuft die Altersstufen des einzelnen Menschen. Jede hat ihre Kindheit, ihre Jugend, ihre Männlichkeit und ihr Greisentum. Eine junge, verschüchterte, ahnungsschwere Seele offenbart sich in der Morgenfrühe der Romanik und Gotik. Sie erfüllt die faustische Landschaft von der Provence der Troubadoure an bis zum Hildesheimer Bischof Bernwards. Hier weht Frühlingswind. „Man sieht in den Werken der altdeutschen Baukunst“, sagt Goethe, „die Blüte eines außerordentlichen Zustandes. Wem eine solche Blüte unmittelbar entgegentritt, der kann nichts als anstaunen; wer aber in das geheime innere Leben der Pflanze hineinsieht, in das Regen der Kräfte und wie sich die Blüte nach und nach entwickelt, der sieht die Sache mit ganz andern Augen, der weiß, was er sieht.“ Kindheit spricht ebenso und in ganz verwandten Lauten aus der frühhomerischen Dorik, aus der altchristlichen, das heißt früharabischen Kunst und aus den Werken des mit der 4. Dynastie beginnenden Alten Reiches in Ägypten. Da ringt ein mythisches Weltbewußtsein mit allem Dunklen und Dämonischen in sich und in der Natur wie mit einer Schuld, um langsam dem[S. 155] reinen lichtklaren Ausdruck eines endlich gewonnenen und begriffenen Daseins entgegen zu reifen. Je mehr sich eine Kultur der Mittagshöhe ihres Daseins nähert, desto männlicher, herber, beherrschter, gesättigter wird ihre endlich gesicherte Formensprache, desto gewisser ist sie im Gefühl ihrer Kraft, desto klarer werden ihre Züge. In der Frühzeit ist das alles noch dumpf, verworren, suchend, von kindlicher Sehnsucht und Angst zugleich erfüllt. Man betrachte die Ornamentik romanischer Kirchenportale Sachsens und des südlichen Frankreichs. Man denke an die Vasen des Dipylonstils. Jetzt, im vollen Bewußtsein der gereiften Gestaltungskraft, wie sie die Zeitalter des Sesostris, der Peisistratiden, Justinians I., der spanischen Weltmacht Karls V. zeigen, erscheint jede Einzelheit des Ausdruckes gewählt, streng, gemessen, von einer wunderbaren Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit. Hier finden sich überall Momente von einer leuchtenden Vollkommenheit, Momente, in denen der Kopf Amenemhets III. (die Hyksossphinx von Tanis), die Wölbung der Hagia Sophia, die Gemälde Tizians entstanden sind. Noch später, zart, beinahe zerbrechlich, von der wehen Süßigkeit der letzten Oktobertage sind die knidische Aphrodite und die Korenhalle des Erechtheion, die Arabesken an sarazenischen Hufeisenbögen, der Dresdner Zwinger, Watteau und Mozart. Zuletzt, im Greisentum der anbrechenden Zivilisation, erlischt das Feuer der Seele. Die abnehmende Kraft wagt sich noch einmal, mit halbem Erfolge — im Klassizismus, der keiner erlöschenden Kultur fremd ist — an eine große Schöpfung; die Seele denkt noch einmal — in der Romantik — wehmütig an ihre Kindheit zurück. Endlich verliert sie, müde, verdrossen und kalt, die Lust am Dasein und sehnt sich — wie in der Römerzeit — aus dem tausendjährigen Lichte wieder in das Dunkel urseelenhafter Mystik, in den Mutterschoß, ins Grab zurück. Das ist der Zauber, den damals der Isis-, Serapis-, Horus-, Mithraskult auf das sterbende Römertum ausübten, dieselben Kulte, welche eine eben ertagende Seele im Osten als den frühesten, träumerischen, ängstlichen Ausdruck ihres Seins konzipiert und mit einer neuen Innerlichkeit erfüllt hatte.
[S. 156]
Man spricht vom Habitus einer Pflanze und meint damit die ihr allein zugehörige Art der äußern Erscheinung, den Charakter und Stil ihres Hervortretens in den Bereich des Gewordnen und Ausgedehnten, durch den sich jede in jedem ihrer Teile und auf jeder Altersstufe von den Exemplaren aller andern Gattungen unterscheidet. Ich wende diesen für die Physiognomik wichtigen Begriff auf die großen Organismen der Geschichte an und spreche von dem Habitus indischer, ägyptischer, antiker Kultur, Geschichte oder Geistigkeit. Ein unbestimmtes Gefühl davon hat immer schon dem Stilbegriff zugrunde gelegen und es heißt ihn nur verdeutlichen und vertiefen, wenn man vom religiösen, geistigen, politischen, sozialen, wirtschaftlichen Stil einer Kultur, überhaupt vom Stil einer Seele spricht. Dieser Habitus des bewußten Daseins, der beim einzelnen Menschen sich auf Gesinnungen, Gedanken, Gebärden, Handlungen erstreckt, umfaßt im Dasein ganzer Kulturen den gesamten Lebensausdruck höherer Ordnung, wie die Wahl bestimmter Kunstgattungen (der Rundplastik, des Fresko durch die Hellenen, des Kontrapunkts, der Ölmalerei im Abendlande), und die entschiedene Ablehnung anderer (der Plastik durch die Araber), den Hang zur Esoterik (Indien) oder Popularität (Antike), zur Rede (Antike) oder Schrift (China, Abendland) als den Formen der geistigen Mitteilung, den Typus ihrer Staatenbildungen, Geldsysteme, öffentlichen Sitten. Alle großen Persönlichkeiten der Antike bilden — ganz mathematisch betrachtet — eine Gruppe, deren seelischer Habitus von dem aller großen Menschen der arabischen oder abendländischen Gruppe wohl unterschieden ist. Man vergleiche selbst Goethe oder Raffael mit antiken Menschen und Heraklit, Sophokles, Plato, Alkibiades, Themistokles, Horaz, Tiberius rücken sofort zu einer einzigen Familie zusammen. Jede antike Weltstadt, vom Syrakus des Hieron bis zum kaiserlichen Rom, ist als Verkörperung und Sinnbild eines und desselben Lebensgefühls, nach Grundriß, Straßenbild, Sprache der privaten und öffentlichen Architektur, nach dem Typus von Plätzen, Gassen, Höfen, Fassaden, nach Farbe, Lärm, Gewimmel, nach dem Geist ihrer[S. 157] Nächte von der Gruppe der indischen, der arabischen, der abendländischen Weltstädte streng unterschieden. Im eroberten Granada war die ganze Seele arabischer Städte, Bagdads und Kairos, noch lange fühlbar, während in dem Madrid Philipps II. schon alle physiognomischen Merkmale der modernen Stadtbilder von Berlin, London und Paris anzutreffen sind. Es liegt eine hohe Symbolik in jedem unterscheidenden Moment; man denke an den abendländischen Hang zu gradlinigen Perspektiven und Straßenfluchten wie dem mächtigen Zuge der Champs Elysées vom Louvre an oder dem Platz vor der Peterskirche und dessen Gegensatz in der fast absichtlichen Verworrenheit und Enge der Via sacra, des Forum Romanum und der Akropolis mit ihrer unsymmetrischen und unperspektivischen Ordnung der Teile. Auch der Städtebau wiederholt, ob aus Instinkt wie in der Gotik oder bewußt wie seit Alexander und Napoleon, das Prinzip der leibnizschen Mathematik des unendlichen Raumes und der euklidischen der vereinzelten Körper.
Zum Habitus einer Gruppe von Organismen gehört aber auch eine bestimmte Lebensdauer und ein bestimmtes Tempo der Entwicklung. Diese Begriffe dürfen in einer Strukturlehre der Historie nicht fehlen. Der Takt des antiken Daseins war ein anderer als der des ägyptischen oder arabischen. Man darf vom Andante des hellenisch-römischen und vom Allegro con brio des faustischen Geistes reden. Mit dem Begriff der Lebensdauer eines Menschen, eines Adlers, einer Schildkröte, einer Eiche oder Palme verbindet sich, ganz unabhängig von allen Zufälligkeiten des Einzelschicksals, ein bestimmter Wert. Zehn Jahre sind im Leben aller Menschen ein annähernd gleichbedeutender Abschnitt, und die Metamorphose der Insekten knüpft sich in einzelnen Fällen an eine im voraus genau bekannte Anzahl von Tagen. Die Römer verbanden mit ihren Begriffen pueritia, adolescentia, juventus, virilitas, senectus eine geradezu mathematisch genaue Vorstellung. Die Biologie der Zukunft wird ohne Zweifel die vorbestimmte Lebensdauer der Arten und Gattungen — im Gegensatz zum Darwinismus und mit grundsätzlicher Ausschaltung kausaler Zweckmäßigkeitsmotive für die Entstehung der Arten — zum Ausgangspunkt einer ganz neuen Problemstellung machen. Die Dauer[S. 158] einer Generation — gleichviel von was für Wesen — ist ein Wert von beinahe mystischer Bedeutung. Diese Beziehungen besitzen nun auch, in einer bisher nie geahnten Weise, für alle Kulturen Geltung. Jede Kultur, jede Frühzeit, jeder Aufstieg und Niedergang, jede ihrer notwendigen Phasen hat eine bestimmte, immer gleiche, immer mit dem Nachdruck eines Symbols wiederkehrende Dauer. In diesem Buche muß darauf verzichtet werden, diese Welt geheimnisvollster Zusammenhänge zu erschließen, aber die im folgenden immer wieder aufleuchtenden Tatsachen werden verraten, was alles hier verborgen liegt. Was bedeutet die in allen Kulturen herrschende 50jährige Periode im Rhythmus des politischen, geistigen, künstlerischen Werdens?[36] (Das seelische Verhältnis des Großvaters zum Enkel liegt hier zugrunde.)[37] Was die 300jährigen Perioden der Gotik, des Barock, der Dorik, der Ionik, der großen Mathematiken, der attischen Plastik, der Mosaikmalerei, des Kontrapunkts, der galileischen Mechanik? Was bedeutet die ideale Lebensdauer von einem Jahrtausend für jede Kultur im Vergleich zu der des Einzelnen, dessen „Leben 70 Jahre währt“?
Wie Blätter, Blüten, Zweige, Früchte in Tracht, Form und Haltung ein Pflanzendasein zum Ausdruck bringen, so tun es die ethischen, mathematischen, politischen, wirtschaftlichen Bildungen im Dasein einer Kultur. Was etwa für Goethes Individualität eine Reihe so verschiedenartiger Äußerungen wie der Faust, die Farbenlehre, der Reineke Fuchs, Tasso, Werther, die Reise nach Italien, die Liebe zu Friederike, der Divan und die römischen Elegien waren, das bedeuten für die Individualität der Antike die Perserkriege, die attische Tragödie, die Polis, das Dionysische so gut wie die Tyrannis, die ionische Säule,[S. 159] die Geometrie Euklids, der Garten Epikurs, die römische Legion, die Gladiatorenkämpfe und das „panem et circenses“ der Kaiserzeit.
In diesem Sinne wiederholt mit tiefster Notwendigkeit jedes irgendwie bedeutende Einzeldasein alle Phasen der Kultur, der es angehört. In jedem von uns erwacht das Innenleben — in jenem entscheidenden Moment, von dem an man weiß, daß man ein Ich hat — dort, wo einst die Seele der ganzen Kultur erwachte. Jeder von uns Menschen des Abendlandes erlebt als Kind seine Gotik, seine Dome, Ritterburgen und Heldensagen, das „Dieu le veut“ der Kreuzzüge in wachen Träumen und Kinderspielen noch einmal. Jeder junge Grieche hatte sein homerisches Zeitalter und sein Marathon. In Goethes Werther, dem Bild einer Epoche, die jeder faustische, aber kein antiker Mensch kennt, taucht die Frühzeit Petrarcas und des Minnesangs noch einmal auf. Als Goethe den Urfaust entwarf, war er Parzival. Als er den ersten Teil abschloß, war er Hamlet. Erst mit dem zweiten Teil wurde er der Weltmann des 19. Jahrhunderts, der Byron verstand. Selbst das Greisentum, jene grillenhaften und unfruchtbaren Jahrhunderte des spätesten Hellenismus, die „zweite Kindheit“ einer müden, blasierten Intelligenz, ist an mehr als einem großen Greise des Griechentums zu studieren. In den Bacchen des Euripides ist viel von der Vitalität, in Platos Timaios von dem religiösen Synkretismus der Kaiserzeit vorweggenommen. Und Goethes zweiter Faust, Wagners Parsifal verraten im voraus, welche Gestalt unser Seelentum in den nächsten, den letzten Jahrhunderten annehmen wird.
Als Homologie der Organe bezeichnet die Biologie die morphologische Gleichwertigkeit im Gegensatz zur Analogie der Organe, die sich auf die Gleichwertigkeit der Funktion bezieht. Goethe hat diesen bedeutenden und in der Folge so fruchtbaren Begriff konzipiert, dessen Verfolgung ihn zur Entdeckung des os intermaxillare beim Menschen führte; Owen hat ihm eine streng wissenschaftliche Fassung gegeben. Ich führe auch diesen Begriff in die historische Methode ein.
Man weiß, daß jedem Teile des menschlichen Kopfskeletts bei jedem Wirbeltiere bis zu den Fischen herab ein anderer genau entspricht, daß die Brustflossen der Fische und Füße,[S. 160] Flügel, Hände der landbewohnenden Wirbeltiere homologe Organe sind, auch wenn sie den leisesten Anschein von Ähnlichkeit verloren haben. Homolog sind die Lunge der Landtiere und die Schwimmblase der Fische, analog — in bezug auf den Gebrauch — sind Lunge und Kiemen.[38] Hier äußert sich eine vertiefte, durch strengste Schulung des Blickes erworbene morphologische Begabung, die der heutigen Geschichtsforschung mit ihren oberflächlichen Vergleichen — zwischen Christus und Buddha, Cäsar und Wallenstein, der deutschen und der hellenischen Kleinstaaterei — völlig fremd ist. Man vergleicht die spätantike Baukunst mit dem Barock, Archimedes mit Galilei, Weimar mit Florenz. — Im 18. Jahrhundert war eine geistreiche Morphologie beliebt, welche den Löwenschwanz mit einer Fächerpalme, den Hals des Schwans mit einer keimenden Zwiebel genetisch in Verbindung brachte. Es wird sich im Verlaufe dieses Buches zeigen, welch ungeheure Perspektiven sich dem historischen Blick eröffnen, sobald jene vertiefte Methode, historische Phänomene aufzufassen, verstanden und ausgebildet worden ist. Homologe Bildungen sind, um hier nur weniges zu nennen, die schon oft erwähnte griechische Plastik und die nordische Instrumentalmusik, die Pyramiden der 4. Dynastie und die gotischen Dome, der indische Buddhismus und der römische Stoizismus (Buddhismus und Christentum sind nicht einmal analog), die Feldzüge Alexanders und Napoleons (nicht die Cäsars), die Zeit des Perikles und die der Regentschaft (des Kardinals Fleury), die Epochen Plotins und Dantes. Homolog sind dionysische Strömung und Renaissance, analog dionysische Strömung und Reformation. Für uns — das hat Nietzsche richtig gefühlt — resümiert Wagner die Modernität. Folglich muß es für die antike Modernität, für antike Weltstadtseelen[S. 161] und -nerven etwas Entsprechendes geben. Es ist die pergamenische Kunst. Die Tafeln am Anfang geben einen vorläufigen Begriff von der Fruchtbarkeit dieses Aspekts.
Aus der Homologie historischer Phänomene folgt sogleich ein völlig neuer Begriff. Ich nenne gleichzeitig zwei geschichtliche Fakta, die, jedes in seiner Kultur, in genau derselben — relativen — Lage eintreten und also eine genau entsprechende Bedeutung haben. Es war gezeigt worden, wie die Entwicklung der antiken und der abendländischen Mathematik in völliger Kongruenz verläuft. Der Fall ist typisch. Hier hätten also Pythagoras und Descartes, Plato und Laplace, Archimedes und Gauß als gleichzeitig bezeichnet werden dürfen. Gleichzeitig vollzieht sich die Entstehung der Ionik und des Barock. Polygnot und Rembrandt, Polyklet und Bach sind Zeitgenossen. Gleichzeitig erscheint in allen Kulturen der Moment, wo die Metamorphose zur Zivilisation sich vollzieht. In der Antike trägt diese Epoche die Namen Philipps und Alexanders, im Abendlande tritt das homologe Ereignis in Gestalt der Revolution und Napoleons ein. Betrachtet man — hier werden entscheidende Resultate des zweiten Teils vorweggenommen — die wirtschaftlich-intellektuelle Stimmung hellenischer Großstädte nach dem Frieden des Antalkidas (386); sieht man die wüsten Revolutionen der Besitzlosen, die wie in Argos (370) alle Reichen mit Knütteln in den Straßen totschlugen, so hat man das Gegenstück zur französischen Gesellschaft nach dem Pariser Frieden (1763). Voltaire, Rousseau, Mirabeau, Beaumarchais und Sokrates, Aristophanes, Hippon, Isokrates sind Zeitgenossen. In beiden Fällen beginnt die Zivilisation. Dieselbe Aufklärung und Auflösung aller Tradition, dieselben Bastillenstürme, Massenhinrichtungen, Wohlfahrtsausschüsse, dieselben Staatsutopien bei Plato, Xenophon, Aristoteles und Rousseau, Kant, Fichte, Saint-Simon, dieselbe Schwärmerei für Naturrechte, Gesellschaftsvertrag, Freiheit und Gleichheit bis zu den Forderungen allgemeiner Bodenverteilung und Gütergemeinschaft (Hippon, Babeuf) und endlich dieselbe Resignation und Hoffnung auf einen demokratisch fundierten Napoleonismus bei Plato wie bei Rousseau und Saint-Simon. Napoleons Staatsstreich war nicht der erste, der geplant und gemacht wurde, nur der erste, der[S. 162] glückte. Die antiken „Soldatenkaiser“ beginnen schon mit Dionys von Syrakus (405), Jason von Pherä (374), Maussolos von Halikarnaß (353). Nur der Erbe ihrer Idee war Philipp von Makedonien. Das 4. Jahrhundert, das mit Alkibiades — der viel vom imperialen Ehrgeiz Mirabeaus, Napoleons und Byrons hat — beginnt und mit Alexander endet, ist das genaue Gegenbild der Zeit von 1750 bis 1850, in welcher mit tiefer Logik der contrat social, Robespierre, Napoleon, die Volksheere und der Sozialismus aufeinander folgen, während im Hintergrunde Rom und Preußen sich auf ihre welthistorische Rolle vorbereiten. Daß Alexander das Perserreich zerstörte, daß Napoleons Kampf gegen seinen einzigen Gegner, das englische System, mißlang, sind in gewissem Sinne Zufälle, Oberflächenformen der Epoche, Tendenzen eines großen Privatlebens, unter denen sich das Schicksalhafte und Notwendige, das in beiden Fällen identisch war, verbarg. Rechnen wir hundert Jahre weiter, so wiederholt sich die Homologie zweier „gleichzeitiger“ Epochen. Die eine — auch hier wird späteren Ausführungen vorgegriffen — trägt den Namen Hannibals, die andere den des Weltkrieges. Daß im einen Falle ein Mensch, der gar nicht zur antiken Kultur gehörte, entscheidend eingriff (aber das ist ja auch der Fall Rußlands im Verhältnis zu „Europa“), gehört zum Zufälligen. Die Bestimmung Hannibals bezieht sich auf eine innere Vollendung des antiken Gesamtschicksals. Mit der Schlacht von Zama geht der Schwerpunkt der Antike vom Hellenismus zum Römertum über. Der entsprechende Sinn der abendländischen Epoche, in deren Mitte wir heute stehen, wird später dargelegt werden.
Ich hoffe zu beweisen, daß ohne Ausnahme die sämtlichen großen Schöpfungen und Formen der Religion, Kunst, Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft in sämtlichen Kulturen gleichzeitig entstehen, sich vollenden, erlöschen; daß der inneren Struktur der einen die aller anderen durchaus entspricht; daß es nicht eine Erscheinung von tiefer physiognomischer Bedeutung im historischen Bilde der einen gibt, deren Gegenstück, und zwar in einer streng bezeichnenden Form und an ganz bestimmter Stelle nicht in den übrigen aufzufinden wäre. Allerdings bedarf es, um diese morphologische Identität zweier[S. 163] Phänomene zu begreifen, einer ganz andern Vertiefung und Unabhängigkeit vom Augenschein des Vordergrundes, als sie unter Historikern bisher üblich war, die sich nie hätten träumen lassen, daß der Protestantismus in der dionysischen Bewegung sein Gegenbild findet und daß der englische Puritanismus im Abendlande dem Islam in der arabischen Welt entspricht.
Aus diesem Aspekte ergibt sich eine Möglichkeit, die weit über den Ehrgeiz aller bisherigen Geschichtsforschung hinausgeht, die sich im wesentlichen darauf beschränkte, Vergangnes, soweit man es kannte, sukzessiv zu ordnen: Die Gegenwart als Grenze der Untersuchung zu überschreiten und auch die noch nicht abgelaufenen Phasen der Geschichte nach Typus, Tempo, Sinn, Resultat zu bestimmen, aber auch längst verschollene und unbekannte Epochen, ja ganze Kulturen der Vergangenheit an der Hand morphologischer Zusammenhänge zu rekonstruieren (ein Verfahren, das dem der Paläontologie nicht unähnlich ist, die heute imstande ist, aus einem einzigen aufgefundenen Schädelfragment weitgehende und sichere Angaben über das Skelett und die Zugehörigkeit des Exemplars zu einer bestimmten Art zu machen).
Es ist, den physiognomischen Takt vorausgesetzt, durchaus möglich, aus zerstreuten Details der Ornamentik, Bauweise, Schrift, aus vereinzelten Daten politischer, wirtschaftlicher, religiöser Natur die organischen Grundzüge des Geschichtsbildes ganzer Jahrhunderte wiederzufinden, aus Einzelheiten der künstlerischen Formensprache etwa die gleichzeitige Staatsform, aus mathematischen Prinzipien den Charakter der entsprechenden wirtschaftlichen abzulesen, ein echt goethesches, auf Goethes Idee vom Urphänomen zurückführendes Verfahren, das in beschränktem Umfange der vergleichenden Tier- und Pflanzenkunde geläufig ist, das sich aber in einem nie geahnten Grade auf den gesamten Bereich der Historie ausdehnen läßt.
[33] Das Antihistorische als Ausdruck einer entschieden systematischen Veranlagung ist vom Ahistorischen sehr zu unterscheiden. Der Anfang des 4. Buches der „Welt als Wille und Vorstellung“ (§ 53) ist bezeichnend für einen Menschen, der antihistorisch denkt, d. h. aus theoretischen Gründen das Historische in sich, das vorhanden ist, unterdrückt und verwirft im Gegensatz zur ahistorischen hellenischen Natur, die es nicht hat und nicht kennt.
[34] „Es gibt Urphänomene, die wir in ihrer göttlichen Einfalt nicht stören und beeinträchtigen sollen“ (Goethe).
[35] Es ist nicht die des zoologischen „Pragmatismus“ der Darwinisten mit seiner Jagd nach Kausalzusammenhängen, sondern die intuitive Goethes.
[36] Ich mache hier nur auf den Abstand der drei punischen Kriege und auf die ebenfalls rein rhythmisch zu begreifende Reihe des spanischen Erbfolgekrieges, der Kriege Friedrichs des Großen, Napoleons, Bismarcks und des Weltkriegs aufmerksam.
[37] Aus diesem früh gefühlten Zusammenhang stammt die Überzeugung primitiver Völker, daß die Seele des Großvaters im Enkel zurückkehre. Daher schreibt sich die allgemeine Sitte, dem Enkel den Namen des Großvaters zu geben, der mit seiner mystischen Kraft dessen Seele wieder in die Körperwelt bannt.
[38] Es ist nicht überflüssig hinzuzufügen, daß diese reinen Phänomene der lebendigen Natur fernab von allem Kausalen liegen und daß der Materialismus ihr Bild erst durch die Projektion utilitarischer Tendenzen verderben mußte, ehe er es zum System hergerichtet hatte. Goethe, der vom Darwinismus ungefähr so viel vorweggenommen hat, als in fünfzig Jahren von ihm übrig sein wird, schaltet das Kausalitätsprinzip ganz aus. Es kennzeichnet das ursachen- und zwecklose wirkliche Leben, daß die Darwinisten das Fehlen des Prinzips hier gar nicht bemerkt haben. Der Begriff des Urphänomens läßt keinerlei kausale Annahmen zu, man müßte ihn denn erst mechanisch mißverstehen.
[S. 164]
Dieser Gedankengang erschließt endlich den Blick auf einen Gegensatz, der den Schlüssel zu einem der ältesten und mächtigsten Menschheitsprobleme bildet, das erst durch ihn zugänglich und — soweit das Wort überhaupt einen Sinn hat — lösbar erscheint. Ich meine den Gegensatz von Schicksalsidee und Kausalitätsprinzip, der niemals bisher als solcher, in seiner tiefen, weltgestaltenden Notwendigkeit erkannt worden ist.
Wer überhaupt versteht, inwiefern man die Seele als die Idee des Daseins bezeichnen kann, der wird auch ahnen, wie nahe verwandt ihr die Gewißheit eines Schicksals ist und inwiefern das Leben selbst, das ich die Gestalt nannte, in welcher die Verwirklichung des Möglichen sich vollzieht, als gerichtet, als schicksalhaft empfunden werden muß — dumpf und ängstigend vom Urmenschen, klar und in der Fassung einer Weltanschauung, die allerdings nur durch das Medium von Kunst und Religion, nicht durch Beweise und Begriffe mitteilbar ist, vom Menschen hoher Kulturen.
Jede höhere Sprache hat eine Anzahl Worte, die von einem tiefen Geheimnis umgeben sind: Geschick, Verhängnis, Zufall, Fügung, Bestimmung. Keine Hypothese, keine Wissenschaft kann je an das rühren, was man fühlt, wenn man sich in den Sinn und Klang dieser Worte versenkt. Es sind Symbole, nicht Begriffe. Hier ist der Schwerpunkt des Weltbildes, das ich Geschichte im Unterschiede von Natur genannt habe. Die Schicksalsidee verlangt Lebenserfahrung, nicht wissenschaftliche Erfahrung, Tiefe, nicht Geist. Es gibt eine organische Logik, eine Logik des Lebens im Gegensatz zu einer Logik des Anorganischen und Starren. Es gibt eine Logik der Richtung gegenüber einer Logik des Ausgedehnten. Kein Systematiker,[S. 165] kein Kant oder Schopenhauer hat mit ihr etwas anzufangen gewußt. Sie verstehen von Urteil, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit, Erinnerung zu reden, aber sie schweigen von dem, was in den Worten Hoffnung, Glück, Verzweiflung, Reue, Ergebenheit, Trotz liegt. Wer hier, im Lebendigen, Gründe und Folgen sucht und wer da glaubt, daß ein inneres Wissen um den Sinn des Lebens gleichbedeutend mit Fatalismus und Prädestination sei, der weiß gar nicht, wovon die Rede ist, der hat schon das Erlebnis mit dem Erkannten und Erkennbaren verwechselt. Kausalität ist das Verstandesmäßige, Gesetzhafte, Aussprechbare, die Form äußerer intellektueller Erfahrung. Schicksal ist das Wort für eine nicht zu beschreibende innere Gewißheit. Man macht das Wesen des Kausalen deutlich durch ein physikalisches oder erkenntniskritisches System, durch Zahlen, durch begriffliche Analysen. Man teilt die Idee eines Schicksals nur als Künstler mit, durch ein Porträt, durch eine Tragödie, durch Musik. Das eine fordert eine Zergliederung, das andre eine Schöpfung. Darin liegt die Beziehung des Schicksals zum Leben, der Kausalität zum Tode.
In der Schicksalsidee offenbart sich die Weltsehnsucht einer Seele, ihr Wunsch nach dem Licht, dem Aufstieg, nach Vollendung und Verwirklichung ihrer Bestimmung. Sie ist keinem Menschen ganz fremd, und erst der späte Mensch der großen Städte mit seinem Tatsachensinn und der Macht seines mechanisierenden Intellekts über das Innenleben verliert sie aus den Augen, bis sie in einer tiefen Stunde mit furchtbarer, alle Kausalität der Weltoberfläche zermalmender Deutlichkeit vor ihm steht. Denn das Kausalitätsprinzip ist spät, selten und nur dem energischen Intellekt hoher Kulturen ein sichrer, gewissermaßen künstlicher Besitz. Aus ihm redet schon die Weltangst. In ihm bannt sie das Dämonische in eine Notwendigkeit von dauernder Geltung, die starr und entseelend über das physikalische Weltbild gebreitet ist. Kausalität deckt sich mit dem Begriff des Gesetzes. Es gibt nur Kausalgesetze. Aber wie im Kausalen nach Kants Feststellung eine Notwendigkeit des wachen Denkens liegt, die Form seiner Rezeptivität der Welt gegenüber, so bezeichnen die Worte Schicksal, Fügung, Bestimmung eine Notwendigkeit des Lebens. Wirkliche[S. 166] Geschichte hat Schicksal, aber keine Gesetze. Es gibt keine Übergänge zwischen Organismus und Mechanismus. Darin liegt die große Schwierigkeit, sich verständlich zu machen. Denn schon der Versuch, den Unterschied beider Welten sprachlich klarzustellen — leitet unvermerkt vom Leben hinüber zur Sphäre des Kausalen. Die Sprache selbst ist von kausaler Struktur. Sie mechanisiert, indem sie erklärt.
Wer das Element der Empfindungswelt zergliedert, indem er es erkennt, durch das Medium der kausalen Erfahrung sich aneignet, es aus dem Zusammenhange eines mechanischen Ganzen deutet, wer also alles lebendige Werden dem starr Gewordenen einordnet, wird mit Notwendigkeit die ganze Summe des Daseins aus der Perspektive von Ursache und Wirkung übersehen, ohne inneres Gerichtetsein, ohne Geheimnis. Hier liegt der Machtbereich der „Kategorien des Verstandes“, die Kant mit Recht für a priori wirksam hielt, Formen des exakten Erkennens, welche eine Oberflächenwelt, ein Natursystem, einen Reflex des Geistes erzeugen. Wer aber, wie Goethe, wie beinahe jeder Mensch in gewissen Augenblicken seines Daseins, die Umwelt als ein Lebendiges anschaut, das Gewordene als Werden nachfühlt, die Weltmaske der Kausalität lüftet, für den ist die Zeit plötzlich kein Rätsel mehr, kein Begriff, keine Dimension, sondern etwas innerlich Gewisses, das Schicksal selbst; ihr Gerichtetsein, ihre Nichtumkehrbarkeit, ihre Lebendigkeit erscheint als der Sinn des historischen Weltaspekts. Schicksal und Kausalität verhalten sich wie Zeit und Raum.
In beiden möglichen Weltbildungen — wir erinnern uns indessen, daß sie die Pole einer Skala von unendlich vielen individuellen „Welten“ darstellen — in Geschichte und Natur, der Physiognomie alles Werdens und dem System alles Gewordenen, herrschen also Schicksal oder Kausalität. Zwischen ihnen besteht der Unterschied eines Lebensgefühls und einer Erkenntnisform. Jedes von ihnen ist der Ausgangspunkt einer vollkommenen und in sich geschlossenen, nur nicht der einzigen Welt.
Aber das Werden liegt dem Gewordenen, das innere und gewisse Gefühl eines Schicksals mithin dem Begriff von Ursache[S. 167] und Wirkung zugrunde. Kausalität ist — wenn man sich so ausdrücken darf — gewordenes, entorganisiertes, in den Formen des Verstandes erstarrtes Schicksal. Das Schicksal selbst, an dem alle Erbauer verstandesmäßiger Weltsysteme wie Kant schweigend vorübergegangen sind, weil sie das Leben mit ihren Abstraktionen nicht zu berühren vermochten, steht jenseits und außerhalb aller begriffenen Natur. Als das Ursprüngliche aber gibt es dem toten und starren Prinzip von Ursache und Wirkung erst die — historische — Möglichkeit, innerhalb hochentwickelter Kulturen als geistige Weltform aufzutreten. Das Dasein der antiken Seele ist die Bedingung für die Entstehung der Physik Demokrits und das der faustischen für die Mechanik Newtons. Man kann sich sehr wohl denken, daß beide Kulturen ohne eine Naturwissenschaft eignen Stils geblieben wären, aber man kann sich beide Systeme nicht ohne den Untergrund jener Kulturen denken.
Hier liegt ein neuer Beweis für die Richtigkeit des Antagonismus von Geschichte und Natur vor. Es ist die Art, wie sie — als Weltbilder — einander einschließen und unterordnen. Gesetzt, daß „Geschichte“ diejenige Art der Weltfassung ist, welche gefühlsmäßig das Gewordene dem Werden, das Ausgedehnte der Zeit einordnet, so müßte dies auch mit der Natur der Fall sein. Und in der Tat, für den Blick des historisch eingestellten Menschen gibt es nur eine Geschichte der Physik. All ihre Systeme erscheinen ihm jetzt nicht richtig oder unrichtig, sondern historisch, psychologisch, durch den Charakter der Epoche bedingt und ihn mehr oder weniger vollkommen repräsentierend. Selbst der geborene Physiker, der in der Einleitung seines Buches einen flüchtigen historischen Überblick über seine Wissenschaft gibt, hier also für einen Augenblick die „andre Welt“ heraufruft, fühlt plötzlich so, daß er unvermerkt das Fundament seiner Wissenschaft, das Postulat der einen und unveränderlichen Wahrheit, in Frage stellt. Wäre seine Natur die Natur, so könnte es keine Geschichte der Systeme geben. Aber der Physiker redet sogar vom Schicksal eines Problems. Umgekehrt: Ist „Natur“ die Fassung, welche verstandesmäßig das Werden dem Gewordenen einverleiben möchte, die lebendige Richtung also der starren Ausdehnung[S. 168] angleicht (dies ist der Ursprung des Bewegungsproblems samt dem Grunde seiner Unlösbarkeit), so darf die Geschichte bestenfalls in einem Kapitel der Erkenntnistheorie erscheinen und wirklich, so hätte Kant sie aufgefaßt, wenn er nicht, was noch bezeichnender ist, sie in seinem Erkenntnissystem vollständig vergessen hätte. Für ihn wie für jeden geborenen Systematiker war die Natur die Welt; indem er von der Zeit redete, ohne deren Richtung und Nichtumkehrbarkeit zu bemerken, verriet er, daß er von der Natur sprach, ohne die Möglichkeit einer andern Welt, der historischen — die für ihn vielleicht wirklich unmöglich war — zu ahnen.
Aber Kausalität hat mit Zeit gar nichts zu tun. Das wirkt heute als ungeheures Paradoxon, vor einer Welt von Kantianern, die gar nicht wissen, wie sehr sie es sind. Wie die Doppelgestalt des seelischen Urgefühls, Weltsehnsucht und Weltangst, eine Bejahung oder Verneinung des wachen Daseins und der in ihm sich offenbarenden fremden Mächte bedeutet, wie die Angst ein Widerspruch gegen die ursprünglichere, kindlichere Form der Sehnsucht ist, aus ihr erwachsen und an ihr gestaltet und gereift, so hat man den Gegensatz von Richtung und Ausdehnung — mit seiner dunklen Beziehung zu Leben und Tod — zu verstehen. Im Wesen des Ausgedehnten liegt eine Verneinung der Richtung. Der Raum widerspricht der Zeit, obwohl sie ihm voraufgeht und zugrunde liegt. Dieselbe Priorität nimmt das Schicksal in Anspruch. Wir haben zunächst die Idee des Schicksals und erst im Widerspruch zu ihr, aus der Angst geboren, als den Versuch des Verstandes, das unentrinnbare Ende, den Tod, zu bannen, zu überwinden, das Kausalitätsprinzip, durch das die Lebensangst sich des Schicksals zu erwehren sucht, indem sie ihm zum Trotz eine andre Welt gründet. Indem sie das Gespinst von Ursache und Wirkung über deren sinnliche Oberfläche breitet, hat sie ein Bild der Dauer imaginiert. Diese Tendenz liegt in dem allen reifen Kulturen bekannten Gefühl: Wissen ist Macht. Damit ist die Macht über das Schicksal gemeint. Der abstrakte Gelehrte, der Naturforscher, der Denker in Systemen, dessen ganze geistige Existenz sich auf das Kausalitätsprinzip gründet, ist eine späte Erscheinung des Hasses gegen die Mächte des[S. 169] Schicksals, des Unbegreiflichen. Die „reine Vernunft“ leugnet alle Möglichkeiten außer sich. Hier liegt das strenge Denken mit der großen Kunst ewig im Streite. Das eine lehnt sich auf, die andre gibt sich hin. Ein Mann wie Kant wird sich Beethoven immer überlegen fühlen wie der Mann dem Kinde, aber er wird Beethoven nicht hindern, die „Kritik der reinen Vernunft“ als eine armselige Art von Weltbetrachtung abzulehnen. Der Mißbegriff der Teleologie, dieser Unsinn allen Unsinns innerhalb der reinen Wissenschaft, bedeutet nichts anderes als den Versuch, den lebendigen Gehalt aller naturhaften Erkenntnis — denn zum Erkennen gehört auch ein Erkennender; und ist der Inhalt dieses Denkens „Natur“, so ist der Akt des Denkens Geschichte — und mit ihm das Leben selbst durch das mechanistische Prinzip einer umgekehrten Kausalität zu bannen, zu assimilieren. Die Teleologie ist eine Karikatur der Schicksalsidee. Was Dante als Bestimmung fühlt, verwandelt der Verstand in einen Zweck des Lebens. Dies ist die eigentliche und tiefste Tendenz des Darwinismus, einer großstädtisch intellektuellen Weltfassung in der abstraktesten aller Zivilisationen und der aus einer Wurzel mit ihm entspringenden, ebenfalls alles Organische und Schicksalhafte tötenden materialistischen Geschichtsauffassung. Deshalb ist das morphologische Element des Kausalen ein Prinzip, das des Schicksals aber eine Idee — die sich nicht „erkennen“, beschreiben, definieren, die sich nur fühlen und innerlich erleben läßt, die man entweder niemals begreift oder deren man völlig gewiß ist, wie der frühe Mensch und unter den späten alle wahrhaft bedeutenden, der Gläubige, der Liebende, der Künstler, der Dichter.
Und so erscheint das Schicksal als die eigentliche Daseinsart des Urphänomens, in dem vor dem geistigen Auge sich die lebendige Idee des Werdens unmittelbar entfaltet. So beherrscht die Schicksalsidee das gesamte Weltbild der Geschichte, während alle Kausalität, welche die Daseinsart von Gegenständen bezeichnet, welche den gegenwärtigen Empfindungsinhalt zu wohlunterschiedenen und abgegrenzten Dingen, Eigenschaften, Verhältnissen prägt, als Form des Verstandes dessen alter ego, die gewordene Natur bildet.
[S. 170]
Organismen lassen sich als werdend oder als geworden betrachten. Ich darf von Gesetzen, von Ursache und Wirkung im erfahrungsmäßig erkennbaren Bau von Pflanzen und Tieren reden, solange ich sie nämlich als Elemente im sinnlich-augenblicklichen Ganzen der mechanischen Umwelt erfasse. Dann ist sogar das Goethe so verhaßte Experiment logisch und zulässig. Aber die Anatomie und Physiologie mit der stofflichen Natur als Objekt berühren nichts von der andern Welt, von den Schicksalen der einzelnen Pflanzen und Tiere, ihrer Gattungen und ganzer Klassen und Reiche. Hier handelt es sich nicht darum, was sie sind, sondern was aus ihnen wird. Jeder Grashalm, jedes Insekt hat nicht nur eine Natur, sondern auch eine Geschichte. Hier darf ich, vor einem Weltbilde andrer Ordnung, von einem Schicksal sogar in der Physik reden. Es liegt ein großer Sinn in dem Worte vom „Schicksal einer wissenschaftlichen Entdeckung“, etwa der mechanischen Wärmetheorie. Ein Blitzschlag bleibt im Zusammenhang der Historie immer ein Schicksalsmoment wie jener, der im Leben Luthers die entscheidende Wendung herbeiführte, mag er als nicht individuelles Ereignis, sondern als prinzipiell beständig möglicher Vorgang ebenso notwendig auch dem Mechanismus des elektrodynamischen Naturbildes angehören. Den antiken Menschen vorausgesetzt, kann man seine „Natur“, die für ihn allein vorhandene und wahre Natur, analysieren. Das hat Demokrit getan. Aber eben in dieser Voraussetzung liegt das Schicksalsmoment, von dem das Dasein einer Natur, eines Weltbildes abhängig ist. Es ist Schicksal, daß durch Newton sich eine dynamische Weltfassung aus der Struktur des abendländischen Geistes entwickelt hat. Dieser in sich geschlossene, höchst überzeugende Komplex „unumstößlicher Wahrheiten“ ist in einem sehr bedeutsamen Sinne von dem Entwicklungsgang, den allgemeinen, nationalen und privaten Schicksalen, der Lebensdauer dieser nordischen Seele abhängig, nicht umgekehrt. Jeder große Physiker, der als Persönlichkeit seinen Entdeckungen doch immer eine eigene Richtung und Farbe gibt, jede Hypothese, die ohne einen individuellen Beigeschmack ganz unmöglich ist, jedes Problem, das in die Hände gerade dieses und keines andern Forschers geriet, bedeuten ebenso viele Schicksalsfügungen für die Gestalt,[S. 171] welche die Lehre zuletzt erhalten hat. Wer das bestreitet, der ahnt nicht, wieviel Bedingtes in den absoluten Momenten der Mechanik steckt. Der berühmte musikalische Streit der Gluckisten und Piccinisten ist das genaue Seitenstück der großen Kontroversen auf dem Gebiete der optischen und elektrodynamischen Theorien (Newton und Huygens, J. R. Mayer und Thomson). Es handelt sich um Stilfragen, das heißt um Alles, um das gesamte Naturbild. Es gibt physikalische Systeme, wie es Tragödien und Sinfonien gibt. Es gibt hier Schulen, Traditionen, Manieren, Konventionen wie in der Malerei. Man kann sich das Moment des Schicksals aus dem lebendigen Weltwerden nicht fortdenken, mag es sich um einen Schmetterling oder eine Kultur handeln. Leben, Sein und ein Schicksal haben — das fließt zusammen. Aber man fühlt das Zwingende der Vorstellung, daß jede aus dem Kausalprinzip konstruierte Welt, jede Natur — und jede reifgewordene Kultur hat da ihre eigne und sogar „allein richtige“ — irgendwie nur im Geiste und für den Geist da ist, der sie als seine ihm angemessene und komplementäre Form der Sinnlichkeit dem Gewordnen, Ausgedehnten, Begrenzten auferlegt. Die dunkle Frage nach den Grenzen der Gültigkeit der Kausalität oder was nunmehr dasselbe ist, nach den Schicksalen des einzelnen Naturbildes, erscheint noch rätselhafter, wenn wir zu dem bestimmten Gefühl gelangen, daß, wie alle seelischen und symbolischen Äußerungen bestätigen, für den frühen Menschen eine streng kausal geordnete Umwelt gar nicht existiert und daß wir, späte Menschen, die im wachen Zustande unter der beständigen Tyrannei eines mechanisierenden Verstandes stehen, in allen Momenten strenger Aufmerksamkeit — auch jetzt noch den einzigen, wo wir tatsächlich eine kausalgesetzliche Außenwelt im Stile unserer Physik besitzen — bestenfalls behaupten können, meilenweit von jeder Möglichkeit eines Beweises entfernt, daß auch „damals“, also außerhalb jener für uns bindenden Momente, das Prinzip der Kausalität geherrscht haben muß — was nichts anderes heißen will, als daß wir unser Gedächtnisbild von dem „Weltall“ jener Zeiten und Menschen dem Augenblicksbilde der gegenwärtigen, eignen, mechanischen Natur unterwerfen. Der frühe Mensch geht keineswegs so weit, daß er sein Weltbild ganz unpersönlich, gewissermaßen im Namen[S. 172] der ganzen Menschheit, empfängt, und sein Gefühl ist ohne Zweifel, als ein historisches, das ursprünglichere und echtere.
Erst aus dem Weltgefühl der Sehnsucht und dessen Verdeutlichung in der Schicksalsidee wird nunmehr das Zeitproblem zugänglich, dessen Gehalt, soweit er das Thema des Buches berührt, kurz angedeutet werden soll. Mit dem Worte Zeit wird immer etwas höchst Persönliches aufgerufen, das, was anfangs als das Eigne bezeichnet worden war, insofern es mit innerer Gewißheit als Gegensatz zu etwas Fremdem empfunden wird, das in, mit und unter den Wirkungen der Sinnenwelt sich in das Leben einmischt. Das Eigne, das Schicksal, die Zeit sind alternierende Worte.
Das Problem der Zeit ist wie das des Schicksals von allen auf die Systematik des Gewordenen beschränkten Denkern mit vollkommenem Unverständnis behandelt worden. In Kants berühmter Theorie ist von dem Merkmal des Gerichtetseins der Zeit mit keinem Worte die Rede. Man hat Äußerungen darüber nicht einmal vermißt. Aber was ist das — Zeit als Strecke, Zeit ohne Richtung? Alles Lebendige besitzt — hier kann ich mich nur wiederholen — „Leben“, Richtung, Streben, Wollen, eine mit der Sehnsucht aufs tiefste verwandte Bewegtheit, die mit der „Bewegung“ des Physikers nicht das geringste zu tun hat. Das Lebendige ist unteilbar und nicht umkehrbar, einmalig, nie zu wiederholen und in seinem Verlaufe mechanisch völlig unbestimmbar: das alles gehört zur Wesenheit des Schicksals. Und „Zeit“ — das, was man beim Klang des Wortes wirklich fühlt, was Musik besser verdeutlichen kann als Worte — hat im Unterschiede vom toten Raume diesen organischen Charakter. Damit aber verschwindet die von Kant und allen andern geglaubte Möglichkeit, die Zeit neben dem Raume einer parallelen erkenntnistheoretischen Erwägung unterwerfen zu können. Raum ist ein Begriff. Zeit ist ein Wort, um etwas Unbegreifliches anzudeuten, ein Wort, das man völlig mißversteht, wenn man es ebenfalls als Begriff wissenschaftlich behandelt. Selbst das Wort Richtung, das sich[S. 173] nicht ersetzen läßt, ist geeignet, durch seinen optischen Gehalt irrezuführen. Der Vektorbegriff der Physik ist ein Beweis dafür.
Dem Urmenschen kann das Wort „Zeit“ nichts bedeuten. Er lebt, ohne es durch den Gegensatz zu etwas anderem nötig zu haben. Er hat Zeit, aber er weiß nichts von ihr. Erst der Geist hoher Kulturen entwirft unter dem mechanisierenden Eindruck einer „Natur“, aus dem Bewußtsein eines streng geordneten Räumlichen, Meßbaren, Begrifflichen das Phantom einer Zeit, das seinem Bedürfnis, alles zu begreifen, zu messen, kausal zu ordnen, genügen soll. Und dieser instinktive Akt, der in jeder Kultur sehr früh erscheint, ein Zeichen verlorner Unschuld des Daseins, schafft jenseits des echten Lebensgefühls das, was alle Kultursprachen Zeit nennen und was dem erkennenden Geiste zu einer anorganischen ebenso irreführenden als geläufigen Größe geworden ist. Bedeuten aber die identischen Phänomene der Ausdehnung, Grenze und Kausalität eine Beschwörung und Bannung der fremden Mächte durch das Seelentum — Goethe spricht einmal von „dem Prinzip verständiger Ordnung, das wir in uns tragen, das wir als Siegel unserer Macht auf alles prägen möchten, was uns berührt“ — ist alles Gesetz eine Fessel, welche die Weltangst dem zudrängenden Sinnlichen anlegt, eine tiefe Notwehr des Lebens, so ist die Konzeption der Zeit als einer Größe innerhalb dieses Zusammenhangs ein später Akt derselben Notwehr, ein Versuch, das quälende innere Rätsel, doppelt quälend für den zur Herrschaft gelangten Verstand, dem es widerspricht, durch die Kraft des Begriffes zu bannen. Es liegt immer ein feiner Haß in dem geistigen Akte, durch den etwas in den Bereich und die Formenwelt des Maßes und Gesetzes gezwungen wird. Man tötet das Lebendige durch die Einbeziehung in den Raum, der leblos ist und leblos macht. In der Geburt liegt der Tod, in der Verwirklichung die Vergänglichkeit. Dies war der Sinn der eleusinischen Mysterien und ihrer Peripetie von der Klage zum Jubel, die Äschylus, der aus Eleusis stammte, später in die attische Tragödie eingeführt hat.[39] Es stirbt etwas im Weibe, wenn es empfängt. Der ewige,[S. 174] aus der Weltangst geborene Haß der Geschlechter hat hier seinen Grund. Der Mensch vernichtet in einem sehr tiefen Sinne, indem er zeugt: durch leibliche Zeugung in der sinnlichen, durch „Erkennen“ in der geistigen Welt. Dieser Zusammenhang war dem mythischen Gefühl primitiver Zeitalter nicht unbekannt. Noch bei Luther hat das Wort erkennen den Nebensinn der geschlechtlichen Zeugung (Adam „erkannte“ sein Weib —). Etwas beim Namen nennen heißt Macht darüber gewinnen: dies ist ein wesentlicher Teil urmenschlicher Zauberkünste. Man schwächte oder tötete seinen Feind, indem man mit dessen Namen gewisse magische Prozeduren vornahm. Etwas von diesem frühesten Ausdruck der Weltangst hat sich in der Sucht aller systematischen Philosophie erhalten, das Unfaßliche, dem Geist Allzumächtige durch Begriffe, wenn es nicht anders ging, durch bloße Namen abzutun. „Philosophie“, die Liebe zur Weisheit, ist die Furcht und der Haß gegen das Unbegreifliche. Was benannt, begriffen, gemessen ist, ist überwältigt, starr, „tabu“ geworden. Noch einmal: „Wissen ist Macht.“ Hier liegt die tiefste Wurzel des Unterschiedes idealistischer und realistischer Weltanschauungen. Er entspricht dem Doppelsinn des Wortes „scheu“. Die einen entspringen aus der scheuen Ehrfurcht, die anderen aus dem Abscheu vor dem Unzugänglichen. Die einen schauen an, die anderen wollen unterwerfen, mechanisieren, unschädlich machen. Plato und Goethe nehmen das Geheimnis hin, Aristoteles und Kant wollen es vernichten. Das tiefste Beispiel für diesen Hintersinn alles Realismus bietet das Zeitproblem. Das Unheimliche der Zeit, das Leben selbst soll hier beschworen, durch die Magie der Begrifflichkeit vernichtet werden.
Alles, was in der „wissenschaftlichen“ Philosophie, Psychologie, Physik über die Zeit gesagt worden ist — eine vermeintliche Antwort auf die Frage, die nicht hätte gestellt werden sollen: was nämlich die Zeit „ist“ — betrifft niemals das Geheimnis selbst, sondern lediglich ein räumlich gestaltetes, stellvertretendes Phantom, in dem die Lebendigkeit der Richtung,[S. 175] ihre eigenmächtige Bewegtheit durch die abstrakte Vorstellung einer Strecke ersetzt worden ist, ein mechanisches, meßbares, teilbares und umkehrbares Abbild des in der Tat nicht Abzubildenden; eine Zeit, die mathematisch in Ausdrücke wie √̅t, t2, -t gebracht werden kann, welche die Annahme einer Zeit von der Größe Null oder negativer Zeiten wenigstens nicht ausschließen. Die moderne Relativitätstheorie, welche im Begriff steht, die Mechanik Newtons — im Grunde bedeutet das: seine Fassung des Bewegungsproblems — zu stürzen, läßt Fälle zu, in welchen die Bezeichnungen „früher“ und „später“ sich umkehren; die mathematische Begründung dieser Theorie (durch Minkowski) wendet imaginäre Zeiteinheiten zu Maßzwecken an. Ohne Zweifel kommt hier der Bereich des Lebens, des Schicksals, der lebendigen, historischen Zeit gar nicht in Frage. Man setze in irgendeinem philosophischen oder physikalischen Text für Zeit das Wort Schicksal ein und man wird plötzlich fühlen, wohin sich der Verstand verirrt hat und wie unmöglich die Gruppe „Raum und Zeit“ ist. Was nicht erlebt und gefühlt, was nur gedacht wird, nimmt notwendig räumliche Qualitäten an. Die physikalische und die Kantische Zeit ist eine Linie. Ihre organische Bewegtheit, ihr seelenhafter Gehalt sind in den Formeln und Begriffen verschwunden. So erklärt es sich, daß kein systematischer Philosoph mit den Begriffen Vergangenheit und Zukunft etwas hat anfangen können. In Kants Ausführungen über die Zeit kommen sie gar nicht vor. Man sieht auch nicht, in welcher Beziehung sie zu dem stehen sollten, was er dort behandelt. Damit erst wird es möglich, „Raum und Zeit“ als Größen derselben Ordnung in funktionale Abhängigkeit voneinander zu bringen, wie dies besonders deutlich die vierdimensionale Vektoranalysis zeigt. (Die Dimensionen sind x, y, z und t, die in Transformationen völlig gleichwertig erscheinen.) Schon Lagrange nannte (1813) die Mechanik ohne weiteres eine vierdimensionale Geometrie und selbst Newtons vorsichtiger Begriff des tempus absolutum sive duratio entzieht sich nicht dieser denknotwendigen Verwandlung des Lebendigen in bloße Ausdehnung. Eine einzige tiefe und ehrfürchtige Bezeichnung der Zeit habe ich in der älteren Philosophie gefunden. Sie steht bei Augustinus (Conf.[S. 176] XI, 14): Si nemo ex me quaerat, scio; si quaerenti explicare velim, nescio.
Der Mißgriff, „Raum und Zeit“ als morphologisch gleichartiges Größenpaar der Betrachtung zu unterwerfen, schließt jedes Verständnis des wahren Zeitproblems aus. Schon wenn neuere Philosophen — sie tun es alle — sich der Wendung bedienen, daß die Dinge „in der Zeit“ wie im Raume sind und nichts „außerhalb“ ihrer „gedacht“ werden könne, imaginieren sie lediglich eine zweite Räumlichkeit neben der gewöhnlichen. Man könnte mit gleichem Rechte zwei „Kräfte“ wie den Magnetismus und die Hoffnung gemeinsam abhandeln wollen. Es hätte Kant, als er von den „beiden Formen“ der Anschauung sprach, doch nicht entgehen sollen, daß man sich wissenschaftlich bequem über den Raum verständigen kann — wenn auch nicht ihn im landläufigen Sinne erklären, was jenseits des wissenschaftlich Möglichen liegt — während eine Betrachtung in demselben Stil der Zeit gegenüber völlig versagt. Der Leser der „Kritik der reinen Vernunft“ und der „Prolegomena“ wird bemerken, daß Kant für den Zusammenhang von Raum und Geometrie einen sorgfältigen Beweis liefert, es aber peinlich vermeidet, dasselbe für Zeit und Arithmetik zu tun. Hier bleibt es bei der Behauptung, und die ständig wiederholte Analogie der Begriffe täuscht über die Lücke hinweg, deren Unausfüllbarkeit die Unhaltbarkeit seines Schemas offenbart hätte. Das begrifflich-exakte Denken deckt sich durchaus mit dem Bereich des Gewordenen und Ausgedehnten. Raum, Gegenstand, Zahl, Begriff, Kausalität sind so eng verschwisterte Formelemente, daß es unmöglich ist, wie unzählige verfehlte Systeme beweisen, das eine unabhängig vom andern zu untersuchen. Die Logik ist ein Abbild der jeweiligen Mechanik und umgekehrt. Das Denkvermögen, dessen Struktur die mechanistische Psychologie beschreibt, ist ein Abbild der jeweiligen Raumwelt, wie sie die Physik behandelt. Begriffe — man beachte die Herkunft des Wortes von „begreifen“, in die Hand nehmen — sind körperhafte Werte; Definitionen, Urteile, Schlüsse, Systeme, Klassifikationen sind Formelemente einer inneren Räumlichkeit, sind etwas so mit Optik Gesättigtes, daß der Reiz, den Denkprozeß unmittelbar graphisch und tabellarisch, d. h. räumlich darzustellen[S. 177] — man denke an Kants und Aristoteles’ Kategorientafeln — gerade den abstrakten Denker immer wieder überwältigt hat. Wo es am Schema fehlt, da fehlt es an Philosophie — das ist das uneingestandene Vorurteil aller zünftigen Systematiker gegenüber den „Anschauenden“, denen sie sich innerlich weit überlegen fühlen. Deshalb nannte Kant den Stil des platonischen Denkens ärgerlich „die Kunst, wortreich zu schwatzen“ und deshalb schweigt der Kathederphilosoph noch heute über Goethes Philosophie. Jede logische Operation läßt sich zeichnen. Jedes System ist eine geometrische Art, Gedanken zu handhaben. Deshalb hat die Zeit in einem abstrakten System keinen Platz oder sie fällt seiner Methode zum Opfer.
Damit ist auch das allverbreitete populäre Mißverständnis widerlegt, welches die Zeit mit der Arithmetik, den Raum mit der Geometrie in eine höchst triviale Verbindung bringt, ein Irrtum, dem Kant nicht hätte erliegen sollen, wenn man auch von Schopenhauers Verständnislosigkeit für Mathematik kaum etwas anderes erwartet. Weil der lebendige Akt des Zählens mit der Zeit irgendwie in Berührung steht, hat man immer wieder — auf ein Schema versessen — Zahl und Zeit vermengt. Aber Zählen ist keine Zahl, so wenig Zeichnen eine Zeichnung ist. Zählen und Zeichnen sind ein Werden, Zahlen und Figuren sind Gewordnes. Kant und die andern haben dort den lebendigen Akt (das Zählen), hier dessen Resultat (die formalen Verhältnisse der fertigen Figur) ins Auge gefaßt. Das eine gehört in den Bereich des Lebens und der Richtung, das andre in den der Ausdehnung und Kausalität. Die gesamte Mathematik, populär gesprochen also Arithmetik und Geometrie, beantworten das Was, also die Frage nach der natürlichen Ordnung der Dinge. Im Gegensatz dazu steht die Frage nach dem Wann der Dinge, die spezifisch historische Frage, die Frage nach dem Schicksal, der Zukunft, der Vergangenheit. All das liegt in dem Worte Zeitrechnung, das der naive Mensch vollkommen richtig versteht. Kausalität ist durchaus mit der Zahlenwelt verbunden, sei es durch das Prinzip der Funktion im Abendlande oder das der Größe in der Antike. Physik und Mathematik verfließen ineinander (in der reinen Mechanik). Zeit, Schicksal, Geschichte stehen diesem Kreise völlig fern. Zu ihnen gehört die Chronologie.
[S. 178]
Es gibt keinen Gegensatz von Arithmetik und Geometrie.[40] Jede Idee einer Zahl — das wird das erste Kapitel hinlänglich gezeigt haben — gehört im vollen Umfange dem Bereich des Ausgedehnten und Gewordnen an, sei es als euklidische Größe, sei es als analytische Funktion. Und in welches der beiden Gebiete sollten denn die zyklometrischen Funktionen, der Binomialsatz, die Riemannschen Flächen, die Gruppentheorie gehören? Kants Schema war durch Euler und d’Alembert schon widerlegt, bevor er es konzipiert hatte und nur die Unvertrautheit der Philosophen nach ihm mit der Mathematik ihrer Zeit — sehr im Gegensatz zu Descartes, Pascal und Leibniz, welche die Mathematik ihrer Zeit aus den Tiefen ihrer Philosophie heraus selbst geschaffen haben — hat es verschuldet, daß diese teilweise recht schülerhaften Ansichten von der Beziehung von „Raum und Zeit“ zu „Geometrie und Arithmetik“ sich kaum angefochten weiter vererbten. Aber es gibt keine Berührung des Werdens mit irgendeinem Gebiete der Mathematik. Nicht einmal die tief begründete Annahme Newtons, in dem ein tüchtiger Philosoph steckte, daß er im Prinzip seiner Differentialrechnung (Fluxionsrechnung) das Problem des Werdens, das Zeitproblem also — übrigens in einer viel feineren als der kantischen Fassung — unmittelbar in Händen habe, ließ sich aufrechterhalten, so sehr sie unter Philosophen heute noch Mode ist. Bei der Entstehung von Newtons Fluxionslehre hatte das metaphysische Bewegungsproblem eine entscheidende Rolle gespielt. Seit Weierstraß indessen bewiesen hat, daß es stetige Funktionen gibt, die nur teilweise oder gar nicht differentiiert werden können, ist dieser tiefste jemals unternommene Versuch, dem Zeitproblem mathematisch nahe zu kommen, abgetan.
Die Zeit ist ein Gegenbegriff. Hier wird zum ersten Male eine Eigentümlichkeit der logischen Produktivität berührt, die von höchster Bedeutung ist. Der Intellekt, unfähig, das Schicksalsgefühl seiner Formenwelt einzugliedern, hat vom Raume[S. 179] aus als dessen logisches Seitenstück einen Begriff „Zeit“ („Nicht-raum“) konstruiert. Wir würden weder das Wort noch dessen uns als ständig denkenden Wesen geläufigen, völlig verfehlten Inhalt besitzen, wenn nicht der mächtige Drang zum Begreifen (in optische Grenzen bannen) die Seele verführt hätte. Es folgt daraus, daß der antike Geist, welcher das Ausgedehnte, wie wir sehen werden, einer ganz andern Symbolik unterwarf als wir, dementsprechend auch als Zeit sich etwas andres vorstellte. Aber es läßt sich auf keine Weise begreiflich machen, was an Stelle unsrer „Zeit“ in analogen Fällen dem apollinischen Menschen vorschwebte.
Das Raumproblem ist also die einzige Aufgabe aller exakten Wissenschaft, die sich ausschließlich mit dem Gewordnen beschäftigt, um dessen immanente Notwendigkeit in Gestalt des mathematisch zu behandelnden Kausalitätsprinzips restlos zu zergliedern. Es gibt in diesem Sinne nur Naturwissenschaften, zu denen Logik und Erkenntnistheorie gehören. Das gemeinsame Gefühlsmoment der Weltangst und ein identisches Ziel, die Bannung und Beschwörung des Fremden durch unumstößliche Gesetze verbinden sie. Die wissenschaftlich unzugängliche Schicksalsidee, die sich hinter dem Worte Zeit verbirgt, gehört in den Bereich unmittelbarer Erlebnisse und Intuitionen.
In jedem Kunstwerk, das den ganzen Menschen, den ganzen Sinn des Daseins offenbart, liegen Angst und Sehnsucht beieinander. Die Kunsttheorie hat das wohl gefühlt. Man hat immer wieder als „Inhalt“ dasjenige zu isolieren versucht, was Richtung, Schicksal, Leben, Sehnsucht, unter „Form“ das, was Ausdehnung, Geist, Grund und Folge, Angst repräsentiert. Das Ausgedehnte, das gestaltete Material, trägt die elementare Symbolik jeder Kunst. Alles was Kanon, Schule, Konvention, Technik heißt, alles Begreifliche, Folgerichtige, Erlernbare, Zahlenmäßige in Linie, Farbe, Ton, Bau, Ordnung also gehört hierher; die kanonische, von Polyklet schriftlich niedergelegte Gliederung der nackten Statue, der Innenraum gotischer Dome und ägyptischer Totentempel, die Kunst der Fuge. Sie sind alle Arten einer Tektonik. Sie wollen alle etwas Sinnliches in starre, „ewige“, d. h. zeitlose Form bannen.
[S. 180]
Die Architektur großen Stils, die allein von allen Künsten das Fremde und Angsteinflößende selbst, das unmittelbar Ausgedehnte, den Stein behandelt, ist deshalb die selbstverständliche Frühkunst aller Kulturen, die erst Schritt für Schritt den geistigeren Künsten der Statue, des Gemäldes, der Komposition mit ihren indirekten Formmitteln den Vorrang abtritt. Michelangelo, der von allen großen Künstlern des Abendlandes unter dem beständigen Alpdruck der Weltangst wohl am schwersten gelitten hat, ist darum allein von allen Meistern der Renaissance vom Architektonischen niemals freigeworden. Er malte sogar, als ob die Farbflächen Stein, Gewordnes, Starres, Gehaßtes wären. Seine Arbeitsweise war der erbitterte Kampf gegen die feindseligen Mächte im Kosmos, die in Gestalt des Materials ihm entgegentraten, während Lionardos, des Sehnsüchtigen, Farben wie eine freiwillige Inkarnation des Seelischen wirken. In jedem architektonischen Formproblem kommt aber strengste Logik zum Vertrag, Mathematik sogar, sei es in den antiken Säulenordnungen das euklidische Verhältnis von Träger und Last, sei es in den „analistisch“ angelegten Fassaden des Barock das dynamische von Kraft und Masse. Die berühmte Kontroverse Kant-Hume über die Apriorität des Kausalen, aus welcher die „Kritik der reinen Vernunft“ hervorging, ist mit mancher über ein künstlerisches Formproblem innerlich verwandt. Die Symbolik der Richtung, des Schicksals, aber steht jenseits aller mechanischen „Technik“ der großen Künste und ist der formalen Ästhetik kaum zugänglich. Sie liegt zum Beispiel in dem stets gefühlten, aber nie, weder von Lessing noch von Hebbel klar gedeuteten Widerspruch antiker und abendländischer Tragik, in der Szenenfolge altägyptischer Reliefs, überhaupt der reihenweisen Ordnung ägyptischer Statuen, Sphinxe, Tempelsäle, in der Wahl von Diorit und Basalt, durch welche Dauer und Zukunft bejaht werden, gegenüber dem Holz frühgriechischer Skulpturen, in der Geste einer Statue des Phidias, deren eminente Gegenwärtigkeit auch nur den Gedanken an Vergangenheit und Zukunft abweist, während im Gegensatz dazu der Stil der Fuge den einzelnen Augenblick im Unendlichen löst. Wie man sieht, gehört dies alles nicht zur starren „Technik“, sondern zum „Genie“, nicht zum Können, sondern zum Müssen[S. 181] des Künstlers, nicht zur mechanischen Form des Geschaffenen, sondern zum lebendigen Schöpfungsakte selbst. Nicht die Mathematik und das abstrakte Denken, sondern die Geschichte und die großen Künste — ich füge hinzu: der große Mythus — geben den Schlüssel zum Problem der Zeit.
Aus dem Sinne, welcher hier der Kultur als einem Urphänomen und dem Schicksal als der organischen Logik des Daseins gegeben wurde, folgt, daß notwendig jede Kultur ihre eigne Schicksalsidee besitzen muß, ja daß in dem Gefühl, jede große Kultur sei nichts anderes als die Verwirklichung und Gestalt einer einzigen, bestimmten Seele, diese Folgerung schon eingeschlossen liegt. Was wir Fügung, Zufall, Verhängnis, Schicksal, der antike Mensch Nemesis, Ananke, Tyche, Fatum, der Araber Kismet und alle anderen anders nennen, was niemand dem andern, dessen Leben gerade Ausdruck seiner Idee ist, nachfühlen kann und was sich in Worten nicht weiter beschreiben läßt, stellt eben diese einmalige, nie sich wiederholende Fassung der Seele dar, deren jeder für sich völlig gewiß ist.
Ich wage es, die antike Fassung der Schicksalsidee euklidisch zu nennen. In der Tat ist es die sinnlich-wirkliche Person des Ödipus, sein „empirisches Ich“, mehr noch, sein σῶμα, das vom Schicksal getrieben und gestoßen wird. Ödipus klagt (Rex 242), daß Kreon seinem Leibe Übles getan habe und (Col. 355), daß das Orakel seinem Leibe gelte. Und Äschylus spricht in den Choephoren (704) von Agamemnon als dem „flottenführenden königlichen Leibe“. Es ist dasselbe Wort σῶμα, das die Mathematiker mehr als einmal für ihre Körper gebrauchen. König Lears Schicksal aber, ein analytisches, um auch hier an die entsprechende Zahlenwelt zu erinnern, ruht ganz in dunklen innern Beziehungen: Die Idee des Vatertums taucht auf; seelische Fäden spinnen sich durch das Drama, unkörperlich, jenseitig, und werden durch die zweite, kontrapunktisch gearbeitete Tragödie im Hause Glosters seltsam beleuchtet. Lear ist zuletzt ein bloßer Name, ein Mittelpunkt für[S. 182] etwas Grenzenloses. Diese Fassung des Schicksals ist eine „infinitesimale“, in unendlicher Räumlichkeit und durch endlose Zeiten ausgebreitete; sie berührt das leibliche, euklidische Dasein gar nicht; sie trifft nur die Seele. Der wahnsinnige König zwischen dem Narren und dem Bettler im Sturm auf der Heide — das ist der Gegensatz zur Laokoongruppe. Da ist die faustische gegenüber der apollinischen Art zu leiden. Sophokles hatte auch ein Laokoondrama geschrieben. Ohne Zweifel war in ihm von Seelenleid nicht die Rede. Und hier möchte man den Ausdruck „Idee des Daseins“ vorziehen, zumal wenn man an Hebbels tragische Entwürfe denkt, der in einem gewissen Sinne die abendländische Tragödie abgeschlossen und ihre letzten Möglichkeiten erschöpft hat. Wer überhaupt ein großes Drama kosmisch zu durchschauen und nicht nur in seiner Szenik anzuschauen vermag, der wird die Verwandtschaft der Konzeptionen des Sophokles mit der antiken Geometrie und derjenigen Shakespeares, Goethes, Kleists mit der Analysis, also den Gegensatz von Größe und Beziehung auch in der tiefsten Wurzel des künstlerischen Schöpfungsaktes fühlen.
Wir nähern uns damit einem andern Zusammenhang von großer Symbolik. Man nennt das typische Drama des Abendlandes Charakterdrama und sollte das griechische dann als Situationsdrama bezeichnen. Man betont damit, was eigentlich von dem Menschen beider Kulturen als Grundform seines Lebens empfunden und mithin durch die Tragik, das Schicksal, in Frage gestellt wird. Sagt man für Richtung des Lebens Nichtumkehrbarkeit, so hat man den Kern jedes möglichen tragischen Konflikts. Wir haben eine antike Tragödie des Augenblicks und eine abendländische der historisch-psychischen Entwicklung vor uns. So empfand eine ahistorische und eine extrem historische Seele sich selbst. Unsere Tragik entstand aus dem Gefühl einer unerbittlichen Logik des Werdens. Der Grieche fühlte das Alogische, das blinde Ungefähr des Moments. Und man begreift nun, weshalb gleichzeitig mit dem abendländischen Drama eine mächtige Porträtkunst — mit ihrem Höhepunkt in Rembrandt — aufblühte und erlosch, eine Art historischer und psychologischer Kunst, die deshalb im klassischen Griechenland zur Blütezeit des attischen Theaters aufs[S. 183] strengste verpönt war; man denke an das Verbot ikonischer Statuen bei den Weihgeschenken und daran, daß sich — seit Lippos — eine schüchterne Art idealisierender Bildniskunst genau damals hervorwagte, wo die große Tragödie durch das soziale Typendrama Menanders in den Hintergrund gedrängt wurde. Im Grunde tragen alle griechischen Statuen eine stereotype Maske wie die Schauspieler im Dionysostheater. Alle bringen sie somatische Situationen in der präzisesten Fassung. Physiognomisch sind sie stumm, körperlich sind sie notwendig nackt. „Charakterköpfe“ hat erst der Hellenismus gebracht. Und wir werden wieder an die beiden entsprechenden Zahlenwelten erinnert, in deren einer handgreifliche Resultate errechnet wurden, während in der andern der Charakter von Beziehungsgruppen von Funktionen, Gleichungen, überhaupt von Formelementen gleicher Ordnung morphologisch untersucht und als solcher in gesetzmäßigen Ausdrücken fixiert wird.
Die Fähigkeit, Geschichte zu erleben und die Art, wie sie, wie vor allem auch das eigne Werden durchlebt wird, ist bei den einzelnen Menschen sehr verschieden.
Jede Kultur besitzt schon eine streng individuelle Art, Natur zu sehen, zu erkennen oder, was dasselbe ist, sie hat ihre eigne und eigentümliche Natur, die keine andere Art Mensch in genau derselben Gestalt besitzen kann. Ganz ebenso hat auch jede Kultur und in ihr, mit Unterschieden geringeren Grades, jeder Einzelne eine durchaus eigne Art von Geschichte, in deren Bilde, in deren Stil er das allgemeine und das persönliche, das innere und äußere, das welthistorische und das biographische Werden unmittelbar anschaut, fühlt und erlebt. So ist der autobiographische Hang der abendländischen Menschheit der antiken völlig fremd. Der extremen Bewußtheit der Geschichte Westeuropas steht die geradezu traumhafte Unbewußtheit der indischen gegenüber. Und was ist es, das arabische Menschen, Paulus, Plotin oder Mohammed vor sich sahen, wenn sie das Wort Weltgeschichte aussprachen? Aber wenn es schon höchst schwierig ist, sich von der Natur, der kausal geordneten[S. 184] Umwelt andrer eine genaue Vorstellung zu machen, obwohl in ihr das spezifisch Erkennbare zum Bilde vereinheitlicht ist, so ist es völlig unmöglich, den historischen Weltaspekt fremder Kulturen, das aus ganz anders angelegten Seelen gestaltete Bild des Werdens mit den Kräften der eignen Seele vollkommen zu durchdringen. Hier wird immer ein unzugänglicher Rest bleiben, um so größer, je geringer der eigne historische Instinkt, der physiognomische Takt, die eigne Menschenkenntnis ist. Trotzdem ist die Lösung dieser Aufgabe eine Voraussetzung alles tiefern Weltverständnisses. Die historische Umwelt der andern ist ein Teil ihres Wesens, und man versteht niemand, wenn man sein Zeitgefühl, seine Idee vom Schicksal, den Stil und Bewußtseinsgrad seines Innenlebens nicht kennt. Was hier sich nicht unmittelbar in Bekenntnissen auffinden läßt, müssen wir also der Symbolik der äußern Kultur entnehmen. So erst wird das an sich Unbegreifliche zugänglich und dies gibt dem historischen Stil einer Kultur und den dazu gehörigen großen Zeitsymbolen ihren unermeßlichen Wert.
Als eines dieser kaum je begriffenen Zeichen war schon die Uhr genannt worden, eine Schöpfung hochentwickelter Kulturen, die immer geheimnisvoller wird, je mehr man darüber nachdenkt. Die antike Menschheit verstand sie zu entbehren — nicht ohne Absichtlichkeit —, obwohl Uhren in den beiden ältern Welten der babylonischen und ägyptischen Seele mit ihrer strengen Astronomie und Zeitrechnung, ihrem tiefen Blick für Vergangenheit und Zukunft und deren Knüpfung an den Augenblick, ständig (als Sonnenuhren und Wasseruhren) in Gebrauch waren. Aber das antike Dasein, euklidisch, beziehungslos, punktförmig, war im gegenwärtigen Moment völlig beschlossen. Nichts sollte an Vergangnes und Künftiges mahnen. Die Archäologie fehlt der Antike ebenso wie deren psychische Umkehrung, die Astrologie. Es gab keine Zeitrechnung, denn die Olympiadenrechnung war lediglich ein literarischer Notbehelf. In antiken Städten erinnert nichts an die Dauer, an die Vorzeit, an das Bevorstehende, keine pietätvoll gepflegte Ruine, kein für noch ungeborne Generationen vorgedachtes Werk, kein trotz technischer Schwierigkeiten mit Bedeutung gewähltes Material. Der dorische Grieche hat die mykenische Steintechnik unbeachtet gelassen und baute wieder in Holz und Lehm, trotz[S. 185] des mykenischen und ägyptischen Vorbildes und trotz des Reichtums seiner Landschaft an den besten Gesteinen. Der dorische Stil ist ein Holzstil. Noch zur Zeit des Pausanias sah man am Zeustempel in Olympia die letzte nicht ausgewechselte Holzsäule. In einer antiken Seele ist das Organ für Geschichte, das Gedächtnis in dem hier stets vorausgesetzten Sinne, das den Organismus der persönlichen Vergangenheit, die Genesis des Innenlebens immer gegenwärtig erhält, nicht vorhanden. Es gibt keine „Zeit“. Daß Cäsar den Kalender reformierte, darf man beinahe als einen Akt der Emanzipation vom antiken Lebensgefühl bezeichnen: Aber Cäsar dachte auch an den Verzicht auf Rom und an die Verwandlung des Stadtstaates in ein dynastisches, also dem Symbol der Dauer unterstelltes Reich mit dem Schwerpunkt in Alexandria, von wo sein Kalender stammt. Seine Ermordung wirkt wie eine letzte Auflehnung eben dieses, in der Polis, der Urbs Roma verkörperten, der Dauer feindlichen Lebensgefühls.
Man erlebte noch damals jede Stunde, jeden Tag für sich. Das gilt vom einzelnen Hellenen und Römer, von der Stadt, der Nation, der ganzen Kultur. Die von Kraft und Blut strömenden Feste, Palastorgien und Zirkuskämpfe unter Nero und Caligula, die Tacitus, ein echter Römer, allein beschreibt, während er für das Leben der weiten Landschaft des Imperiums kein Auge, keine Worte hat, sind der letzte prachtvolle Ausdruck dieses euklidischen, den Leib, die Gegenwart vergötternden Weltgefühls. Die Inder, deren Nirwana auch durch den Mangel an irgendwelcher Zeitrechnung ausgedrückt ist, besaßen ebenfalls keine Uhren und also keine Geschichte, keine Lebenserinnerungen, keine Sorge. Was wir, eminent historisch angelegte Menschen, indische Geschichte nennen, ist ohne das geringste Bewußtsein seiner selbst verwirklicht worden. Das Jahrtausend der indischen Kultur von den Veden bis auf den Buddha herab wirkt auf uns wie die Regungen eines Schlafenden. Hier war das Leben wirklich ein Traum. Nichts steht diesem Indertum ferner als das Jahrtausend der abendländischen Kultur. Niemals, auch im alten China nicht, war man wacher, bewußter, niemals ist die Zeit tiefer gefühlt und mit dem vollen Bewußtsein ihrer Richtung und schicksalsschweren[S. 186] Bewegtheit erlebt worden. Die Geschichte Westeuropas ist gewolltes, die indische ist widerfahrenes Schicksal. Im griechischen Dasein spielen Jahre keine Rolle, im indischen kaum Jahrzehnte; hier ist die Stunde, die Minute, zuletzt die Sekunde von Bedeutung. Von der tragischen Spannung historischer Krisen, wo der Augenblick schon erdrückend wirkt wie in den Augusttagen 1914, hätte weder ein Grieche noch ein Inder eine Vorstellung haben können. Aber solche Krisen können tiefe Menschen des Abendlandes auch in sich erleben, Hellenen nicht. Über unsrer Landschaft hallen Tag und Nacht von Tausenden von Türmen die Glockenschläge, die ständig Zukunft an Vergangnes knüpfen und den flüchtigen Moment der „antiken“ Gegenwart in einer ungeheuren Beziehung auflösen. Der Moment, welcher die Geburt dieser Kultur bezeichnet, die Zeit der Sachsenkaiser, sah auch schon die Erfindung der Räderuhren.[41] Ohne peinlichste Zeitmessung — eine Chronologie des Kommenden, die durchaus unserm ungeheuren Bedürfnis nach Archäologie, Erhaltung, Ausgrabung, Sammlung alles Vergangnen entspricht — ist der abendländische Mensch nicht denkbar. Die Barockzeit steigerte das gotische Symbol der Turmuhren noch zu dem grotesken der Taschenuhren, die den Einzelnen begleiten.[42] Und sind wir es nicht auch, welche die Wägung und Messung des inneren Lebens zur strengsten Vollendung geführt haben? Ist unsere Kultur nicht die der Selbstbiographien, Tagebücher, Konfessionen und unerbittlichen ethischen Selbstprüfungen? Hat je eine andre Art Mensch sich bis zu dem während der Epoche der Kreuzzüge ausgebildeten Symbol der Ohrenbeichte erhoben, von der Goethe sagte, daß sie den Menschen nie hätte genommen werden sollen? Ist nicht unsre ganze große Kunst — sehr im Gegensatz zur antiken — ihrem Gehalte nach Bekenntniskunst? Es wird niemand über Welt- und Staatengeschichte nachdenken, Geschichte andrer[S. 187] fühlen und begreifen können, der nicht in sich selbst mit vollem Bewußtsein Geschichte, Schicksal, Zeit erlebt. Deshalb hat die Antike weder eine wahre Weltgeschichte, eine Psychologie der Historie, noch eine tiefe Biographie hervorgebracht. Thukydides und Sokrates bestätigen das. Der eine kannte nur die jüngste Vergangenheit eines engen Völkerkreises, der andere nur ephemere Momente der Einkehr.
Und neben dem Symbol der Uhren steht das andre, ebenso tiefe, ebenso unverstandne der Bestattungsformen, wie sie alle großen Kulturen durch Kulte und Kunst geheiligt haben. In der Urzeit gehen die vielen möglichen Formen noch chaotisch durcheinander, abhängig von Stammessitte und Zweckmäßigkeit. Jede Kultur aber erhebt alsbald eine von ihnen zum höchsten symbolischen Range. Hier wählte der antike Mensch aus tiefstem, unbewußtem Lebensgefühl heraus die Totenverbrennung, einen Akt der Vernichtung, durch den er sein an das Jetzt und Hier gebundenes euklidisches Dasein zu gewaltigem Ausdruck brachte. Er wollte keine Geschichte, keine Dauer, weder Vergangenheit noch Zukunft, weder Sorge noch Auflösung und er zerstörte deshalb, was keine Gegenwart mehr besaß, den Leib eines Perikles und Cäsar, Sophokles und Phidias. Keine zweite Kultur steht dieser darin zur Seite — mit einer bezeichnenden Ausnahme, der vedischen Frühzeit Indiens. Und man bemerke wohl: die dorisch-homerische Frühzeit behandelte diesen Akt mit dem ganzen Pathos eines eben geschaffenen Symbols, die Ilias vor allem, während in den Gräbern von Mykene, Tiryns, Orchomenos die Toten, deren Kämpfe vielleicht gerade den Keim zu jenem Epos gelegt hatten, nach ägyptischer Art bestattet worden waren. Als in der Kaiserzeit neben die Aschenurne der Sarkophag trat — bei Christen und Heiden —, war ein neues Zeitgefühl erwacht wie damals, als auf die mykenischen Schachtgräber die homerische Urne folgte.
Und diese Ägypter, welche ihre Vergangenheit so gewissenhaft im Gedächtnis, in Stein und Hieroglyphen aufbewahrten, daß wir heute, nach vier Jahrtausenden, noch die Regierungszahlen ihrer Könige genau bestimmen können, verewigten auch deren Leib, so daß die großen Pharaonen — ein Symbol von schauerlicher Erhabenheit — heute noch mit erkennbaren Gesichtszügen[S. 188] in unsern Museen liegen, während von den Königen der dorischen Zeit nicht einmal die Namen übrig geblieben sind. Wir kennen Geburts- und Todestag fast aller großen Menschen seit Dante genau. Das scheint uns selbstverständlich. Aber zur Zeit des Aristoteles, auf der Höhe antiker Zivilisation, wußte man nicht mehr, ob Leukippos, der Begründer des Atomismus und Zeitgenosse des Perikles, kaum ein Jahrhundert vorher, überhaupt existiert habe. Dem würde es entsprechen, wenn wir der Existenz Giordano Brunos nicht sicher wären und die Renaissance bereits völlig im Reich der Sage läge.
Und diese Museen selbst, in denen wir die ganze Summe der sinnlich-körperlich gewordenen Vergangenheit zusammentragen! Sind sie nicht auch ein Symbol vom höchsten Range? Sollen sie nicht den „Leib“ der gesamten Kulturhistorie mumienhaft konservieren? Sammeln wir nicht, wie die unzähligen Daten in Milliarden gedruckter Bücher, so alle Werke aller toten Kulturen in diesen hunderttausend Sälen westeuropäischer Städte, wo in der Masse des Vereinigten jedes einzelne Stück dem flüchtigen Augenblick seines wirklichen Zweckes — der einer antiken Seele allein heilig gewesen wäre — entwendet und in einer unendlichen Bewegtheit der Zeit gleichsam aufgelöst wird? Man bedenke, was die Hellenen „Museion“ nannten und welch tiefer Sinn in diesem Wandel des Wortgebrauchs liegt.
Es ist das Urgefühl der Sorge, das die Physiognomie der abendländischen wie der ägyptischen und chinesischen Kulturgeschichte beherrscht und auch noch die Symbolik des Erotischen gestaltet, in dem die Beziehung des gegenwärtigen Menschen zu den folgenden Generationen sich darstellt. Das punktförmige euklidische Dasein der Antike empfand auch da ganz somatisch. Es setzte deshalb in den Mittelpunkt der demetrischen Kulte die Wehen des gebärenden Weibes, in die antike Welt überhaupt das Symbol des Phallus, das Zeichen einer durchaus dem Augenblick geweihten und Vergangenheit wie Zukunft in ihm vergessenden Geschlechtlichkeit. Der Mensch fühlte sich hier als Natur, als Pflanze, als Tier, dem[S. 189] Sinn des Werdens willenlos hingegeben. Der häusliche Kult galt dem genius, d. h. der Zeugungskraft des Familienhauptes. Unsre tiefe und nachdenkliche Sorge stellte dem im abendländischen Kult das Zeichen der Mutter gegenüber, welche das Kind — die Zukunft — an der Brust trägt. Der Marienkult in diesem neuen, faustischen Sinne erblühte erst in den Jahrhunderten der Gotik. Ihre höchste Verkörperung hat sie in Raffaels Sixtina gefunden. Das ist nicht christlich überhaupt, denn das magisch-orientalische Christentum erhob Maria als Theotokos, als Gebärerin Gottes, zu einem ganz anders empfundenen magisch-metaphysischen Symbol. Die stillende Mutter ist der arabischen (byzantinisch-langobardischen) Kunst ebenso fremd wie der hellenischen; sie ist das reinmenschliche Sinnbild der Sorge, und sicherlich steht Gretchen im Faust mit dem tiefen Zauber ihrer unbewußten Mütterlichkeit den gotischen Madonnen näher als alle Marien byzantinischer und ravennatischer Mosaiken.
Nichts ist sorgenvoller als der Aspekt der ägyptischen Geschichte, in der die Fürsorge für alles Vergangene, Tempel, Namen und Mumien der Vorsorge für alles Kommende entspricht, ein Gefühl, das schon zur Zeit des Cheops, 3000 v. Chr., zu einem tief durchdachten Staatsorganismus und später zu einer so meisterhaft angelegten Finanzwirtschaft geführt hat, daß von Alexander dem Großen an die späten antiken Staatsgebilde nur durch Übernahme der Praxis der Pharaonen zu einigermaßen geregelter Verwaltung gelangt sind. So verschieden an sich Buddhismus und Stoizismus, die Altersstimmungen der indischen und antiken Seele sind, im Widerspruch gegen das historische Gefühl der Sorge, in der Verneinung also aller organisatorischen Energie, Pflichtbewußtheit, Tätigkeit, Weitsicht gegenüber sind sie einig und deshalb hat in indischen Königreichen und hellenischen Städten niemand an das Kommende gedacht, weder für seine Person noch für die Gesamtheit. Das carpe diem des apollinischen Menschen galt auch für den antiken Staat. Man wirtschaftete von einem Tage zum andern ohne die Fähigkeit, vorausschauende Pläne zu fassen oder gar sie auf Generationen hin zu verwirklichen. Der antike Staat — obwohl das Vorbild Ägyptens vor Augen stand — hielt sich[S. 190] allein durch fortgesetzte Gewaltmaßnahmen, Plünderung der eignen und fremden Bürger, Münzfälschung, Enteignung, Proskription der Besitzenden; und verfügte er einmal über Reichtümer, so fand er keine bessere Verwendung, als sie an den Pöbel zu verschwenden. Man besaß keine innerlich erworbene Geschichte der Vergangenheit und darum auch kein Auge für die Notwendigkeiten der Zukunft. Man ließ sie herankommen; man versuchte nicht auf sie zu wirken. Und deshalb ist heute der Sozialismus mit seiner unverkennbaren, wenn auch bisher nicht erkannten Verwandtschaft zum Ägyptertum die dem Stoizismus der Zeitstufe nach entsprechende, dem Sinne nach bis zum Äußersten entgegengesetzte Altersstimmung der abendländischen Seele, durch und durch ägyptisch in seiner umfassenden Sorge für dauerhafte wirtschaftliche Zusammenhänge, für Vorsorge und Fürsorge, die den gegenwärtigen Zustand aus der historischen Perspektive von Jahrhunderten auffaßt, die den Einzelnen mit all seinen Lebensäußerungen in die tausendfachen Beziehungen eines höchst abstrakten Wirtschaftssystems bindet und verflicht, des genauen Seitenstücks der analytischen Zahlenwelt, wie es der heutigen Funktionentheorie zugrunde liegt. Die antike Wirtschaftsgesinnung — die ἀταραξία und Unbekümmertheit der Stoiker wiederholend — verleugnet die Zeit, die Zukunft, die Dauer, die abendländische bejaht sie, sei es in der flacheren englisch-jüdischen Fassung von Malthus, Marx, Bentham, sei es in der tiefen und zukunftsreichen des preußischen Staatsgedankens, dessen von Friedrich Wilhelm I. begründeter Sozialismus noch in diesem Jahrhundert den andern in sich aufnehmen wird. Das Wort Friedrichs des Großen: „Ich bin der erste Diener meines Staates“ drückt diese hohe Sorge um das Kommende, dies faustische Schicksalsgefühl aus. Es gehört derselben Epoche an wie Rousseaus contrat social, aus dem die englisch-französische Staatsidee, die parlamentarisch-halbsozialistische des 19. Jahrhunderts, wesentlich hervorging. Rousseau und Friedrich der Große waren Musiker; Sokrates, ihr „Zeitgenosse“ und Ahnherr der Stoa, war Bildhauer. Beide Wirtschaftsideale, das der Polis und das des westeuropäischen Staates, sind in der Tiefe ihrer Form mit den Prinzipien[S. 191] der Plastik und des Kontrapunkts verwandt. So berühren sich die Ideen von Schicksal, Geschichte, Zeit, Sorge mit den letzten künstlerischen Ausdrucksformen des Seelentums.
Der alltägliche Mensch aller Kulturen bemerkt von der Physiognomie alles Werdens, seines eignen und dessen der historischen Welt, nur den unmittelbar greifbaren Vordergrund. Die Summe seiner Erlebnisse, der inneren wie der äußeren, füllt als bloße Reihenfolge von Einzelheiten den Lauf seiner Tage. Erst der bedeutende Mensch fühlt hinter dem populären Zusammenhange der historisch-bewegten Oberfläche die tiefe Logik des Werdens, die in der Schicksalsidee hervortritt und die eben jene oberflächlichen bedeutungsarmen Bildungen des Tages als Zufälligkeiten erscheinen läßt.
Zwischen Schicksal und Zufall scheint zunächst nur ein Gradunterschied an Gehalt zu bestehen. Man empfindet es etwa als Zufall, daß Goethe nach Sesenheim, und als Schicksal, daß er nach Weimar kam. Das eine scheint Episode, das andre Epoche zu sein. Indessen wird daraus deutlich, daß die Unterscheidung vom innern Range des Menschen abhängt, der sie trifft. Der Menge wird selbst das Leben Goethes als eine Reihe von Zufällen erscheinen; wenige werden mit Erstaunen empfinden, welche symbolische Notwendigkeit in ihm auch noch dem Unbedeutendsten innewohnt.
Hier bleibt das Gebiet der begrifflichen Verständigung weit zurück; was Schicksal, was Zufall ist, das gehört zu den entscheidenden Erlebnissen der einzelnen Seele wie der ganzer Kulturen. Es ist eine Frage der Ethik, nicht der Logik. Hier schweigt alle Erfahrung, jede abstrakte Erkenntnis, jede Definition; und wer auch nur den Versuch wagt, beides erkenntnistheoretisch fassen zu wollen, der kennt es gar nicht. Schicksal und Zufall bilden jedesmal einen Gegensatz, in den die Seele zu kleiden versucht, was nur Gefühl, nur Erlebnis und Intuition sein kann und was allein durch die innerlichsten Schöpfungen von Religion und Kunst denen verdeutlicht wird, die zur Einsicht berufen sind. Um dies Urgefühl des lebendigen Daseins,[S. 192] das dem Weltbilde der Geschichte Sinn und Gehalt verleiht, heraufzurufen — Name ist Schall und Rauch —, weiß ich nichts Besseres als einen Vers von Goethe, denselben, der als Motto an der Spitze dieses Buches dessen Grundgesinnung bezeichnen soll:
Die Unterscheidung dieser letzten Ideen ist Sache des Herzens. Die Logik der Geschichte, der Richtung, die tragische Notwendigkeit des Seins, die in diesem Kreise waltet, ist nicht die Logik der Natur, nicht Zahl und Gesetz, Ursache und Wirkung, nichts Greifbares oder Begreifbares überhaupt. Man spricht von der Logik einer plastischen Gruppe, eines vollkommenen Gedichtes, einer Melodie, eines Ornamentes. Es ist die immanente Logik aller Religionen.
Dies ist Religion, und selbst die große Kunst vermag durch ihre Symbole dieses letzte Geheimnis jeder Seele nur zu berühren, soweit sie Religion ist. Insofern ein Kunstwerk im Künstlersinne Form hat, technische, elementare Form nämlich, die in Schule und Werkstatt gelehrt werden kann, die die Substanz jeder Tradition und Konvention bildet, den Kanon der Fuge, den Kanon der Plastik, den Bau der Tragödie — insofern ist das Kunstwerk etwas Gewordnes, der Welt als Natur angehörig und seine Logik von einer irgendwie kausal gefärbten Art. Man wird eine Verwandtschaft der höheren Mathematik dieser Kultur mit diesem Objekt der Kunstübung nicht verkennen („Form“ als Gegensatz zum „Stoff“). Wenn aber ein Kunstwerk in seinem Tiefsten noch darüber hinausgeht, sich aus der Sphäre massenhaft geübter Zeitkunst in den Kreis der wenigen begnadeten Schöpfungen erhebt, dann teilt es die Form des Werdens, dann hat es Schicksal und ist es Schicksal in der Entwicklung einer Kultur, nicht mehr ein Atom im Wellenschlag der historischen Oberfläche,[S. 193] sondern selbst geschichtsbildend, epochemachend im wörtlichen Sinne.
So ist es die Idee der Gnade im abendländischen Christentum, welche Zufall und Schicksal in der höchsten ethischen Fassung repräsentiert. Fügung (Erbsünde) und Gnade — in dieser Polarität, die immer nur Gestalt des Gefühls, des bewegten Lebens, nie Inhalt der Erfahrung sein kann, liegt das Dasein jedes wirklich bedeutenden Menschen dieser Kultur beschlossen. Sie ist, auch für den Protestanten, auch für den Atheisten, und sei sie noch so gut hinter dem Begriff der „Entwicklung“ versteckt, der in gerader Linie von ihr abstammt,[43] die Grundlage jeder Autobiographie, die, geschrieben oder gedacht, deshalb dem antiken Menschen, dessen Schicksal von andrer Gestalt war, versagt blieb. Aus ihr ist — wieder im Gegensatz zu Äschylus und Sophokles — der ganze Gehalt der tragischen Schöpfungen von Shakespeare und Goethe abzuleiten. Sie ist der letzte Sinn der Bildnisse Rembrandts und der Musik von Bach bis zu Beethoven. Mag man es Fügung, Vorsehung, innere Entwicklung[44] nennen, was den Lebensläufen aller Menschen des Abendlandes etwas Verwandtes gibt — dem Denken bleibt es unzugänglich. Hier endet jede rationalistische Verfolgung religiöser Ideen beim Widersinn: der vermeintlichen Überwindung kirchlicher Dogmen durch die „Resultate der Wissenschaft“. Die Prädestinationslehre bei Calvin und Pascal — die beide, aufrichtiger als Luther und Thomas von Aquino, die Konsequenzen der augustinischen Dialektik zu ziehen wagten — ist die notwendige Absurdität, zu welcher die verstandesmäßige[S. 194] Verfolgung dieser Dinge führt. Sie gerät aus der Logik des Weltgefühls in die Logik der Begriffe und Gesetze, aus der unmittelbaren Anschauung des Lebens in ein System von Objekten. Die furchtbaren Seelenkämpfe Pascals sind die eines tiefinnerlichen Menschen, der zugleich geborner Mathematiker war und der die letzten und ernstesten Fragen der Seele zugleich den großen Intuitionen eines inbrünstigen Glaubens und der abstrakten Präzision einer ebenso großen mathematischen Anlage unterwerfen wollte. Dies gab der Schicksalsidee, religiös gesprochen der Vorsehung Gottes, die schematische Form des Kausalitätsprinzips, die Kantische Form der Verstandestätigkeit also, denn das bedeutet Prädestination, in der nun allerdings die lebendige, freie und stets gegenwärtige Gnade, als allein dem historischen („übernatürlichen“), nicht dem natürlichen Weltbilde immanent, logisch unmöglich erscheint. Der Zweifel an Gott ist das Verhängnis des Menschen, in dem ein tiefer Verstand über eine tiefe Seele siegt.
Wenden wir uns nun der weiteren Verdeutlichung des Phänomens des Zufälligen zu, so werden wir nicht mehr Gefahr laufen, in ihm eine Ausnahme oder Durchbrechung des kausalen Naturzusammenhanges zu sehen. „Natur“ ist nicht das Weltbild, in dem das Schicksal wesenhaft wird. Überall, wo der verinnerlichte Blick sich vom Sinnlich-Gewordnen löst und, der Vision sich nähernd, die Umwelt durchdringt, Urphänomene statt Objekte auf sich wirken fühlt, tritt der große historische, der außer- und übernatürliche Aspekt ein: es ist der Blick Dantes und Wolframs, auch der des Goetheschen Alters, als dessen Ausdruck vor allem das Ende des zweiten Faust erscheint und, was man immer verkannt hat, der des Cervantes damals, als er die Gestalt des Don Quijote fand. Verweilen wir in dieser Welt von Schicksal und Zufall, so scheint es vielleicht zufällig, daß auf diesem kleinen Gestirn sich die Episode der „Weltgeschichte“ abspielt; zufällig, daß Menschen, eine tierähnliche organische Bildung auf der Rinde dieses Stern, das Phänomen der „Erkenntnis“ und gerade in[S. 195] dieser, von Kant, Aristoteles und andern so sehr verschieden betriebenen Form besitzen; zufällig, daß als Wirkung dieser Erkenntnis gerade diese Naturgesetze in Erscheinung treten („ewig und allgemeingültig“) und das Bild einer „Natur“ wachrufen, von dem jeder Einzelne glaubt, daß es für alle dasselbe sei. Die Physik verbannt — mit Recht — den Zufall aus ihrem Bilde, aber es ist doch wieder Zufall, daß sie selbst überhaupt, irgendwann in der Alluvialperiode der Erdoberfläche, einmal als geistiges Phänomen auftauchte.
Wem der Blick für dies andere Weltbild, für Geschichte im höchsten Sinne — die Welt als „Divina commedia“, als Schauspiel für einen Gott — fehlt wie Kant und den meisten Systematikern des Denkens, der wird darin nur den sinnlosen Wirrwarr von Zufällen, diesmal im banalsten Sinne des Wortes, finden.[45] Aber auch die zünftige, unkünstlerische Geschichtsforschung ist nicht viel mehr als eine „pragmatische“ Analyse der Oberfläche, eine wenn auch noch so geistreiche Sanktion des Banal-Zufälligen.
Umgekehrt liegt dem „astrologischen“ Weltaspekte, selbst dort, wo er sich wissenschaftlich gebärdet, die Überzeugung zugrunde, daß das gesamte All, Gestirne wie Menschen, jenseits aller naturhaften Kausalität, auch noch eine Einheit von ganz andrer Ordnung bildet, deren immanente Logik eben die eines Schicksals ist. Kepler, der die mathematischen Gesetze der Planetenbahnen fand, war überzeugter Astrolog (er hat unter andern das Horoskop Wallensteins gestellt). Ich sehe in jeder tragischen Dichtung, vorausgesetzt, daß sie einen entsprechenden Rang einnimmt, den Ausdruck eines astrologischen Lebensgefühls, selbst wenn der Autor als empirische Person dies in Abrede gestellt hätte. Für Shakespeare beweisen es nicht nur die Hexenszenen des Macbeth, welche tatsächlich den kosmischen Sinn des Stückes tragen, sondern auch eine dunkle Grundstimmung im Lear, im Wintermärchen, vor allem im Sturm. Hier würde man für Fügung und Bestimmung vielleicht das Wort Verhängnis wählen. Hier waltet nur ein Schicksal[S. 196] und Zufall heißt lediglich das, was dem Einzelnen im Bilde auch seelisch nicht mehr verständlich ist. Von diesem letzten Standpunkte aus löst sich endlich beides in eine erhabene Einheit auf und dies ist es, was Christen großen Stils — ich erinnere nochmals an Dante — als „göttliche Weltordnung“ mit unerschütterlicher Gewißheit empfinden. Nur der Standort unterscheidet noch Schicksal und Zufall. Nichts ist bezeichnender als Shakespeare, in dem man den eigentlichen Tragiker des Zufalls noch nie gesucht und nie vermutet hat. Und doch liegt hier gerade der Kern der abendländischen Tragik, die zugleich das Abbild der abendländischen Idee der Historie und der Schlüssel zu dem ist, was das von Kant nicht verstandene Wort „Zeit“ bedeutet. Es ist recht zufällig, daß die politische Situation des Hamlet, der Königsmord und die Frage der Thronfolge, gerade diesen Charakter treffen. Es ist zufällig, daß Jago, ein alltäglicher Halunke, wie man sie auf allen Straßen findet, gerade diesen Mann aufs Korn nahm, dessen Person diese durchaus nicht alltägliche Physiognomie besaß. Und Lear! Ist etwas zufälliger (und darum „natürlicher“) als die Paarung dieser gebietenden Würde mit diesen den Töchtern vererbten verhängnisvollen Leidenschaften? Hebbel wollte seine Menschen konsequenter, weniger zufällig haben — er wurde deshalb unnatürlich. Das Gezwungene, Systematische seiner Konzeptionen, das jeder fühlt, ohne es sich deuten zu können, lag darin, daß das logisch-kausale Schema seiner seelischen Konflikte dem historisch-bewegten Weltgefühl und dessen ganz andersartiger Logik widerspricht. Man fühlt die Gegenwart eines großen Verstandes, aber nicht die eines tiefen Lebens.
Und eben diese abendländische Nuance des Zufälligen ist dem antiken Weltgefühl und mithin dem antiken Drama ganz fremd. Antigone hat keine zufällige Eigenschaft, welche für ihre Tragik irgendwie in Betracht käme. Was dem König Ödipus geschah, hätte — im Gegensatz zum Schicksale Lears — jedem andern geschehen können. Dies ist das antike Schicksal, das „allgemein menschliche“ Fatum, das einem σῶμα überhaupt gilt und vom zufällig Persönlichen in keiner Weise abhängt.
[S. 197]
Die gewöhnliche Geschichtsschreibung wird immer beim Zufälligen stehen bleiben. Dies ist — das Schicksal ihrer Urheber, die geistig mehr oder weniger innerhalb der Menge bleiben. Vor ihrem Auge fließen Natur und Geschichte in eine höchste populäre Einheit zusammen und „Zufall“, sa sacrée Majesté le Hazard, ist für den Mann der Menge das Verständlichste, was es gibt. Es ist das Geheimnisvoll-Kausale, das noch nicht Bewiesene, das ihm die Logik der Geschichte, die er nicht fühlt, ersetzt. Das anekdotenmäßige Vordergrundsbild der Historie, der Tummelplatz aller wissenschaftlichen Kausalitätenjäger und aller Roman- und Stückeschreiber gewöhnlichen Schlages, entspricht dem durchaus. Wie viele Kriege wurden angefangen, weil ein eifersüchtiger Hofmann einen General von seiner Frau entfernen wollte! (In den Briefen der Liselotte von Orleans finden sich kleine Kabinettstücke solcher Aspekte der französischen Geschichte.) Wie viele Schlachten wurden durch lächerliche Zwischenfälle gewonnen oder verloren! Man denke an den Fächerschlag des Dei von Algier und ähnliches, das die historische Szene mit Operettenmotiven belebt. Wie von einem schlechten Dramatiker angebracht erscheinen der Tod Gustav Adolfs oder Alexanders. Hannibal ist ein bloßes Intermezzo der antiken Geschichte, in deren Verlauf er überraschend einfiel. Napoleons „Vorübergang“ entbehrt nicht der Melodramatik. Konradin, der letzte Staufe, ist der Urstoff aller Schülerpoesie. Wer die immanente Logik der Geschichte in irgendeiner kausalen Folge ihrer sichtbaren Einzelereignisse sucht, wird immer, wenn er aufrichtig ist, eine Komödie von burlesker Sinnlosigkeit finden und ich möchte glauben, daß die so wenig beachtete Tanzszene der betrunkenen Triumvirn in Shakespeares „Antonius und Kleopatra“ — für mich eine der mächtigsten in diesem unendlich tiefen Werke — aus dem Hohn des ersten historischen Tragikers aller Zeiten auf den pragmatischen Geschichtsaspekt hervorgewachsen ist. Dieser allzu populäre Aspekt hat von jeher „die Welt“ beherrscht. Er hat den kleinen Ehrgeizigen Mut und Hoffnung gemacht, in sie einzugreifen. Rousseau, Ibsen, Nietzsche, Marx glaubten, durch eine Theorie den „Lauf der Welt“ ändern zu können. Selbst die soziale, wirtschaftliche oder sexuelle Deutung, zu der als[S. 198] Maximum die Geschichtsbehandlung sich heute „erhebt“ und die stets, angesichts ihres biologischen Gepräges, kausaler Aspirationen verdächtig bleibt, ist noch reichlich trivial und populär.
Napoleon hatte in bedeutenden Momenten ein starkes Gefühl für die wahre Logik des Weltwerdens. Er ahnte dann, inwiefern er ein Schicksal war und inwiefern er eines hatte. „Ich fühle mich gegen ein Ziel getrieben, das ich nicht kenne. Sobald ich es erreicht haben werde, sobald ich nicht mehr notwendig sein werde, wird ein Atom genügen, mich zu zerschmettern. Bis dahin aber werden alle menschlichen Kräfte nichts gegen mich vermögen“ (1812). Das war nicht pragmatisch gedacht. Er selbst als empirische Person hätte vielleicht bei Marengo fallen können. Was er bedeutete, wäre dann in andrer Gestalt verwirklicht worden. Eine Melodie ist in den Händen eines großen Musikers reicher Variationen fähig; sie kann für den einfachen Hörer völlig verwandelt sein, ohne in der Tiefe — in einem ganz andern Sinne — sich verändert zu haben. Die Epoche der deutschnationalen Einigung ist in der Person Bismarcks, die der Freiheitskriege in breiten und beinahe namenlosen Ereignissen durchgeführt worden. Beide „Themata“ konnten auch anders „durchfiguriert“ werden. Bismarck hätte entlassen und die Schlacht bei Leipzig verloren werden können; die Gruppe der Kriege von 1864, 1866 und 1870 konnte durch diplomatische, dynastische, revolutionäre oder volkswirtschaftliche Momente — „Modulationen“ — vertreten werden, obwohl die physiognomische Prägnanz der abendländischen Geschichte, im Gegensatz zum Stil der indischen etwa, an entscheidender Stelle starke Akzente, Kriege oder große Persönlichkeiten, sozusagen kontrapunktisch fordert. Bismarck selbst deutet in seinen Erinnerungen an, daß im Frühling 1848 eine Einigung in weiterem Umfange als 1870 hätte erreicht werden können, die nur an der Politik des preußischen Königs, richtiger: an seinem privaten Geschmack scheiterte. Das wäre, auch nach Bismarcks Gefühl, eine matte Durchführung des Satzes gewesen, die eine Coda („da capo e poi la coda“) notwendig gemacht hätte. Der Sinn der Epoche — das Thema — hätte sich nicht verändert. Goethe konnte — vielleicht — in frühen Jahren[S. 199] sterben, nicht seine Idee. „Faust“ und Tasso wären nicht geschrieben worden, aber sie wären, ohne ihre poetische Greifbarkeit, in einem sehr geheimnisvollen Sinne trotzdem „gewesen“.
Man kann das Phänomen des Zufalls, das dem des Schicksals erst Vollkommenheit gibt, nur aus der Idee des Urphänomens begreifen. Ich denke wieder an Bildungen der Pflanzenwelt. Kulturen sind Pflanzen. Eine Buche, die eben heranwächst, wird im Laufe der Jahre Blätter, Zweige, einen Stamm, Wipfel erhalten, deren allgemeine Gestalt sich voraussagen läßt; dies gehört zum Schicksal des keimenden Organismus. Aber der Same ist vom Winde an irgendeine Stelle getragen worden und Alter, Gesundheit, Mächtigkeit, Fülle der Erscheinung werden durch sie wesentlich mitbestimmt. Tausend Umstände kommen hinzu, um auch das Dasein zweier Nachbarstämme sehr verschieden zu gestalten. Hier würde ein strenger Christ von einer Gnade der Natur reden. Zuletzt wird jeder Wipfel des Waldes, jeder Ast, jedes Blatt von dem andern verschieden geworden sein und in einer Art, die niemand voraussagen konnte; und dies wird man vor allem als Zufall empfinden. Man kann dem Planetensystem gegenüber eine Betrachtungsweise wählen, aus der die Ringe des Saturn und die Existenz der Erde in dieser Größe, mit dieser Form der Gravitation, dieser geologischen Oberflächengeschichte, in der die Menschheit eine flüchtige Episode bildet, zwischen diesen Nachbarplaneten, als Gebilde des Zufalls erscheinen, vorausgesetzt, daß man die Sternenwelt als ungeheuren Organismus auf sich wirken läßt. Die mathematischen Gesetze, die einem andern Aspekt angehören, bleiben dabei völlig unberührt und unangefochten. Und so tragen alle großen Kulturen, in deren Lebenslauf vieles vorausbestimmbar ist, in ihren Zügen etwas, das dem Urphänomen wesentlich angehört und das man ihrem Schicksal, etwas, das niemand ahnen kann und das man dem Zufall, der Gnade, zuweisen kann. In welchem Grade diese Wertung stattfindet, das entscheidet für das einzelne Geschichtsbild, das immer das eines bestimmten Betrachters ist, dessen Weltgefühl mit unmittelbarer innerer Gewißheit.
Die euklidische Seele der Antike konnte ihr an gegenwärtigen Vordergründen haftendes Dasein indessen nur in der Gestalt[S. 200] von Zufällen erleben. Darf man für die abendländische Seele das Zufällige als Schicksal von geringerem Gehalte deuten, so darf umgekehrt das Schicksal für die antike Seele als gesteigerter Zufall gelten. Das bedeutet fatum. Beide Worte aber bezeichnen für die apollinische Seele Momente von ganz andrer Physiognomie. Sie besaß, wie wir sahen, kein Gedächtnis, keine organische Zukunft und Vergangenheit, keine wirklich durchlebte Geschichte also und das will heißen: kein eigentliches Gefühl für eine Logik des Schicksals. Man lasse sich nicht durch Worte täuschen. Die populärste Göttin des Hellenismus war Tyche,[46] die man von der Ananke kaum zu scheiden wußte. Schicksal und Zufall aber werden von uns mit der ganzen Wucht eines Gegensatzes empfunden, von dem in unsrer tiefern Existenz alles abhängt. Unsere Geschichte ist die der großen Zusammenhänge; sie ist kontrapunktisch gesetzt. Die antike Geschichte, nicht etwa nur ihr Bild bei ihren Historikern wie Herodot, sondern ihre volle Wirklichkeit ist die der Anekdoten, das heißt eine Summe statuenhafter Einzelheiten. Anekdotisch ist der Stil des griechischen Daseins überhaupt wie der jeder einzelnen Biographie. Das körperlich-greifbare Element repräsentiert den ahistorischen, den dämonischen Zufall. Die Logik des Geschehens wird mit ihm verdeckt, verleugnet. Alle Fabeln antiker Meistertragödien erschöpfen sich in sinnlosen Zufällen; anders läßt sich die Bedeutung des Wortes εἱμαρμένη im Gegensatz zur shakespearischen Logik, die sich am antihistorischen Zufall erst entwickelt und verdeutlicht, nicht bezeichnen. Noch einmal: was dem Ödipus zustößt, ganz von außen, innerlich durch nichts bedingt und bewirkt, hätte jedem Menschen ohne Ausnahme geschehen können. Das ist die Form des Mythus. Man vergleiche damit die tiefinnere, durch ein ganzes Dasein und das Verhältnis dieses Daseins zur Epoche bedingte individuelle Notwendigkeit im Schicksal Othellos, Don Quijotes, Werthers. Situationstragödie und Charaktertragödie stehen hier gegeneinander. Aber in der Geschichte selbst wiederholt sich der Gegensatz. Jede Epoche des Abendlandes hat Charakter, jede Epoche der Antike stellt eine Situation dar. Das Leben Goethes[S. 201] war von schicksalsvoller Logik, das Cäsars von mythischer Zufälligkeit. Hier hat Shakespeare erst die Logik hineingetragen. Napoleon ist ein tragischer Charakter; Alkibiades gerät in tragische Situationen. Die Astrologie in der Gestalt, wie sie von der Gotik bis zum Barock das Weltgefühl selbst ihrer Leugner beherrschte, wollte sich des ganzen künftigen Lebenslaufes bemächtigen. Das Horoskop setzte einen einheitlichen Organismus des gesamten noch zu entwickelnden Daseins voraus. Das Orakel, immer auf einzelne Fälle bezogen, ist ganz eigentlich das Symbol des Zufalls, der Τύχη, des Augenblicks; es gibt das Punktförmige, Zusammenhanglose im Weltlauf zu, und in dem, was man in Athen als Geschichte schrieb und erlebte, waren Orakelsprüche sehr am Platze. Hat je ein Grieche die Idee einer historischen Entwicklung zu irgendeinem Ziele besessen? Haben wir je ohne dies Grundgefühl über Geschichte nachdenken, Geschichte machen können? Vergleicht man die Geschichte Athens und Frankreichs in den entsprechenden Zeiten seit Themistokles und Ludwig XIV., so wird man finden, daß Stil des historischen Fühlens und Stil der Wirklichkeit hier eines sind: hier ein Extrem von Logik, dort von Unlogik.
Man wird den letzten Sinn dieses bedeutsamen Faktums jetzt verstehen. Geschichte ist eben die Gestalt einer Seele, und der gleiche Stil beherrscht die Geschichte, die man macht und die, welche man „anschaut“. Die antike Mathematik schließt das Symbol des unendlichen Raumes aus; die antike Geschichte mithin auch. Fügung und ein unendlicher Weltraum, Zufall und materielle Nähe und Greifbarkeit von Körpern — das gehört zusammen. Nicht umsonst ist die Szene des antiken Daseins die kleinste von allen: die einzelne Polis. Es fehlen ihm Horizont und Perspektiven — trotz der Episode des Alexanderzuges — genau wie der Szene des attischen Theaters mit der flach abschließenden Rückwand. Man denke an die funktionalen und infinitesimalen Faktoren unserer Politik, die Kabinettsdiplomatie oder „das Kapital“. Wie die Hellenen in ihrem Kosmos nur Vordergründe der Natur erkannten und als wirklich anerkannten, unter innerlichster Ablehnung der babylonischen Astronomie des Sternhimmels, wie sie nur Haus-, Stadt- und Feldgottheiten,[S. 202] aber keine Gestirngötter besaßen,[47] so malten sie auch nur Vordergründe. Niemals ist in Korinth, Athen oder Sikyon eine Landschaft mit Gebirgshorizonten, ziehenden Wolken, fernen Städten entstanden. Man findet auf allen Vasen nur Figuren von euklidischer Vereinzelung und Selbstzufriedenheit. Jede Giebelgruppe eines Tempels ist von additivem, niemals von kontrapunktischem Aufbau. Aber man erlebte auch nur Vordergründe. Schicksal war das, was einem plötzlich zustieß, nicht der „Lauf des Lebens“, und so hat Athen neben dem Fresko Polygnots und der Geometrie der platonischen Akademie die Schicksalstragödie ganz im berüchtigten Sinne der „Braut von Messina“ geschaffen. Der vollkommene Unsinn des blinden Fatums, verkörpert z. B. im Atridenfluch, repräsentierte dem ahistorischen antiken Seelentum den ganzen Sinn seiner Welt.
Einige gewagte, aber doch nicht mehr mißzuverstehende Beispiele mögen zur Verdeutlichung dienen. Man denke sich Kolumbus von Frankreich statt von Spanien unterstützt. Das war eine Zeitlang sogar das Wahrscheinliche. Franz I. als Herr Amerikas hätte ohne Zweifel die Kaiserkrone an Stelle des Spaniers Karl V. erhalten. Die frühe Barockzeit vom Sacco di Roma bis zum westfälischen Frieden, nunmehr in Religion, Geist, Kunst, Politik, Sitte das spanische Jahrhundert — das dem Zeitalter Ludwigs XIV. in allem und jedem zur Grundlage und Voraussetzung diente — wäre nicht von Madrid, sondern von Paris aus in Gestalt gebracht worden. Statt der Namen Philipp, Alba, Cervantes, Calderon, Velasquez würden wir heute die großer Franzosen nennen, die nun — so läßt sich das schwer zu Fassende wohl ausdrücken — ungeboren bleiben. Der Stil der Kirche, damals durch den Spanier Ignaz von Loyola und das von seinem Geist beherrschte Tridentiner Konzil endgültig bestimmt, der politische Stil, damals durch spanische Kriegskunst, durch die Kabinettsdiplomatie spanischer Kardinäle und den höfischen Geist des Escorial bis zum Wiener Kongreß und[S. 203] in wesentlichen Zügen noch über Bismarck hinaus festgelegt, die Architektur, die große Malerei, das Zeremoniell, die vornehme Gesellschaft der großen Städte wären durch andere feine Köpfe in Adel und Geistlichkeit, durch andere Kriege als die Philipps II., einen anderen Baumeister als Vignola, einen anderen Hof vertreten worden. Der Zufall wählte die spanische Geste für die abendländische Spätzeit; die innere Logik des Zeitalters, das in der großen Revolution — oder einem Ereignis von analogem Gehalte — seine Vollendung finden mußte, blieb davon unberührt.
Die französische Revolution konnte in der Tat durch ein Ereignis von anderer Gestalt und an anderer Stelle, in Deutschland etwa, vertreten werden. Ihre Idee (wie wir später sehen werden), der Übergang der Kultur in die Zivilisation, der Sieg der anorganischen Weltstadt über das organische Land, das nun „Provinz“ in geistigem Sinne wird, war notwendig, und zwar in diesem Augenblick. Hierfür soll das Wort Epoche im alten heute verwischten (mit Periode verwechselten) Sinne angewandt werden. Ein historisches Ereignis macht Epoche: das heißt, es bezeichnet im Organismus einer Kultur ein notwendiges, schicksalshaftes Stadium. Das Ereignis selbst, ein Kristallisationsgebilde der historischen Oberfläche, konnte durch entsprechende andere vertreten werden; die Epoche ist notwendig und vorbestimmbar. Ob ein Ereignis den Rang einer Epoche oder einer Episode in bezug auf eine Kultur und deren Gang einnimmt, das hängt, wie man sieht, mit den Ideen vom Schicksal und Zufall und weiterhin mit dem Unterschied der epochalen abendländischen und der episodischen antiken Tragik zusammen.
Es mögen ferner anonyme und persönliche Epochen unterschieden werden, je nach ihrem physiognomischen Typus im Geschichtsbilde. Der erste Teil jener Epoche, die Revolution, 1789–1799, ist durchaus anonym, der zweite, napoleonische, 1799–1815, im höchsten Grade persönlich gehalten. Die ungeheure Vehemenz dieser Erscheinung hatte in einigen Jahren vollendet, was die entsprechende antike Epoche (386–322), verschwommen und unsicher, in ganzen Jahrzehnten „unterirdischen Abbaues“ zu leisten hatte. Es gehört zum organischen Typus aller Kulturen, zum Urphänomen, daß in jedem Stadium[S. 204] zunächst die gleiche Möglichkeit vorhanden ist, das Notwendige in Gestalt einer großen Person (Ludwig XIV., Cäsar), eines großen anonymen Faktums (peloponnesischer und dreißigjähriger Krieg) oder einer morphologisch undeutlichen Entwicklung (Diadochenzeit, spanischer Erbfolgekrieg) zu vollziehen. Welche Form die Wahrscheinlichkeit für sich hat, ist bereits eine Frage des historischen — tragischen — Stils.
Die Geschichte, wie sie vor dem faustischen Auge sich als Weltbild entrollt, verwirklicht ihre Epochen in persönlicher oder anonymer Fassung; die Tragödie drängt zur persönlichen als der symbolisch bedeutenderen hin. Ein Dichter der Revolution würde ihren Gehalt in eine repräsentative Person, Danton etwa, drängen. Unsere Dramen sind Dramen einzelner Charaktere. Goethes Wahlverwandtschaften bilden eine seltene Ausnahme. Ein tragischer Charakter ist der, welcher Epoche macht, Werther z. B. Antike „Charaktere“ von epochemachender Bedeutung gibt es also nicht.
Jede wahre Epoche bedeutet auch eine wahre Tragödie, aber in unserem, nicht im antiken Sinne. Parzeval, Don Quijote, Hamlet, Faust sind solche Tragödien, die eine ganze historische Krisis in einem Charakter resümieren und man darf deshalb jede große Tragödie unserer Kultur im Gegensatz zu jeder antiken, notwendig ahistorischen und mythischen eine historische nennen, so frei ihre Fabel erfunden sein mag; andernfalls ist sie „Genre“ wie bei Schiller und Alfieri. Shakespeares Cäsar stirbt im dritten Akt. Diese Tragödie gestaltet eine Epoche und der Dichter fühlte — ganz unbewußt, wie sich versteht —, daß eine empirische Person nur Symbol, nur Oberflächengebilde ist.[48] Die Handlung vollendet sich mithin erst dort, wo die Epoche, nicht wo das sinnliche Dasein ihres Trägers zu Ende war. Cäsar ist in einem tieferen Sinne erst bei Philippi gefallen, in der Gestalt des Brutus nämlich, die seine Mission vollendete, während Antonius, sein Erbe im Sinne des historischen Vordergrundes, in Alexandria eine neue Epoche einleitete, die bei Philippi zutage trat und im Drama von Actium schloß. Aber dies ist der Cäsar unseres, nicht des antiken Weltbildes. Die[S. 205] antike Geschichte ist wie die antike Tragödie in sich selbst episodisch, nicht epochal angelegt.
Man nehme die Tragödie Napoleons. Seine Bestimmung war die Vollendung der abendländischen Zivilisation. Er bedeutet dasselbe wie Philipp und Alexander, die den Hellenismus an Stelle der hellenischen Kultur heraufführten, so daß in beiden Fällen die Entscheidungen der historischen Oberfläche nicht mehr durch Konvent und Guillotine, durch den Ostrakismos und die Beschlüsse der Agora, nicht durch journalistische und rhetorische Gesten wie zur Zeit Rousseaus, Voltaires, des Aristophanes und Sokrates, sondern auf den großen Schlachtfeldern von ganz Europa und dort auf dem Boden des alten Perserreiches getroffen wurden.
Das Tragische seines Lebens — noch unentdeckt für einen Dichter, der groß genug wäre, es zu begreifen und zu formen — liegt darin, daß er, dessen Dasein im Kampfe gegen die englische Politik, die vornehmste Repräsentantin des englischen Geistes, aufging, eben durch diesen Kampf den Sieg dieses Geistes auf dem Kontinent vollendete, der dann mächtig genug war, in der Gestalt „befreiter Völker“ ihn zu überwältigen und in St. Helena sterben zu lassen. Nicht er war der Begründer des Expansionsprinzips. Das stammte aus dem Puritanismus der Generation Cromwells, der das britische Kolonialsystem ins Leben gerufen hatte,[49] und es war seit dem Tage von Valmy, den Goethe allein begriff, wie sein berühmtes Wort am Abend der Schlacht beweist, unter Vermittlung englisch geschulter Köpfe wie Rousseau und Mirabeau die Tendenz der Revolutionsheere, die durchaus von den Ideen der englischen Philosophie vorwärts getrieben wurden. Nicht Napoleon hat diese Ideen, sie haben ihn geschaffen, und als er den Thron bestieg, mußte er sie weiter verfolgen, gegen die einzige Macht, England nämlich, die dasselbe wollte. Sein Empire ist eine Schöpfung von französischem Blute, aber englischem Stil. In London war durch Locke, Shaftesbury, Clarke, vor allem Bentham, die Theorie der „europäischen“ Zivilisation, des Hellenismus des Abendlandes, ausgebildet und von Bayle, Voltaire,[S. 206] Rousseau nach Paris getragen worden. Im Namen dieses England des Parlamentarismus, der Geschäftsmoral und des Journalismus kämpfte man bei Valmy, Marengo, Jena, Smolensk und Leipzig, und englischer Geist hat in all diesen Schlachten gesiegt — über die französische Kultur des Abendlands.[50] Der Erste Konsul hatte keineswegs den Plan, Westeuropa Frankreich einzuverleiben; er wollte zunächst — der Alexandergedanke an der Schwelle jeder Zivilisation! — an Stelle des englischen ein französisches Kolonialreich setzen, durch welches er das politisch-militärische Übergewicht Frankreichs über das abendländische Kulturgebiet auf eine kaum angreifbare Basis gestellt hätte. Es wäre das Reich Karls V. gewesen, in dem die Sonne nicht unterging, trotz Kolumbus und Philipp II. in Paris konzentriert und nunmehr nicht als ritterlich-kirchliche, sondern als wirtschaftlich-militärische Einheit organisiert. Soweit — vielleicht — lag Schicksal in seiner Mission. Aber der Pariser Friede von 1763 hatte die Frage schon gegen Frankreich entschieden und seine mächtigen Pläne sind jedesmal an winzigen Zufällen gescheitert; zuerst vor St. Jean d’Acre durch ein paar rechtzeitig von den Engländern gelandete Geschütze; dann nach dem Frieden von Amiens, als er das ganze Mississippital bis zu den großen Seen besaß und mit Tippo Sahib, der damals Ostindien gegen die Engländer verteidigte, Beziehungen anknüpfte, an einer irrtümlichen Flottenbewegung seines Admirals, die ihn zum Abbruch einer sorgfältig vorbereiteten Unternehmung zwang; endlich als er zum Zweck einer neuen Landung im Orient das Adriatische Meer durch die Besetzung von Dalmatien, Korfu und ganz Italien zu einem französischen gemacht hatte und mit dem Schah von Persien über eine Aktion gegen Indien unterhandelte, an Launen des Kaisers Alexander, der zu Zeiten einen Marsch nach Indien wohl — und dann mit sicherem Erfolg — unternommen hätte. Erst indem er nach dem Scheitern aller außereuropäischen[S. 207] Kombinationen die Einverleibung von Deutschland und Spanien als ultima ratio im Kampfe gegen England wählte, Ländern, in denen sich nun gerade seine englisch-revolutionären Ideen gegen ihn, ihren Vermittler, erhoben, hatte er den Schritt getan, der ihn überflüssig machte.[51]
Ob das weltumfassende Kolonialsystem, einst von spanischem Geiste entworfen, damals englisch oder französisch umgeprägt wurde, ob die „Vereinigten Staaten von Europa“, das Seitenstück damals der Diadochenreiche und nun in Zukunft des Imperium Romanum, durch ihn als romantische Militärmonarchie auf demokratischer Basis oder im 21. Jahrhundert durch einen cäsarischen Tatsachenmenschen als rein wirtschaftliches Faktum Wirklichkeit wurden — das gehört zum Zufälligen des Geschichtsbildes. Seine Siege und Niederlagen, in denen immer ein Sieg Englands, ein Sieg der Zivilisation über die Kultur, verborgen war, sein Kaisertum, sein Sturz, die grande nation, die episodische Befreiung Italiens, die 1796 wie 1859 nicht viel mehr als das politische Kostüm eines längst bedeutungslos gewordenen Volkes änderte, die Zerstörung des Deutschen Reiches, einer gotischen Ruine, sind Oberflächenbildungen, hinter denen die große Logik der eigentlichen, unsichtbaren Geschichte steht, und in ihrem Sinne vollzog damals das Abendland den Abschluß der in französischer Gestalt, im ancien régime zur Vollendung gelangten Kultur durch die englische Zivilisation. Als Symbole identischer Phänomene entsprechen also die Bastille, Valmy, Austerlitz, Waterloo, der Aufschwung Preußens, den antiken Faktoren der Schlachten von Chäronea und Gaugamela, dem Königsfrieden, dem Zug nach Indien und der Entwicklung Roms und man begreift, daß in Kriegen und politischen Katastrophen, der pièce de résistance unserer Geschichtsschreibung, der Sieg nicht das Wesentliche eines Kampfes und der Friede nicht das Ziel einer Umwälzung ist.
Die durch den Namen Luthers bezeichnete und, wie man[S. 208] zugeben muß, nicht eben glücklich durchgeführte Epoche ist ein anderes Beispiel. Hier war eine anonyme Entwicklung — auf dem Wege von Konzilien — sogar naheliegend. Savonarola hatte im Einverständnis mit dem Könige von Frankreich den Gedanken verfolgt, und seiner Erhebung zum Papste wären mehrere Kardinäle kaum abgeneigt gewesen. Luthers innere und äußere Entwicklung hängt mit der zufälligen Dauer des Pontifikats einiger Mächte, Leos X. vor allem, eng zusammen. Man denke sich Hadrian VI. an dessen Stelle. Wie der tiefere Sinn aller Schlachten und Dekrete Napoleons nicht in der von ihm erstrebten oder erreichten Absicht lag, so waren alle Handlungen Luthers nach ihrer äußeren Absicht und ihrem realen Erfolge von den tieferen Tendenzen der in ihm verkörperten Epoche unabhängig. Er hätte als Märtyrer oder Papst sterben können; beides war möglich. Aber das wäre eher gewesen, was die Griechen Nemesis nannten, ein bloßes Vordergrundschicksal, das den Menschen, nicht die Idee berührte. Man konnte den ehrgeizigen Mönch zum Haupte eines Konzils machen; seine Entwicklung zu einem Reformpapst von gemäßigten Anschauungen und diplomatischer Konzilianz war nicht unwahrscheinlich. Luthers ohnehin widerspruchsvolle, von Selbsthaß und Selbstliebe gefärbte Stimmungen und Entschlüsse waren im hohen Grade von dem Respekt abhängig, den fürstliche Gönner seiner Person erwiesen, und anfangs waren seine Ziele von denen anderer, auch denen des letzten deutschen Papstes, Hadrians VI., nicht allzu verschieden. Vielleicht haben solche Gedanken ihn gelegentlich bewegt — denn was wissen wir von seinen innersten Erlebnissen? Von geringen Varianten hing damals die ganze sichtbare Fassung der abendländischen Kultur ab und eine Kirchenspaltung lag zunächst außer aller Wahrscheinlichkeit. Endlich ist er dann der Brutus der Kirche geworden. Shakespeare hat da den Typus des Grüblers aufgestellt, dem die Gnade fehlt. Auch dies ist eine tragische Möglichkeit, eine Epoche durchzuführen: die Selbstvernichtung dessen, der sie in der wirklichen Welt repräsentiert. Brutus tötet Cäsar, Luther die Kirche — im Dienst einer Theorie. Er hat sie getötet. Sie hat seitdem, zur ständigen Notwehr gegen den Protestantismus verurteilt, ihre königliche Freiheit, ihre tiefe, heute[S. 209] nicht mehr verstandene Liberalität eingebüßt. Sie war naiv gewesen, nun wurde sie peinlich. Und auch das Luthertum erlebte sein Philippi — als der katholische Geist in ihm eine neue Orthodoxie schuf, der gegenüber Luthers Tat immer wieder, im Pietismus, Rationalismus, Materialismus, Anarchismus, vollzogen wurde. Alles dies gehört, bei aller Größe der Erscheinung, nur zum Gewande des Zufällig-Historischen, in welches das Schicksal selbst sich hüllt.
Wie aber von der Person Luthers feine Fäden sich rückwärts zu der Heinrichs des Löwen und vorwärts zu der Bismarcks spinnen, zwei anderen „Zufälligen“ des hohen Nordens, in denen Epochen zum Ausdruck kamen, die als Triumphe über den Hang zum Süden, zum Sorglosen, zum Rausch innerlichst verwandt sind — es liegen in merkwürdiger Deutlichkeit des Periodischen je 345 Jahre zwischen den symbolischen Akten von Legnano, Worms und Königgrätz —, das beweist eine physiognomische Prägnanz des Erlebens, deren nur die abendländische Seele mit ihrem großen Sinn für den reinen Raum und die Historie fähig war und die nur in dem unsagbar durchsichtigen und logischen Aufbau der ägyptischen Geschichte — der Verwirklichung der ägyptischen Seele — ein Seitenstück hat.
Wer diese Ideen in sich aufgenommen hat, wird es verstehen, wie verhängnisvoll das in einer exakten Form erst den späten Kulturzuständen eigene und dann um so tyrannischer auf das Weltbild wirkende Kausalitätsprinzip für das Erlebnis echter Geschichte werden mußte. Kant hatte höchst vorsichtig die Kausalität als notwendige Form der Erkenntnis festgestellt. Das Wort Notwendigkeit hörte man gern, aber man überhörte die Einschränkung des Prinzips auf ein einzelnes Erkenntnisgebiet, die gerade den modernen Historismus ausschloß. Das ganze 19. Jahrhundert war bemüht, die Grenze von Natur und Geschichte zugunsten der ersten zu verwischen. Je historischer man denken wollte, desto mehr vergaß man, wie hier nicht gedacht werden durfte. Indem man das starre Schema einer optisch-räumlichen Beziehung, Ursache und Wirkung, gewaltsam[S. 210] auf Lebendiges anwandte, zeichnete man in das sinnliche Oberflächenbild der Historie die konstruktiven Linien des Naturbildes ein, und niemand fühlte — inmitten später, an kausalen Denkzwang gewöhnter Intelligenzen — die tiefe Absurdität einer Wissenschaft, welche Werdendes durch ein methodisches Mißverständnis als Gewordenes begreifen wollte. Zweckmäßigkeit war das große Wort, mit dem der zivilisierte Geist die Welt sich assimilierte. Eine Maschine ist zweckmäßig konstruiert. Sie ist damit nützlich geworden. Folglich kann die Geschichte nur eine analoge Konstruktion besitzen: Auf diesem Schlusse beruht der historische Materialismus. Wollten wir den eigentlichen Schicksalsgedanken recht deutlich erleben, so müssen wir uns in das Seelenleben unserer Kindheit und dessen Umwelt versenken. Hier war das Bewußtsein durchaus mit den Eindrücken einer lebendigen Wirklichkeit erfüllt, dämonisch, verhängnisvoll, zwecklos im erhabenen Sinne, ein ewiges Weben und Schweben, von rätselhaftem, außernatürlichem Gehalte. Hier gab es wirklich eine „Zeit“. Hier herrschte in äußerster Reinheit das Phantasiebild, das dem späteren, abgeklärten, auch matteren Geschichtsbilde die Züge vorzeichnete, welch letzteres mehr und mehr dem kausalen Naturbilde des zivilisierten Menschen erliegt.
Wissenschaft ist immer Naturwissenschaft. Wissen, Erfahrung gibt es nur von Gewordenem, Ausgedehntem, Erkanntem. Wie Leben zur Geschichte, so gehört Wissen zur Natur — zu der als Element begriffenen, im Raume betrachteten, nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung gestalteten gegenwärtigen Sinnlichkeit. Gibt es also überhaupt eine Wissenschaft der Historie? Erinnern wir uns, wie in jedem persönlichen Weltbilde, das dem idealen Bilde nur mehr oder weniger nahekommt, etwas von beidem erscheint, keine Natur ohne lebendige, keine Geschichte ohne kausale Einklänge ist. Ohne Zweifel gibt es in jedem Geschichtsbilde Züge von kausaler und naturgesetzlicher Art und sie sind es, auf die aller Pragmatismus seine Ansprüche stützt. Ohne Zweifel ist auch das Gefühl, welches einen echten Zufall gegenüber einem Schicksal statuiert, auf Eindrücke dieser Art begründet. So sonderbar es klingt, der Zufall im alltäglichen Sinne ist mit dem Kausalitätsprinzip[S. 211] innerlich verwandt. Das Anorganische, Richtungslose verbindet sie. Aber sie sind beide etwas Fremdes im Geschichtsbilde; sie gehören der Oberfläche an, deren sinnliche Plastizität mindestens kausale Gedächtnismomente weckt. Sicherlich ist das Geschichtsbild eines Menschen — und damit der Mensch selbst — um so flacher, je entschiedener der handgreifliche Zufall in ihm regiert, und sicherlich ist mithin eine Geschichtsschreibung um so leerer, je mehr sie ihr Objekt durch Feststellung kausaler Beziehungen erschöpft. Je tiefer jemand Geschichte erlebt, desto seltener wird er streng kausale Eindrücke haben und desto gewisser wird er sie als gänzlich bedeutungslos empfinden. Man prüfe Goethes naturwissenschaftliche Schriften, und man wird erstaunt sein, die Darstellung einer lebendigen Natur ohne Formeln, ohne Gesetze, fast ohne Spuren von Kausalem zu finden. Zeit ist für ihn keine Distanz, sondern ein Gefühl. Der bloße Gelehrte, der analysiert, nicht fühlt, besitzt kaum die Gabe, hier das Letzte und Tiefste zu erleben. Die Geschichte fordert sie aber; und so besteht das Paradoxon zu Recht, daß ein Geschichtsforscher um so bedeutender ist, je weniger er der eigentlichen Wissenschaft angehört.
Ein Schema möge das Gesagte zusammenfassen:
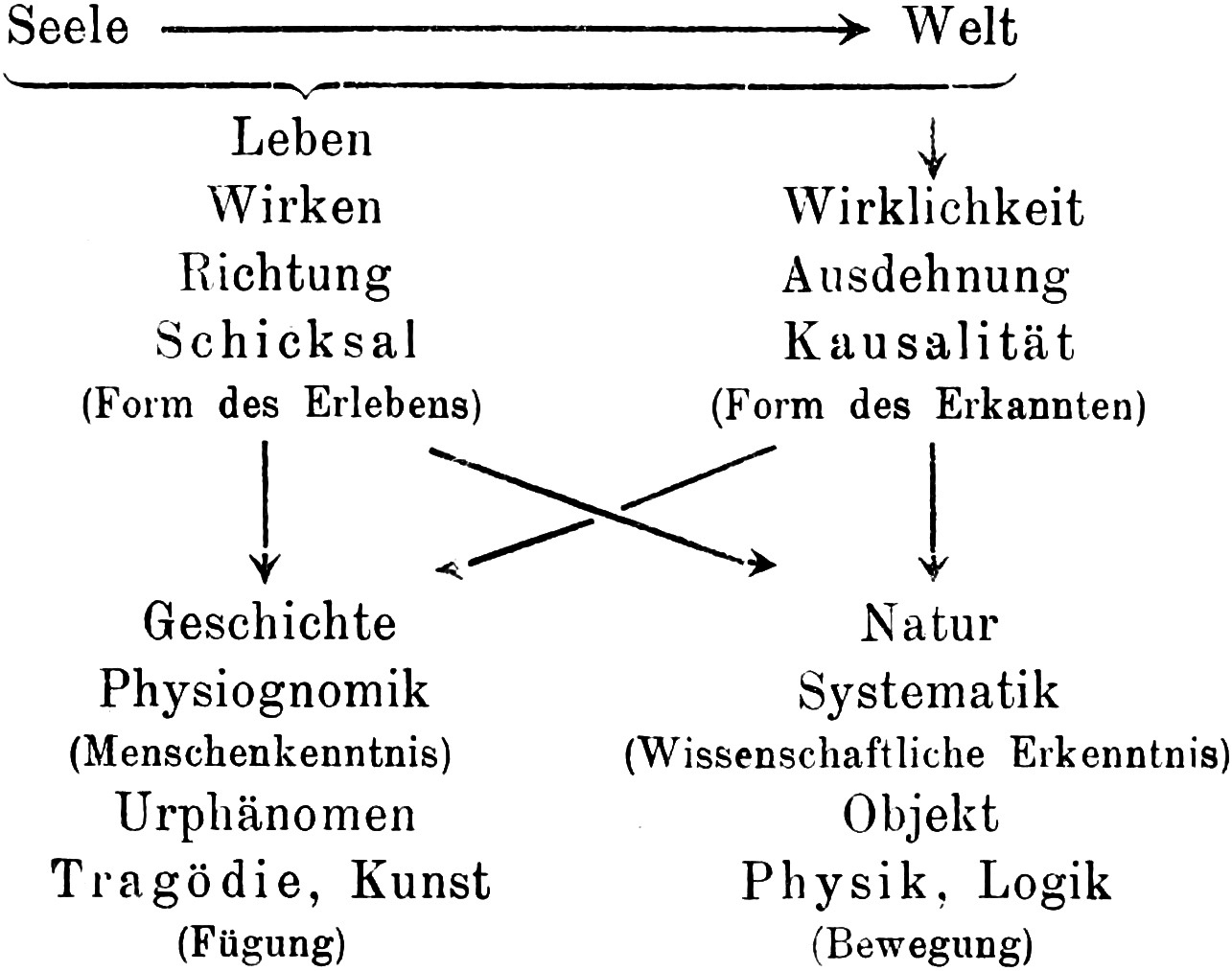
[S. 212]
Darf man irgendeine Gruppe elementarer Phänomene sozialer, physiologischer, ethischer Natur als Ursache einer andern setzen? Die pragmatische Geschichtsschreibung kennt im Grunde nichts andres. Das heißt für sie, die Geschichte begreifen, ihre Erkenntnis vertiefen. In der Tiefe aber liegt für den zivilisierten Menschen immer der praktische Zweck. Ohne ihn wäre die Welt sinnlos. Allerdings ist auf diesem Standpunkte die gar nicht physikalische Freiheit in der Wahl der Motive nicht ohne Komik. Der eine wählt diese, der andre jene Gruppe als prima causa — eine unerschöpfliche Quelle wechselseitiger Polemik — und alle füllen ihre Werke mit vermeintlichen Erklärungen des Ganges der Geschichte im Stile physikalischer Zusammenhänge. Schiller hat dieser Methode, durch eine seiner unsterblichen Banalitäten, den Vers vom Weltgetriebe, das sich „nur durch Hunger und durch Liebe“ erhält, den klassischen Ausdruck gegeben. Das 19. Jahrhundert hat seine Meinung zu kanonischer Geltung erhoben. Damit war der Kult des Nützlichen an die Spitze gestellt. Ihm hat Darwin im Namen des Jahrhunderts Goethes Naturlehre zum Opfer gebracht. Ohne Zweifel, das Leben war eine Entwicklung zu einem zweckmäßigen Ziele. Der Instinkt, der Intellekt waren die Mittel dazu. Aber gibt es historische, seelische, gibt es überhaupt lebendige „Prozesse“? Haben historische Bewegungen, die Zeit der Aufklärung oder die Renaissance etwa, irgend etwas mit dem Naturbegriff der Bewegung zu tun? Mit dem Worte Prozeß war das Schicksal allerdings abgetan. Das Geheimnis des Werdens war „aufgeklärt“. Es gab keine tragische, es gab nur noch eine mathematische Logik. Der „exakte“ Historiker setzt nunmehr höchst naiv voraus, daß im Geschichtsbilde eine Folge von Zuständen von mechanischem Typus vorliegt, daß sie verstandesmäßiger Analyse wie ein physikalisches Experiment oder eine chemische Reaktion zugänglich ist und daß mithin die Gründe, Mittel, Wege, Ziele ein greifbar an der Oberfläche des Sichtbaren liegendes Gewebe bilden müssen. Der Aspekt ist überraschend vereinfacht. Und man muß zugeben, daß bei hinreichender Flachheit des Betrachters die[S. 213] Voraussetzung — für seine Person und deren Weltbild — zutrifft.
Hunger und Liebe — das sind aus diesem Aspekte mechanische Ursachen mechanischer Prozesse im „Völkerleben“. Sozialprobleme und Sexualprobleme — beide einer Physik oder Chemie des öffentlichen, allzuöffentlichen Daseins angehörend — sind mithin das selbstverständliche Thema utilitarischer Geschichtsbetrachtung und also auch der ihr entsprechenden Tragödie. Denn das soziale Drama steht mit Notwendigkeit neben der materialistischen Geschichtsbetrachtung. Und was in den „Wahlverwandtschaften“ Schicksal im höchsten Sinne ist, ist in der Frau „vom Meere“ nichts als ein Sexualproblem. Ibsen und alle Verstandespoeten unsrer großen Städte sind im Mechanismus der vitalen Oberfläche stecken geblieben. Sie konstruieren, sie dichten nicht. Sie kennen nur eine mathematische, keine Logik des Schicksals. Hebbels schwere künstlerische Kämpfe galten immer nur dem Versuch, dieses Elementare und schlechthin Prosaische seiner mehr wissenschaftlichen als intuitiven Anlage zu überwinden — trotz ihrer ein Dichter zu sein —, daher sein unmäßiger, ganz ungoethescher Hang zum Motivieren der Begebenheiten. Motivieren bedeutet hier, bei Hebbel, bei Ibsen, bei Euripides, das Tragische — das Lebendige also — kausal gestalten wollen. Das Schicksal wird zum Mechanismus, die Physiognomie zum System. Hebbel redet gelegentlich vom Schraubenzug in der Motivation eines Charakters. Die Kasuistik überwindet die innere Bewegtheit. Die in Worte nicht zu fassende Idee, die bei Goethe ein Werk trägt, erstarrt zu einer praktischen Tendenz, zu einer Formel. Das ist der Wechsel, der sich zwischen Kultur und Zivilisation in der Bedeutung des Wortes Problem vollzieht. Dem entspricht es, daß Dichter wie Historiker vom zivilisierten Typus als Politiker im Parteimäßigen stecken bleiben. Es fehlt an innerer Überlegenheit, an Tiefe, an Würde. Man prüfe daraufhin den Abstieg von Goethe, in dessen Egmont die einzigen Szenen von diplomatischer Feinheit stehen, zu Hebbels abstraktem Raisonnement und weiter zu Ibsens und Shaws Bedürfnis nach agitatorischem Spektakel. Hier ist es klar: Man ist weit entfernt, in der Historik eine streng morphologische Aufgabe finden[S. 214] zu wollen, so wenig man im Drama ein reines Kunstwerk gestalten will. Der Kult des Nützlichen hat hier wie dort ein ganz andres Ziel festgelegt. Unter Form versteht man die handgreifliche Wirksamkeit. Die Szene ist wie das Geschichtswerk ein Mittel dazu. Der Darwinismus hat, so unbewußt das geschehen sein mag, die Biologie politisch wirksam gemacht. Es ist irgendwie eine demokratische Rührigkeit in den hypothetischen Urschleim gekommen, und der Kampf der Regenwürmer ums Dasein erteilt den zweibeinigen Schlechtweggekommenen eine gute Lehre.
In diesem Aspekt hat der Intellekt über die Seele gesiegt. In Weltstädten gibt es kein Innenleben mehr; es gibt nur noch psychische Prozesse. Die Schickialsidee ist überwunden; es gibt nur noch mechanische und physiologische Zusammenhänge. Zufall ist das, was man noch nicht in eine physikalische Formel gebracht hat. Es erscheint hier der tiefe Gegensatz von Tragik und Experiment (das Goethe so haßte und das ihm Kleists Manier so verhaßt machte). Kleists, Hebbels, Ibsens, Strindbergs, Shaws Dramen sind Seelenexperimente, wobei man unter Seele das spinnenhafte Etwas der modernen Psychologie, das Assoziationsbündel zu verstehen hat. Zola hat den Begriff des roman expérimental geschaffen. Auf die petits faits kommt es an, aus deren Summe man den Menschen herausrechnet. Der Intellekt hat an Stelle frühmenschlicher und auch noch Goethescher Intuition das sinnlich-bewegte Bild des Lebens nach seinem Bilde, zu einem Mechanismus nämlich, umgeformt. Das bedeutet ein tragisches Problem in den Händen dieser Schriftsteller. Tragisch ist das Unzweckmäßige (Rosmer). Tragisch ist vor allem das Zweckmäßige, wenn es keine Gelegenheit hat, sich nützlich zu machen (Nora). Aus der Idee der Erbsünde ist die Vererbungstheorie geworden (Gespenster). Die Idee der Gnade heißt jetzt das Prinzip der natürlichen Zuchtwahl. Ein Problem durch den Fall eines Dramas „lösen“ wollen — das ist eine Laboratoriumsarbeit. Wir werden daran erinnert, daß zum Mechanischen die Mathematik gehört. Jedes gute Ibsen-Drama schließt mit einer Formel. Das Leben durch anatomische und physiologische Untersuchung von Ganglien, Muskelfibrillen und Eiweißverbindungen begreifen zu wollen, die biologische Manier[S. 215] und Manie in der Behandlung gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Fragen sind durchaus Schwestern dieser problematischen Kausalitätspoesie und der auf die gleichen Oberflächenmotive versessenen Geschichtsschreibung unsrer Tage. An Stelle des Schicksals — von dem sie keine Ahnung haben — geraten sie ohne Ausnahme auf soziale und sexuelle „Fragen“, die sie an seiner Stelle „behandeln“.
Und doch hätten die Historiker gerade von den Vertretern unsrer reifsten Wissenschaft, der Physik, Vorsicht lernen sollen. Die kausale Methode zugegeben, so ist es die Flachheit ihrer Anwendung, die beleidigt. Hier fehlt es an geistiger Disziplin, an der Größe des Blickes, von der tiefen Skepsis, welche der Art des Gebrauchs physikalischer Hypothesen innewohnt, ganz zu schweigen. Denn der Physiker betrachtet seine Atome und Elektronen, Ströme und Kraftfelder, den Äther und die Masse weitab vom Köhlerglauben des Laien und Monisten als Bilder, deren Formensprache er den abstrakten Beziehungen seiner Differentialgleichungen unterlegt, ohne in ihnen eine andre Wirklichkeit als die konventioneller Zeichen zu suchen. Und er weiß, daß auf diesem, der Wissenschaft allein möglichen Wege nur eine symbolische Deutung des Mechanismus der verstandesmäßig aufgefaßten Außenwelt — nicht mehr — erreicht werden kann, sicherlich keine „Erkenntnis“ im hoffnungsvoll populären Sinne aller Darwinisten und materialistischen Historiker. Die Natur — Schöpfung und Abbild des Geistes, sein alter ego im Bereich des Ausgedehnten — erkennen, bedeutet sich selbst erkennen.
Eine gleiche Skepsis gegenüber der sinnlich-gedächtnismäßigen Bildfläche des „organischen Lebens“ und der Menschengeschichte, die nur ein Teil von ihm ist, wäre am Platze gewesen, aber hier hat die Selbsterkenntnis, die echte Naivität, die Distanz, die Uninteressiertheit im großen Sinne gefehlt. Wie die Physik unsre reifste, so ist die Biologie nach Gehalt und Methode unsre schwächste Wissenschaft. Was wirklich Geschichtsforschung sei, Physiognomik nämlich, ist durch nichts deutlicher zu machen als durch den Verlauf von Goethes Naturstudien. Er treibt Mineralogie: sogleich fügen sich ihm die Einsichten zum Bilde einer Erdgeschichte zusammen, in dem sein[S. 216] geliebter Granit das bedeutet, was ich innerhalb der Kulturgeschichte das Urmenschliche nenne — und er entdeckt die Eiszeiten. Er untersucht bekannte Pflanzen und das Phänomen der Metamorphose erschließt sich ihm, die Urgestalt der Geschichte alles Pflanzendaseins, und er gelangt weiterhin zu jenen seltsam tiefen Einsichten über die Vertikal- und Spiraltendenz der Vegetation, die noch heute nicht recht begriffen worden sind. Seine Knochenstudien, durchaus auf das Anschauen des Lebendigen gerichtet, führen ihn zur entscheidenden Entdeckung des os intermaxillare beim Menschen und der Einsicht, daß das Schädelgerüst der Wirbeltiere sich aus sechs Wirbelknochen entwickelt hat. Hier ist nicht von Kausalität und Teleologie die Rede. Hier empfand er die Notwendigkeit des Schicksals, wie er sie in seinen orphischen Urworten ausgedrückt hat. Der Darwinismus hat diese großen Ansätze verdorben, nicht vertieft. Überall ist es das reine, lebendige Werden, das Goethe im sinnlich-gegenwärtigen Bilde anschaut und nicht ein platter Zusammenhang von Ursache, Wirkung, Nutzen und Zweck. Die bloße Chemie der Gestirne, die mathematische Seite physikalischer Beobachtungen, die eigentliche Physiologie kümmern ihn, den großen Historiker der Natur, nicht, weil sie Systematik, Erfahrung von Gewordnem, Totem, Starrem sind, und dies liegt seiner Polemik gegen Newton zugrunde — ein Fall, in dem beide recht haben: der eine erkannte in der toten Farbe den exakt gesetzlichen Naturprozeß, der andre, der Künstler, hatte das intuitiv-sinnliche Erlebnis; hier liegt der Gegensatz beider Welten zutage und ich fasse ihn jetzt in seiner ganzen Schärfe zusammen.
Leben, Geschichte trägt das Merkmal des Einmalig-Tatsächlichen, Natur das des Ständig-Möglichen. Solange ich das Bild der Umwelt daraufhin beobachte, nach welchen Gesetzen es sich verwirklichen muß, ohne Rücksicht darauf, ob es geschieht oder nur geschehen könnte, zeitlos also, bin ich Naturforscher, treibe ich eine Wissenschaft. Es macht für die Notwendigkeit eines Naturgesetzes — und andere Gesetze gibt es nicht — nicht das geringste aus, ob es unendlich oft oder nie in Erscheinung tritt, d. h. es ist vom Schicksal unabhängig. Tausende chemischer Verbindungen kommen nie vor[S. 217] und werden niemals hergestellt werden, aber sie sind als möglich bewiesen und also sind sie da — für das System der Natur, nicht für die Geschichte des Weltalls. Geschichte aber ist der Inbegriff des einmaligen wirklichen Erlebens. Hier herrscht die Richtung im Werden, nicht die Ausgedehntheit des Gewordnen, das, was einmal war, nicht das, was immer möglich ist, das Wann, nicht das Was. Hier gibt es nicht Gesetze von Objekten, sondern Ideen, die in Phänomenen sich symbolisch offenbaren. Es kommt darauf an, was sie bedeuten, nicht, was sie sind. Man hat die eigne Notwendigkeit dieser Sphäre bisher nie begriffen und an Naturnotwendigkeiten — Kausalitäten angeknüpft. Der Physiker darf versichern, daß es keinen Zufall gibt. Das bedeutet für ihn: innerhalb des mechanisch-begrifflichen Natursystems sind Phänomene von historischer Bewegtheit, Ereignisse, die sich nie wiederholen können, unmöglich; hier herrscht die zeitlose Kausalität ohne Einschränkung, wenn die Reinheit und Geschlossenheit des Naturbildes gewahrt bleiben soll. Solange ich mit meiner ganzen gegenwärtigen Existenz im Weltbilde der Natur bin, frage ich, zu welcher Gattung diese Blume gehört und welches die Gesetze ihrer Ernährung, Entwicklung, Fortpflanzung sind, aber nicht, weshalb sie an dieser Stelle wuchs und ich sie gerade jetzt erblicke. Ich frage nach den Gesetzen der Spektralanalyse, aber nicht, weshalb die Natriumlinie dem irdischen Auge gelb erscheint. Ich frage nach den Formeln der Thermodynamik, aber nicht, weshalb sie im menschlichen Bewußtsein, dessen Abbild doch die Welt ist, gerade diese und nicht andere sind. Ich frage nach den Rassemerkmalen der Hellenen und Germanen, aber nicht, was es bedeutet, daß diese ethnischen Formen gerade dort und damals entstanden sind. Das eine ist Gesetz, das Gesetzte, über dessen Sinn und Ursprung die exakte Wissenschaft schweigt; das andre ist Schicksal. Im einen liegt die Notwendigkeit des Mathematischen, im andern die des Tragischen.
In der Wirklichkeit des wachen Daseins verweben sich beide Welten, die der Beobachtung und die der Hingebung, wie in einem Brabanter Wandteppich Kette und Einschlag das Bild „wirken“. Jedes Gesetz muß, um für den Geist überhaupt vorhanden zu sein, einmal durch eine Schicksalsfügung innerhalb[S. 218] der Geistesgeschichte entdeckt, d. h. erlebt worden sein, jedes Schicksal erscheint in einer sinnlichen Verkleidung — Personen, Taten, Szenen, Gebärden —, in der Naturgesetze am Werke sind. Das urmenschliche Leben war der dämonischen Einheit des Schicksalhaften hingegeben; im Bewußtsein reifer Kulturmenschen kommt der Widerspruch jenes frühen und dieses späten Weltbildes niemals zum Schweigen; im zivilisierten Menschen erliegt das tragische Weltgefühl dem mechanisierenden Intellekt. Geschichte und Natur stehen in uns einander gegenüber wie Leben und Tod, wie die ewig werdende Zeit und der ewig gewordene Raum. Im wachen Bewußtsein ringen Werden und Gewordnes um den Vorrang im Weltbilde. Die höchste und reifste Form beider Arten der Betrachtung, wie sie nur großen Kulturen möglich ist, erscheint für die antike Seele im Gegensatz von Plato und Aristoteles, für die abendländische in dem von Goethe und Kant: die reine Physiognomik der Welt, erschaut von der Seele eines ewigen Kindes, und die reine Systematik, erkannt vom Verstande eines ewigen Greises.
Und hier erblicke ich nunmehr die letzte große Aufgabe des abendländischen Denkens, die einzige, welche dem alternden Geiste der faustischen Kultur noch aufgespart ist, die, welche durch eine jahrhundertelange Entwicklung unseres Seelentums vorbestimmt erscheint. Es steht keiner Kultur frei, den Weg und die Haltung ihrer Philosophie zu wählen; hier zum ersten Male aber kann eine Kultur voraussehen, welchen Weg das Schicksal für sie gewählt hat.
Mir schwebt eine — spezifisch abendländische — Art, Geschichte im höchsten Sinne zu erforschen, vor, die bisher noch nie aufgetaucht ist und die der antiken und jeder andern Seele fremd bleiben mußte. Eine umfassende Physiognomik des gesamten Daseins, eine Morphologie des Werdens aller Menschlichkeit, die auf ihrem Wege bis zu den höchsten und letzten Ideen vordringt; die Aufgabe, das Weltgefühl nicht nur der eigenen, sondern das aller Seelen zu durchdringen, in denen große Möglichkeiten überhaupt bisher erschienen und deren[S. 219] Verkörperung im Bereiche des Wirklichen die einzelnen Kulturen sind. Dieser philosophische Aspekt, zu dem die analytische Mathematik, die kontrapunktische Musik, die perspektivische Malerei uns das Recht geben, uns erzogen haben, setzt, über die Talente des Systematikers, die Aufgaben des Rechnens, Ordnens, Zergliederns weit hinausgehend, das Auge eines Künstlers voraus, und zwar das eines Künstlers, der die sinnliche und greifbare Welt um sich in eine tiefe Unendlichkeit geheimnisvoller Beziehungen sich vollkommen auflösen fühlt. So fühlte Dante, so Goethe. Ein Jahrtausend organischer Kulturgeschichte als Einheit, als Person aus dem Gewebe des Weltgeschehens herauszuheben und in ihren innersten seelischen Bedingungen zu begreifen ist das Ziel. Wie man die bedeutenden Züge eines Rembrandtschen Bildnisses, einer Cäsarenbüste durchdringt, so die großen, tragischen, schicksalsvollen Züge im Antlitz einer Kultur, als der menschlichen Individualität höchster Ordnung, anzuschauen und zu verstehen ist die neue Kunst. Wie es in einem Dichter, einem Propheten, einem Denker, einem Eroberer aussieht, das hat man schon zu wissen versucht, aber in die antike, ägyptische, arabische Seele überhaupt einzugehen, um sie mitzuerleben, um in ihnen die Geheimnisse des Menschlichen überhaupt zu fühlen, das ist eine neue Art „Lebenserfahrung“. Jede Epoche, jede große Gestalt, jede Religion, Staaten, Völker, Künste, alles was je da war und da sein wird, ist ein physiognomisches Moment von höchster Symbolik, das ein Menschenkenner in einem ganz neuen Sinne des Wortes zu deuten hat. Eindrücke von höchster Realität, Sprachen und Schlachten, Städte und Rassen, die Feiern der Isis und Kybele und die katholische Messe, Hochofenwerke und Gladiatorenspiele, Derwische und Darwinisten, Eisenbahnen und Römerstraßen, „Fortschritt“ und Nirwana, Zeitungen, Sklavenmassen, Geld, Maschinen, alles ist in gleicher Weise, Zeichen und Symbol im Weltbilde, wie es eine Seele als Ausdruck ihrer Wesenheit vor sich verwirklicht. „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.“ Hier liegen Lösungen und Fernblicke verborgen, welche noch nicht einmal geahnt worden sind. Dunkle Fragen, die den tiefsten aller menschlichen Urgefühle, aller Angst, aller Sehnsucht, aller Religion und Metaphysik zugrunde liegen und vom Denken in[S. 220] die Probleme der Zeit, der Notwendigkeit, des Raumes, der Liebe, des Todes, Gottes verkleidet worden sind, werden aufgehellt. Es gibt eine ungeheure Musik der Sphären, die gehört sein will, die einige unsrer tiefsten Geister hören werden. Die Physiognomik des Weltgeschehens wird zur letzten, faustischen Philosophie.
[39] Die antike Tragödie, eine liturgische Aktion, gestattet den Umschlag vom Jubel zur Klage so gut wie den von der Klage zum Jubel. Das letztere ist, wie im δρᾶμα von Eleusis, in Äschylus’ Eumeniden und Sophokles’ Ödipus in Kolonos der Fall. Nach Aristoteles war dies sogar die ursprüngliche Form des „Tragischen“.
[40] Außer in der Elementarmathematik, unter deren Eindruck allerdings die meisten Philosophen seit Schopenhauer diesen Fragen nahetreten.
[41] Ganz ebenso steht an der Schwelle der arabischen Kultur die Erfindung der christlichen Zeitrechnung. Diesen Akt eines hohen historischen Weltgefühls hat das späte Arabertum mit der islamischen Zeitrechnung noch einmal wiederholt.
[42] Man muß sich in die Gefühle eines Griechen versetzen, der diese Sitte plötzlich kennen lernt.
[43] Der Weg von Calvin zu Darwin ist in der englischen Philosophie leicht nachzuweisen.
[44] Dies gehört zu den ewigen Streitpunkten abendländischer Poetik. Die antike, ahistorische, euklidische Seele hat keine „Entwicklung“; die abendländische erschöpft sich in ihr; sie ist „Funktion“ in Richtung auf einen Abschluß. Die eine „ist“, die andre „wird“. Mithin setzt alle antike Tragik die Konstanz der Person voraus, alle abendländische deren Variabilität. Erst dies ist „Charakter“ in unserm Sinne, eine Gestalt des Seins, die in unablässiger Bewegtheit und unendlichem Beziehungsreichtum besteht. Bei Sophokles adelt die große Geste das Leid, bei Shakespeare adelt die große Gesinnung die Tat. Weil unsre Ästhetik ihre Beispiele ohne Unterschied aus beiden Kulturen nahm, konnte sie das grundlegende Problem nur verfehlen.
[45] „Plus on vieillit, plus on se persuade, que sa sacrée Majesté le Hazard fait les trois quarts de la besogne de ce misérable Univers“ (Friedrich der Große an Voltaire). So empfindet ein echter Rationalist mit Notwendigkeit.
[46] Diese Tyche kann auch als die naturwissenschaftliche Größe aufgefaßt werden, deren heutiges Gegenstück der Determinismus ist.
[47] Helios ist nur eine poetische Metapher. Er hatte weder Tempel noch Statuen noch einen Kult. Noch weniger war Selene eine Mondgöttin.
[48] Daran ändert es nichts, daß Shakespeare in Wirklichkeit ein älteres Drama bearbeitet hat.
[49] Ich erinnere an das Wort Cannings aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts: „Südamerika frei — und womöglich englisch!“ Reiner ist der expansive Instinkt niemals zum Ausdruck gelangt.
[50] Die reife abendländische Kultur war eine durchaus französische, die seit Ludwig XIV. aus der spanischen erwachsen war. Aber schon unter Ludwig XVI. siegte in Paris der englische Park über den französischen, die Empfindsamkeit über den esprit, Kleidung und gesellschaftliche Formen von London über die von Versailles, Hogarth über Watteau, Möbel von Chippendale und Porzellan von Wedgwood über Reulle und Sarres.
[51] Hardenberg hat Preußen in streng englischem Geiste reorganisiert, was ihm Friedrich August v. d. Marwitz zum schweren Vorwurf machte. Ebenso ist die Heeresreform Scharnhorsts eine Art „Rückkehr zur Natur“ im Sinne Rousseaus gegenüber den Berufsheeren der Kabinettskriege zur Zeit Friedrichs des Großen.
[S. 221]
[S. 223]
Und so erweitert sich der Gedanke einer Weltgeschichte in streng morphologischem Sinne zur Idee einer allumfassenden Symbolik. Die Geschichtsforschung an sich hat nur den sinnlichen Inbegriff der lebendigen Wirklichkeit, ihr flüchtiges Bild, zu prüfen und dessen typische Formen festzustellen. Der Schicksalsgedanke ist der letzte, bis zu dem sie vordringen kann. Indessen diese Forschung, so neu und umfassend sie im hier angegebenen Sinne ist, kann dennoch nur Fragment und Grundlage einer noch umfassenderen Betrachtung sein. Ihr zur Seite steht eine Naturforschung, ebenso fragmentarisch und eingeschränkt in ihrem Ideenkreise. Hier aber werden die letzten Fragen des Seins überhaupt angerührt. Alles, dessen wir uns bewußt sind, in welcher Gestalt auch immer, als Seele und Welt, Leben und Wirklichkeit, Geschichte und Natur, Gesetz, Raum, Schicksal, Gott, Zukunft und Vergangenheit, Gegenwart und Ewigkeit, hat für uns noch einen tiefsten Sinn — daß alles so ist und nicht anders — und das einzige und äußerste Mittel, dieses Unfaßliche faßlich zu machen, diese Geheimnisse, die nur gefühlt und in seltenen Momenten mit visionärer Deutlichkeit erlebt werden können, in einer allerdings dunklen Weise, aber der einzig möglichen mitzuteilen — vielleicht nur wenigen und auserlesenen Geistern —, liegt in einer neuen Art von Metaphysik, für die alles, es sei was es wolle, den Charakter eines Symbols besitzt.
Symbole sind sinnliche Einheiten, letzte, unteilbare und vor allem ungewollte Eindrücke von bestimmter Bedeutung. Ein Symbol ist ein Stück Wirklichkeit, das für das leibliche oder geistige Auge etwas bezeichnet, das verstandesmäßig nicht mitgeteilt werden kann. Ein frühdorisches, früharabisches, frühromanisches[S. 224] Ornament z. B. auf einer Vase, einer Waffe, an einem Portal oder Sarkophag ist der sinnbildliche Ausdruck eines neuen Weltgefühls, das nur zu Menschen einer einzigen Kultur redet und diese Menschen aus dem allgemeinen Menschentum heraushebt und zusammenschließt. Die gefühlte Einheit einer Kultur beruht auf der gemeinsamen Sprache ihrer Symbolik. Gesetzt, daß alles, was ist, irgendwie Ausdruck eines Seelischen ist — und wir werden uns davon überzeugen —, so ist es zugleich auch Eindruck auf eine Seele und dieser Zusammenhang, in dem der Mensch zugleich Subjekt und Objekt ist, repräsentiert das Wesen des Symbolischen. Es folgt daraus, daß auch der Mensch selbst Symbol ist, als Person und als Menge, nicht nur der gegenwärtigen Leiblichkeit nach, mit der er dem Weltbilde der Natur und dem Bereiche der Kausalität angehört — eben als Mensch, Familie, Volk, Rasse —, sondern durch die Gesamtheit seines Seelenlebens, soweit dieses sich selbst — im Weltbilde der Geschichte — als Schicksal, als werdend begreift und als das Schicksal, das Werden „des andern“ miterlebt werden kann.
Es ist dies eine gewagte und schwer zugängliche Betrachtungsweise. Absolute Standpunkte — die etwa das Ich, das Denken, die Natur, Gott als Ausgang und Maßstab setzen —, wie sie die Philosophie um ihrer Systematik willen liebt und im Grunde nicht entbehren kann, sind hier selbst noch Symbole, Objekte, nicht Richtlinien der Betrachtung.
Für den abendländischen Menschen auf der Höhe seiner längst großstädtisch und intellektuell gewordnen Kultur existiert ein wohlgeordnetes Bild der Historie, dessen Mittelgrund die sechs Jahrtausende der „Weltgeschichte“ auf einem kleinen Planeten bilden, während der Horizont sich in astronomische, geologische oder mythologische Fernen allmählich verliert. Dies Bild, ein wesentliches Ergebnis unsres wachen Daseins, eine Welt, aus deren Hintergrund die abendländische Seele sich selbst erst begreift, ist die uns notwendige Form, alles, was wirklich ist, als sich verwirklichend geordnet aufzufassen. Vom sicheren Standpunkte des Jetzt und Hier blicken wir über Vergangenheit und Zukunft hin. Nichts scheint realer als diese Perspektive.
Aber dem Urmenschen ist eine solche Anschauung unbekannt. Der antike und indische Mensch erlebte — wie wir aus entscheidenden[S. 225] Zeichen entnehmen — Verwandtes, aber jedenfalls in schattenhaften Umrissen und von ganz andrer Farbe. Also ist diese so klare und unzweideutige „Weltgeschichte“ nur unser Eigentum? Also gibt es keine historische, für alle Menschen vorhandene und identische Wirklichkeit? Also ist dies ein bloßer Ausdruck, eine freie Phantasie, Funktion einer einzelnen Seele? Dies herdenhafte Gewoge menschlicher Generationen durch Jahrhunderte hin, diese Episode im Werden zahlloser Sonnensysteme durch Jahrmillionen, diese längst erstorbenen Landschaften einer Kulturblüte am Nil, Ganges und Ägäischen Meer wären nichts als eine Vision des faustischen Geistes? Erinnern wir uns, daß alle Philosophie von jeher das gleiche vom Bilde der Natur behauptete, indem sie es Erscheinung nannte. Der Mensch war gewiß ein Atom im Weltall, aber das Weltall war zugleich das Produkt seiner Vernunft.
Dies ist das große Mysterium des menschlichen Bewußtseins, das man einfach hinzunehmen hat. Der in ihm hervortretende Widerspruch ist dem Denken unzugänglich. Idealistische wie realistische Lehren, die das eine als Tatsache, das andere als Schein bezeichnen, können das Geheimnis nur schematisch vergewaltigen, aber nicht lösen.
Seele und Welt: in dieser Polarität erschöpft sich das Wesen unsres Bewußtseins, wie das Phänomen des Magnetismus sich im wechselseitigen Widerstreben zweier Pole erschöpft. Diese Seele, und zwar die jedes Einzelnen, welche in sich diese ganze Welt des historischen Werdens erlebt und also schafft, sie zum Ausdruck ihres So-Seins macht, ist zugleich, aus einem anderen Aspekte, ein winziges Element, ein flüchtiges Aufleuchten in ihr?[52] Was sind Cäsar, Ramses, Wallenstein anderes als Phänomene im historischen Weltbilde, wie es eine höhere Seele in sich entwickelt? Sind sie für das — ahistorische — Bewußtsein eines Kindes wirklich vorhanden? Wären sie „wirklich“, wenn alle Menschen sich heute wieder im seelischen Urzustande etwa der Weströmer zur Zeit Aurelians befänden? Alle „andern“ Menschen, so wie sie im Gedächtnisbilde der Historie erscheinen, sind Ausdruck der Seele des „einen“, seien es die großen Persönlichkeiten,[S. 226] die in einem früher festgestellten Sinne einmal Epoche machten, seien es die Menschen der Menge zu irgendeiner Zeit. Was alles diese Menschen aller Zeiten denken, wollen, tun, sind, die ganze werdende, schicksalsvolle Welt also, ist Zeichen und Symbol dessen, der sie erlebt. Das Geheimnis des eignen Schicksals offenbart sich im Schicksal einer um uns werdenden oder von uns als geworden erkannten Welt. Die Dämmerseele des Kindes und frühen Menschen ahnt ihre Welt nur; erst die helle Tagesseele hoher Kulturen, die sich selbst als wohlgeordnete Einheit, eben als „Seele“ kennt und fühlt, besitzt auch eine geordnete Welt als ihr Eigentum. Sie prägt in jedem wachen Lebensmomente aus dem Chaos des Sinnlichen einen Kosmos symbolisch gestalteter Objekte oder Phänomene — je nachdem dieser Kosmos die Merkmale der Natur oder der Geschichte trägt.
Diese Wirksamkeit nennen wir Leben. Leben ist die Verwirklichung des innerlich Möglichen. Jede Seele, die einer Kultur, eines Volkes, eines Standes so gut wie die eines Einzelnen, hat vom Augenblick ihrer Geburt in der Welt des Werdens und Schicksals an bis zu ihrem Erlöschen den einen rastlosen Drang, sich völlig zu verwirklichen, sich ihre Welt als volle Summe ihres Ausdrucks zu bilden, das, was ich das Fremde nannte, zu einer bedeutungsvollen Einheit auszuprägen, es durch begrenzte und gewordne Form zu bannen und sich anzueignen. Eine vollendete Welt ist die Ausstrahlung, ist der Sieg einer Seele über die fremden Mächte.
Es liegt ein und dasselbe Ereignis vor, wenn in einem Momente der frühesten Kindheit wie mit einem Zauberschlage das Innenleben erwacht, die Seele sich ihrer selbst bewußt wird, und wenn in einer mit formloser Menschheit erfüllten Landschaft mit rätselhafter Vehemenz eine große Kultur ins Dasein tritt. Von hier an beginnt die Vollendung eines Lebens im höheren Sinne, man darf sagen die Erfüllung eines vorbestimmten Schicksals. Eine Idee will verwirklicht werden und sie wird es im Bilde einer Welt; die reine Natur, die reine Geschichte oder eine der unzähligen Mischungen beider Weltformen sind nur mögliche Arten, die Gesamtheit des Ausdrucks zu ordnen.
[S. 227]
Es wird hier nicht davon die Rede sein, was eine Welt ist, sondern was sie bedeutet. Physiognomik, nicht Systematik ist die Aufgabe. Die Wirklichkeit — man kann sagen die Welt in bezug auf eine Seele — ist für jeden einzelnen Menschen und jede einzelne Kultur die Projektion des Gerichteten in den Bereich des Ausgedehnten; sie ist eine Inkarnation des innern Seins und Wesens, das Eigne, das sich am Fremden reflektiert; sie bedeutet ihn selbst. Durch einen ebenso schöpferischen als unbewußten Akt — nicht „ich“ verwirkliche das Mögliche, sondern „es“ verwirklicht sich durch mich als empirische Person — entsteht plötzlich und mit vollkommenster Notwendigkeit aus der Totalität sinnlicher und gedächtnismäßiger Elemente „die“ Welt, für mich die einzige. Es ist die Notwendigkeit des Schicksals, nicht der Kausalität, die über dem So-Sein der Seele und mithin ihrer Verwirklichung im Gewordnen waltet.
Und deshalb gibt es so viele Welten als es Menschen und Kulturen gibt, und im Dasein jedes einzelnen ist die vermeintlich einzige, selbständige und ewige Welt — die jeder mit dem andern gemein zu haben glaubt — ein immer neues, einmaliges, nie sich wiederholendes Erlebnis.
Unterscheiden wir wieder zwischen Erleben und Erlebtem, Erkennen und Erkanntem. Die Akte sind einmalig und schicksalhaft; erst das vollendete Resultat trägt das Merkmal der mechanischen Identität durch eine Vielheit lebendiger Akte hindurch.
Erst im stets erneuerten und doch verharrenden Weltbilde — einem Wasserfall, der im flüchtigsten Vorübergang der Tropfen in der Ruhe seiner Erscheinung verweilt — ist die Sonne täglich und immer dieselbe und das bewußte Leben ein Ganzes durch die Folge aller Augenblicke hindurch. Die Identität des Vollendeten liegt in gleicher Weise der extremen Gegenständlichkeit — „Natur“ — wie dem reinen Phänomen — „Geschichte“ — zugrunde. Sie ist die Vorbedingung aller Symbolik, die ohne eine gewisse Dauer der Bedeutung nicht bestehen kann.
Eine Skala sich steigernder Bewußtheit führt von den Uranfängen kindlich-dumpfen Schauens, in denen es noch keine klare Welt für eine Seele und keine ihrer selbst gewisse Seele[S. 228] inmitten einer Welt gibt, zu den höchsten Graden durchgeistigter Zustände, deren nur Menschen ganz reifer Zivilisationen — nicht Kulturen — fähig sind, dem Bewußtsein als Polarität von exaktem Verstand und vollkommen mechanischer Erfahrungswelt. Diese Steigerung ist zugleich eine Entwicklung der Symbolik. Nicht nur wenn ich in der Art des Kindes, des Träumers, des Künstlers die Welt hinnehme; nicht nur, wenn ich wach bin, ohne sie mit der gespannten Aufmerksamkeit des denkenden und tätigen Menschen aus einer gewissen Perspektive aufzufassen — ein Zustand, der selbst im Bewußtsein des eigentlichen Denkers und Tatmenschen weit seltener herrscht als man glaubt —, sondern stets und immer, solange von Bewußtsein, d. h. von Leben überhaupt die Rede sein kann, verleihe ich dem Außer-mir den Gehalt meines ganzen Selbst, von den halb träumerischen Eindrücken der Welthaftigkeit bis zur starren Welt der kausalen Gesetze und Zahlen, die jene überlagert und bindet. Aber selbst dem Reich der Zahlen fehlt das Persönliche nicht. Es gibt sehr allgemeine Züge in diesen rein mechanischen Formenwelten; sie können das Bild bis zur völligen Täuschung beherrschen und man kann und möchte über dem Allgemeinen das Individuelle und also Symbolische vergessen — vorhanden ist es immer.
Dies ist die Idee des Makrokosmos, der Wirklichkeit als des Inbegriffs aller Symbole in bezug auf eine Seele. Nichts ist von dieser Eigenschaft des Bedeutsamen ausgenommen. Alles, was ist, ist auch Symbol. Von der körperlichen Erscheinung an — Antlitz, Statur, Geste, Haltung von Einzelnen, von Klassen, von Völkern —, wo man es immer gewußt hat, bis zu den Formen des politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Lebens, bis zu den vermeintlich ewigen und allgemeingültigen Formen der Erkenntnis, Mathematik, Physik spricht alles vom Wesen einer bestimmten und keiner andern Seele.
Allein auf der größeren oder geringeren Verwandtschaft der einzelnen Welten untereinander, soweit sie von Menschen einer Kultur oder Sphäre erlebt werden, beruht die größere oder geringere Mitteilbarkeit des Geschauten, Empfundenen, Erkannten, das heißt des im Stil des eignen Seins Gestalteten durch die Mittel der Sprache und Schrift, durch Begriffe, Formeln, Zeichen,[S. 229] die ihrerseits selbst Symbole sind. Zugleich erscheint hier eine ewige und bisher kaum gekannte Grenze, fremden Individualitäten wirkliche Mitteilungen zu machen oder deren Lebensäußerungen wirklich zu verstehen. Der Grad der Kongruenz der beiderseitigen Formenwelten entscheidet darüber, wo das Verständnis in Selbsttäuschung übergeht. Mit der Möglichkeit, sich in den Makrokosmos des andern hineinzuversetzen, ist beides zu Ende. Wir können die indische und ägyptische Seele — offenbart in ihren Menschen, Sitten, Schriftzeichen, Ideen, Bauten, Taten — sicherlich nur höchst unvollkommen imaginieren. Den Griechen, ahistorisch wie sie waren, war auch die geringste Ahnung vom Wesen fremden Seelentums versagt. Man sehe, mit welcher Naivität sie in den Göttern und Kulturen aller fremden Völker ihre eignen wiederfanden. Aber auch wir unterlegen, wenn wir bei einem antiken Philosophen das Wort χρόνος mit Zeit übersetzen und damit in uns einen ganzen, spezifisch faustischen Gedankenkomplex wachrufen, der fremden Intention das eigne Weltgefühl, aus dem die Bedeutung unsrer Worte stammt. Wenn wir die Züge einer ägyptischen Statue interpretieren, nehmen wir ohne Anstand die eigne innere Erfahrung zu Hilfe. In beiden Fällen täuschen wir uns. Daß die Meisterwerke der Kunst alter Kulturen für uns noch lebendig — „unsterblich“ also — seien, gehört ebenfalls in den Kreis dieser Illusionen, die lediglich durch die Tatsache aufrecht erhalten werden, daß unser Geist hier, zugunsten seines eignen Weltgefühls, aus einem tiefen Instinkt ständig mißversteht. Darauf beruht zum Beispiel die Wirkung der Laokoongruppe auf die Kunst der Renaissance und die des Sophokles auf das klassizistische Drama der Franzosen.
Symbole, als etwas Verwirklichtes, gehören zum Bereich des Ausgedehnten. Sie sind geworden, nicht werdend — auch wenn sie ein Werden bezeichnen, auch wenn sie in bedeutungsvollen Gebräuchen oder Gesten bestehen — mithin starr begrenzt und den Gesetzen des Raumes unterworfen. Es gibt nur sinnlich-räumliche (stoffliche oder ornamentale) Symbole.[S. 230] Schon das Wort Form bezeichnet etwas Ausgedehntes. Der Sinn aller Grenzen aber ist Vergänglichkeit. Es gibt keine ewigen Symbole. Auch die überall auftauchenden Zeichen des Dreiecks, des Hakenkreuzes (swastika), des Ringes sind als Symbole vergänglich. Sie kommen in vielen Kulturen vor, aber sie sind jedesmal von andrer Bedeutung und in Hinsicht darauf jedesmal neu geschaffen und von begrenzter Lebensdauer. Man braucht nur die Schicksale der antiken Säule zu verfolgen, vom hellenischen Peripteros an, wo sie mittels des Architravs das Dach trägt, über die früharabische Basilika, wo sie einen Innenraum gliedert, bis zum Renaissancebau, wo sie als Teilmotiv einer Fassade eingefügt ist, um zu fühlen, was Umdeutung eines Symbols heißt, wenn eine neue Kultur es einer alten entlehnt.
Das seelisch Mögliche, noch zu Vollendende, heißt Zukunft. Das Vollendete heißt Vergangenheit. Die Richtung (Nichtumkehrbarkeit) des Lebens, durch die Worte Zeit, Schicksal, Wille in den Sprachen aller Völker angedeutet, verknüpft beides im Phänomen der Gegenwart, des augenblicklichen Bewußtseins. Die Priorität des Werdens vor dem Gewordnen war oft betont worden. Sobald das Werden sich vollzogen, das Mögliche sich verwirklicht hat, ist seine Bestimmung erfüllt. Die sich nähernde Zukunft wurde zur ruhenden Vergangenheit. Sie wurde zum Raum und verfiel damit dem organischen Prinzip der Kausalität. Schicksal und Kausalität, Zeit und Raum, Richtung und Ausdehnung verhalten sich wie Leben und Tod.
Es besteht ein rätselhafter Zusammenhang zwischen dem Raum und dem Tode, der gerade von frühen Seelen immer tief gefühlt worden ist. Die religiöse Metaphysik drückt dies so aus, daß Geburt und Tod der Erscheinungswelt angehören oder daß mit der Verbannung der Seele in das Reich der (kausalen) Notwendigkeit der Tod gesetzt ist.
Der Mensch ist das einzige Wesen, welches den Tod kennt. Alle andern sind rein werdend, von einer durchaus auf die punktförmige Gegenwart eingeschränkten Bewußtheit, die ihnen endlos erscheinen muß; sie leben, aber sie wissen nichts vom Leben wie die Kinder in den frühesten Jahren, wo sie die christliche Weltanschauung noch als „unschuldig“ betrachtet.[S. 231] Erst der wache Mensch besitzt außer dem Werden auch Gewordenes, das heißt nicht nur ein Dasein, das sich von einer Umwelt abhebt, sondern auch ein Gedächtnis für Erlebnisse und eine Erfahrung von Erkanntem. Für alle andern verläuft das Leben ohne Ahnung seiner Grenzen, das heißt ohne ein Wissen um Aufgabe, Sinn, Dauer und Ziel. Erst mit dem vollen Besitz einer räumlichen Wirklichkeit — einer Welt als Ausstrahlung einer Seele — erscheint auch das große Rätsel des Todes. Mit tiefer und bedeutungsvoller Identität knüpft sich das Erwachen des Innenlebens in einem Kinde oft an den Tod eines Verwandten. Es begreift plötzlich den leblosen Leichnam, der ganz Stoff, ganz Raum geworden ist, und zugleich fühlt es sich als einzelnes Wesen in einer endlosen, ausgedehnten Welt. „Vom fünfjährigen Knaben bis zu mir ist nur ein Schritt. Vom Neugeborenen bis zum fünfjährigen Kinde ist eine schreckliche Entfernung“, hat Tolstoi einmal gesagt. Hier, in diesem entscheidenden Moment des Daseins, wo der Mensch zum Menschen wird und seine ungeheure Einsamkeit im All kennen lernt, enthüllt sich die Weltangst als die Angst vor dem Tode, der Grenze, dem Raume. Hier liegt der Ursprung des höheren Denkens, das zuerst ein Nachdenken über den Tod ist. Jede Religion, jede Philosophie geht von hier aus. Jede große Symbolik heftet ihre Formensprache an den Totenkult, die Bestattungsform, den Schmuck des Grabes. Die ägyptische Kunst beginnt mit den Totentempeln der Pharaonen, die antike mit der Ornamentik der Grabvasen, die früharabische mit Katakomben und Sarkophagen, die abendländische mit den Domen, in denen das Meßopfer, die Wiederholung des Sterbens Christi, sich täglich vollzieht. Mit einer neuen Idee des Todes erwacht jede neue Kultur. Als um das Jahr 1000 der Gedanke an das Weltende sich im Abendland verbreitete, wurde die faustische Seele dieser Landschaft geboren.
Der Urmensch, in tiefem Staunen über den Tod, wollte diese Welt des Ausgedehnten mit den unerbittlichen und stets gegenwärtigen Regeln ihrer Kausalität, mit ihrer dunklen Allmacht, die ihn ständig mit dem Ende bedrohte, mit allen Kräften seines Geistes durchdringen und beschwören. Dieser Akt liegt tief im Unbewußten, aber indem er Seele und Welt erst eigentlich[S. 232] schuf, trennte, gegeneinander stellte, bezeichnete er die Schwelle individuellen Daseins. Ichgefühl und Weltgefühl beginnen zu wirken und alle Kultur, innere und äußere, ist nur die Steigerung dieses Menschseins überhaupt. Von hier an sind alle Dinge nicht mehr nur Eindruck, rein animalisch, wie beim neugebornen Kinde, sondern auch Ausdruck. Zuerst besaßen sie allein ein Verhältnis zum Menschen, jetzt besitzt der Mensch auch ein Verhältnis zu ihnen. Sie sind Symbole seines Daseins geworden. So geht der Sinn aller echten — unbewußten und innerlich notwendigen — Symbolik aus dem Phänomen des Todes hervor, in dem sich das Wesen des Raumes enthüllt. Alle Symbolik stammt aus der Furcht. Sie bedeutet eine Abwehr. Sie ist der Ausdruck einer tiefen Scheu im alten Doppelsinne des Wortes: ihre Formensprache redet zugleich von Feindschaft und Ehrfurcht.
Alles Gewordne ist vergänglich. Vergänglich sind nicht nur Völker, Sprachen, Rassen, Kulturen. Es wird in wenigen Jahrhunderten keine westeuropäische Kultur, keinen Deutschen, Engländer, Franzosen mehr geben, wie es zur Zeit Justinians keinen Römer mehr gab. Nicht die Masse menschlicher Generationen war erloschen; die Form eines Volkes, die eine Anzahl von ihnen zu einer einheitlichen Gebärde zusammengefaßt hatte, war nicht mehr da. Der civis Romanus, eines der stärksten Symbole antiken Seins, war als Form nur von der Dauer einiger Jahrhunderte. Alle Kunst ist sterblich, nicht nur die einzelnen Werke, sondern die Künste selbst. Es wird eines Tages das letzte Bildnis Rembrandts und der letzte Takt Mozartscher Musik aufgehört haben zu sein, obwohl eine bemalte Leinwand und ein Notenblatt vielleicht übrig sind, weil das letzte Auge und Ohr verschwand, das ihrer Formensprache zugänglich war. Vergänglich ist jeder Gedanke, jedes Dogma, jede Wissenschaft, sobald die Seelen und Geister erloschen sind, in deren Welten ihre „ewigen Wahrheiten“ mit Notwendigkeit als wahr erlebt wurden. Vergänglich sind sogar die Sternenwelten, welche die Astronomen am Nil und Euphrat betrachteten, denn unser — ebenso vergängliches — mit dem Auge des abendländischen Menschen gesehenes, aus seinem Gefühl herausgebildetes Weltsystem, dessen Form Kopernikus aufstellte, ist ein anderes.
[S. 233]
Und so läßt sich der Gedanke des Makrokosmos wieder an das Wort knüpfen, dem die ganze fernere Darstellung gewidmet sein soll: Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis.
So führt diese Idee unvermerkt auf das Raumproblem, allerdings in einem neuen und überraschenden Sinn. Seine Lösung — oder bescheidener, seine Deutung — erscheint erst in diesem Zusammenhange möglich, so wie das Zeitproblem erst aus der Schicksalsidee faßlicher wurde. Es sei daran erinnert, daß, wie „die Zeit“ dem Gefühl der Weltsehnsucht, so der Raum, insofern dem Makrokosmos eine Absicht auf Bannung der fremden Mächte mittels der Form zugrunde liegt, dem Urgefühl der Angst nahe steht.
„Der Raum“ ist sicherlich zunächst wie „die Welt“ ein kontinuierliches Erlebnis des einzelnen wachen Menschen, nicht mehr. Schon die Überzeugung, welche infolge der verhältnismäßigen Gleichartigkeit der im Einzeldasein aufeinanderfolgenden Raumerlebnisse und der Unmöglichkeit, sich über das Individuelle im „Raum des andern“ sprachlich zu verständigen, vorherrscht, daß nämlich dieser Außenraum konstant und für alle gemeinsam und identisch sei, ist ein unbeweisbares Vorurteil. Das entsprechende Wort, das in allen Sprachen nicht nur anders klingt, sondern auch anderes bedeutet, verdeckt entscheidende Aufklärungen. Ist „der Raum“ ein allgemein menschliches Erlebnis? Oder das einer einzelnen Kultur? Oder nicht einmal das?
Das eigentliche Problem im Phänomen des Ausgedehnten knüpft sich an das Wesen der Tiefe — der Ferne oder Entfernung — deren abstraktes Schema im System der Mathematik neben Länge und Breite als „dritte Dimension“ bezeichnet wird. Diese Dreizahl koordinierter Faktoren ist von vornherein irreführend. Ohne Zweifel sind im räumlichen Eindruck diese Elemente nicht gleichwertig, geschweige denn gleichartig. „Länge und Breite“, sicherlich als Erlebnis eine Einheit, keine Summation, sind, mit Vorsicht gesagt, Form der Empfindung. Sie repräsentieren den urmenschlichen, rein sinnlichen Eindruck. Die Tiefe repräsentiert den Ausdruck; mit ihr beginnt die „Welt“. Diese der Mathematik selbstverständlich ganz fremde Unterscheidung in der Bewertung der[S. 234] dritten Dimension gegenüber den sogenannten beiden andern liegt auch in der Gegenüberstellung der Begriffe Empfindung und Anschauung. Die Dehnung in die Tiefe verwandelt die erste in die letzte. Erst die Tiefe ist die eigentliche Dimension im wörtlichen Sinne, das Ausdehnende. In ihr ist der Geist aktiv, in den andern streng passiv. Es ist der symbolische Gehalt einer Ordnung, und zwar im Sinne einer einzelnen Kultur, der sich zutiefst in diesem ursprünglichen und nicht weiter analysierbaren Element ausspricht. Das Erlebnis der Tiefe ist — von dieser Einsicht hängt alles Weitere ab — und und ebenso vollkommen unbewußter und notwendiger als vollkommen schöpferischer Akt, durch den das Ich seine Welt, ich möchte sagen zudiktiert erhält. Er schafft aus dem Chaos von Empfindungen eine formvolle Einheit, etwas Gewordnes, das nunmehr von Gesetzen beherrscht, dem Kausalprinzip unterworfen und mithin, als Abbild eines Seelentums, vergänglich ist.
Es besteht kein Zweifel, obwohl der durch theoretisches Selbstgefühl voreingenommene Verstand sich dagegen auflehnt, daß das Phänomen der Dehnung unendlicher Variation fähig ist, nicht nur ein anderes beim Kind und Manne, beim Naturmenschen und Städter, Chinesen und Römer, sondern in jedem einzelnen, je nachdem er nachdenklich oder aufmerksam, tätig oder ruhend seine Welt erlebt. Jeder Künstler hat noch „die“ Natur durch Farbe und Linie wiedergegeben. Jeder Physiker, der griechische, arabische, germanische hat „die“ Natur in letzte Elemente zergliedert — warum fanden sie nicht alle dasselbe? Weil jeder seine eigene Natur hat, obwohl jeder sie mit einer Naivität, die seinen Lebensgehalt rettet, die ihn rettet, mit dem andern gemeinsam zu haben glaubt. Natur ist ein Erlebnis, das durch und durch mit persönlichstem Gehalt gesättigt ist. Natur ist eine Funktion der jeweiligen Kultur. Und man braucht nur Zeitgenossen wie Holbein, Dürer und Grünewald hinsichtlich ihrer Behandlung des Bildraums zu vergleichen, um zu fühlen, daß das Erlebnis der Tiefe, „der Raum“, also die ganze Natur selbst für sie etwas sehr Verschiedenes ist.
Nun hat Kant die große Frage, ob dies Element a priori vorhanden oder durch Erfahrung erworben ist, durch seine berühmte[S. 235] Formel zu entscheiden geglaubt, daß der Raum die allen Welteindrücken zugrunde liegende Form der Anschauung sei. Aber die „Welt“ des Urmenschen, des Kindes und des Träumers besitzt dies Element unzweifelhaft in chaotischer, schwankender, unentschiedner Art und erst das höhere Seelentum formt das Chaotische zur geordneten Welt, gibt also dem Element der Tiefe eine eindeutige, symbolisch bestimmte Fassung. Es ist keine Frage, daß der Raum, wie ihn Kant mit unbedingter Gewißheit um sich sah, als er über seine Theorie nachdachte, für seine Vorfahren zur Karolingerzeit auch nicht annähernd in dieser exakten Gestalt vorhanden war. Gehen wir noch weiter. Kants Größe beruht auf der Konzeption des Begriffes einer Form „a priori“, aber nicht auf der Anwendung, die er ihm gab. Daß die Zeit keine Form der Anschauung ist, daß sie überhaupt keine „Form“ ist — es gibt nur extensive Formen — und offensichtlich nur als Pendant zum Raume so definiert wurde, sahen wir schon. Es ist aber nicht nur die Frage, ob gerade das Wort Raum den formalen Gehalt im Angeschauten genau deckt; es ist auch eine Tatsache, daß die Form der Anschauung sich mit dem Grade der Entfernung ändert: Jedes entfernte Gebirge wird als reine Fläche — Kulisse — „angeschaut“. Niemand wird behaupten, daß er die Mondscheibe körperhaft sehe. Der Mond ist für das Auge eine absolute Fläche und erst durch das Fernrohr stark vergrößert — also künstlich angenähert — erhält er mehr und mehr räumliche Beschaffenheit. Augenscheinlich ist die Form der Anschauung also eine Funktion der Distanz. Es tritt eine unvermerkte, aber für den zivilisierten Menschen sehr stark wirksame Abstraktion hinzu, die über den veränderlichen Charakter dieser Eindrücke täuscht. Kant hat sich täuschen lassen. Er hätte zwischen Formen der Anschauung und des Verstandes gar nicht scheiden dürfen, denn sein Begriff Raum umfaßt bereits beides. Sein Gedanke, daß die unbedingte anschauliche Gewißheit einfacher geometrischer Tatsachen die Apriorität des exakten Raumes beweise, beruht auf der schon erwähnten allzu populären Ansicht, daß Mathematik entweder Geometrie oder Arithmetik — Konstruktion oder Rechnen — sei.
Nun war schon damals die Mathematik des Abendlandes weit über dieses naive — der Antike nachgesprochene — Schema[S. 236] hinausgegangen. Wenn die Geometrie statt „des Raumes“ mehrfach unendliche Zahlenmannigfaltigkeiten zugrunde legt, unter denen die dreidimensionale ein an sich nicht ausgezeichneter Einzelfall ist, und innerhalb dieser höchst transzendenten Gruppen funktionale Gebilde hinsichtlich ihrer Struktur untersucht, so hat jede überhaupt mögliche Art von sinnlicher Anschauung aufgehört, sich formal mit mathematischen Tatsachen im Gebiete solcher Extensionen zu berühren, ohne daß die Evidenz der letzteren dadurch herabgesetzt worden wäre. Die Mathematik ist von der Form des Angeschauten ganz unabhängig. Es ist nun die Frage, wie viel von der gerühmten Evidenz der Anschauungsformen, die doch im Gegensatz zur Mathematik an die vitalen Bedingungen des Sehsinnes gebunden sind, für sich übrig bleibt, sobald die künstliche Übereinanderschichtung beider in einer vermeintlichen Erfahrung erkannt worden ist.
Wie Kant sich das Zeitproblem dadurch verdarb, daß er es zu der in ihrem Wesen mißverstandenen Arithmetik in Beziehung brachte und also von einem Zeitphantom redete, dem die lebendige Richtung fehlte, das also nur noch ein dimensionales, räumliches Schema war, so verdarb er sich das Raumproblem durch seine Beziehung auf eine Allerweltsgeometrie. Der Zufall hat es gewollt, daß wenige Jahre nach der Vollendung seines Hauptwerkes Gauß die erste der nichteuklidischen Geometrien entdeckte, durch deren in sich widerspruchslose Existenz bewiesen wurde, daß es mehrere Arten streng mathematischer Struktur der dreidimensionalen Ausgedehntheit gibt, die sämtlich „a priori gewiß“ sind, ohne daß es möglich wäre, eine von ihnen als die eigentliche „Form der Anschauung“ herauszuheben.
Es war ein schwerer und für einen Zeitgenossen Eulers und Lagranges unverzeihlicher Irrtum, die antike Schulgeometrie, denn an sie hat Kant immer gedacht, in den Formen der erlebten Natur abgebildet finden zu wollen. In den Augenblicken, wo wir die Natur daraufhin aufmerksam beobachten, ist in der Nähe des Beobachters und bei hinreichend kleinen Verhältnissen eine annähernde Übereinstimmung zwischen dem optischen Eindruck und den Prinzipien der gewöhnlichen euklidischen Geometrie sicherlich vorhanden. Die von der Philosophie behauptete absolute Übereinstimmung läßt sich aber weder durch den Augenschein[S. 237] noch durch Meßinstrumente nachweisen. Beide können eine gewisse, für die praktische Entscheidung über die Frage z. B., welche der nichteuklidischen Geometrien die des empirischen Raumes sei, bei weitem nicht ausreichende Grenze der Genauigkeit niemals überschreiten.[53] Bei großen Maßstäben und Entfernungen, wo das Tiefenerlebnis das Anschauungsbild völlig beherrscht — vor einer weiten Landschaft etwa statt vor einer Zeichnung — widerspricht die Anschauungsform der Mathematik gründlich. Die Fixsterne erscheinen dem Auge an einer andern Stelle des betrachteten Raumes, als die ist, welche sie im theoretisch-astronomischen Raume nach mathematischer Feststellung einnehmen.[54] Wir sehen in jeder Allee, daß Parallelen sich am Horizonte berühren. Die Perspektive der abendländischen Ölmalerei, deren tiefer Zusammenhang mit den Grundproblemen der gleichzeitigen Mathematik hier deutlich fühlbar wird, beruht auf dieser Tatsache, und ihre schwer aufzufindenden Grundlagen, die von Brunellesco vielfach verfehlt wurden, beweisen, daß die Geometrie sie durchaus nicht ohne weiteres hergibt, wie es nach Kants Lehre von ihrer Koinzidenz mit der Anschauung der Fall sein müßte. Die Anschauungsform ist von der Mathematik unabhängig. Aber der lebensfremde Verstand, stolz auf seine abstrakt-geometrische Intuition, sagt nein dazu und der echte Theoretiker, wie eben Kant, weiß niemals, was er wirklich gesehen hat.
Kant hat bei seiner Betrachtungsweise, einer angestrengten, auf das Ziel einer abstrakten Theorie gerichteten Beobachtung, all die Momente unwillkürlicher, halb bewußter Anschauung, welche das Leben eigentlich erst ganz erfüllen, beiseite gelassen. In ihnen ist die „Form“ nichts weniger als streng zahlenmäßig und gleichförmig und durch den kahlen Begriff des Raumes von drei Dimensionen nicht annähernd wiederzugeben. Das unmittelbar gewisse Tiefenerlebnis in der unermeßlichen Fülle[S. 238] seiner Nuancen entzieht sich jeder theoretischen Bestimmung. Die gesamte Lyrik und Musik, die gesamte ägyptische, chinesische, abendländische Malerei widersprechen laut der Hypothese einer konstanten mathematischen Struktur des erlebten und gesehenen Raumes und nur, weil kein neuerer Philosoph von Malerei das geringste verstanden hat, konnte ihnen diese Widerlegung unbekannt bleiben. Der Horizont z. B., in dem und durch den jedes Gesichtsbild allmählich in einen Flächenabschluß übergeht — denn auch die Tiefe ist geworden und also begrenzt — ist durch keine Art von Mathematik zu behandeln. Jeder Pinselstrich eines Landschaftsmalers widerlegt die Behauptungen der Erkenntnistheorie.
Die „drei Dimensionen“ besitzen als abstrakte mathematische Einheiten keine natürliche Grenze. Man verwechselt das mit Fläche und Tiefe des erlebten optischen Eindrucks und so setzt sich der eine erkenntnistheoretische Irrtum in den andern fort, daß auch die angeschaute Ausgedehntheit unbegrenzt sei, obwohl unser Blick nur belichtete Raumfragmente umfaßt, deren Grenze eben die jeweilige Lichtgrenze bildet, sollte es auch der Fixsternhimmel oder die atmosphärische Helligkeit sein. Die „gesehene Welt“ ist tatsächlich die Summe von Lichtwiderständen, weil das Sehen an das Vorhandensein von reflektiertem Licht gebunden ist. Die Griechen blieben, als plastisch angelegte Naturen, auch dabei stehen. Nur das abendländische Weltgefühl stellte als Symbol und inneres Postulat des Lebens die Idee eines grenzenlosen Weltraumes auf mit unendlichen Fixsternensystemen und Entfernungen, die weit über jede optische Vorstellbarkeit hinausgehen — eine Schöpfung des innern Blickes, die sich jeder Verwirklichung durch das Auge entzieht und Menschen anders fühlender Kulturen selbst als Idee fremd und unvollziehbar bleibt.
Das Ergebnis der Gaußschen Entdeckung, welche das Wesen der modernen Mathematik überhaupt änderte,[55] war also nicht nur der Nachweis, daß es mehrere gleich richtige Geometrien[S. 239] der dreidimensionalen Ausgedehntheit gibt, von denen der Geist eine wählt, weil er an sie glaubt, sondern der, daß „der Raum“ überhaupt nicht mehr ein einfaches Faktum ist. Es gibt mehrere Arten exakter, streng wissenschaftlicher Räumlichkeit von drei Dimensionen und die Frage, welche von ihnen der wirklichen Anschauung entspricht, beweist, daß man das Problem gar nicht versteht. Die Mathematik beschäftigt sich, gleichviel ob sie sich anschaulicher Bilder und Vorstellungen als Handhaben bedient oder nicht, mit völlig abstrakten Systemen, Formenwelten von Zahlen, und ihre Evidenz ist identisch mit der diesen Formenwelten immanenten kausalen Logik. Sie sind Abbilder der Verstandesformen und mithin in jeder Kultur von anderem Stil. Darauf beruht ihre exakte Anwendbarkeit auf die verstandesmäßig rezipierte, mechanische, tote Natur der Physik, die ihrerseits ebenfalls ein Abbild der Geistesform, nur von anderer Ordnung ist. Neben der Mehrheit variabler Anschauungsgebilde steht also auch eine Mehrheit von starr mathematischen Raumwelten, die ihre eignen Rätsel hat, und unter dem gemeinsamen Worte Raum hat sich nur allzulange die Tatsache verborgen, daß alle vermutete Konstanz und Identität ein Irrtum ist.
Damit ist die Illusion des einen, bleibenden, alle Menschen umgebenden Raumes, über den man sich begrifflich restlos verständigen könnte, zerstört, ob man ihn nun als den absoluten Weltraum Newtons ansprechen will, in dem sich alle Dinge befinden, oder als Kants unveränderliche, allen Menschen aller Zeiten gemeinsame Form der Anschauung, welche alle Dinge erst schafft. So gut jede persönliche „Welt“ im Strome des historischen Werdens ein nie vergehendes und nie sich wiederholendes Erlebnis ist, so gut ist es jeder einem lebenden Menschen angehörende Raum. Und zwar liegt alle Ausdruckskraft der einzelnen Seele, die ihre Welt gestalten will, im begreifenden Erlebnis der Tiefe oder Entfernung, durch das die sinnliche Fläche — das Chaos — erst Raum, der Raum dieser Seele wird.
Damit ist die Trennung der lebendigen Anschauung von der mathematischen Formensprache vollzogen, und das Geheimnis der Raumwerdung tut sich auf.
Wie das Werden dem Gewordenen, die ewig lebende Geschichte der vollendeten und toten Natur zugrunde liegt, das[S. 240] Organische dem Mechanischen, das Schicksal dem kausalen Gesetz, dem objektiv Gesetzten, so ist die Richtung der Ursprung der Ausdehnung. Das mit dem Worte Zeit berührte Geheimnis des sich vollendenden Lebens bildet die Grundlage dessen, was als vollendet durch das Wort Raum weniger verstanden als für ein inneres Gefühl angedeutet wird. Jede wirkliche Ausgedehntheit, wirklich, insofern sie ein vollzogenes Erlebnis repräsentiert, ist eben durch das Erlebnis der Tiefe erst vollzogen worden; und eben jene Richtung, Dehnung in die Tiefe und Ferne — für das Auge, das Gefühl, das Denken — der Schritt von der sinnlich chaotischen Fläche zum kosmisch geordneten Weltbilde mit der geheimnisvoll in ihr sich andeutenden Bewegtheit ist das, was rein werdend durch das Wort Zeit bezeichnet wird. Der Mensch fühlt sich, und das ist der Zustand des wirklichen Wachseins, in einer ihn rings umgebenden Ausgedehntheit. Man braucht diesen Ureindruck des Weltmäßigen nur zu verfolgen, um festzustellen, daß es tatsächlich nur eine wahre Dimension des Raumes gibt, die Richtung nämlich von sich aus in die Ferne und daß das abstrakte System dreier Dimensionen eine mechanische Vorstellung, keine Tatsache des Lebens ist. Das Tiefenerlebnis, die Richtung in die Ferne, dehnt die Empfindung zur Welt. Das Gerichtetsein des Lebens war mit Bedeutung als Nichtumkehrbarkeit bezeichnet worden und ein Rest dieses entscheidenden Merkmals der Zeit liegt in dem Zwang, auch die Tiefe der Welt stets von sich aus, nie vom Horizont aus zu sich hin empfinden zu können.
Wenn man, mit einiger Vorsicht, die Geistesform der Kausalität als erstarrtes Schicksal bezeichnet, so darf die Raumtiefe, die Grundlage der Weltform, als erstarrte Zeit bezeichnet werden. Denn Räume gibt es nur für lebendige Menschen. Mit der Seele ist auch die Welt zu Ende. Ich hatte nicht umsonst zwischen Erkennen und Erkanntem, dem lebendigen Akt und seinem toten Resultat unterschieden. Damit erst wird das Wesen des Raumes zugänglich.
Hätte Kant sich ein wenig schärfer gefaßt, so hätte er statt von „zwei Formen der Anschauung“ zu reden, die Zeit die Form des Anschauens, den Raum die Form des Angeschauten[S. 241] genannt, und dann wäre ihm ein Licht aufgegangen. Wie das Leben zum Tode, das Anschauen zum Angeschauten führt, so führt die schicksalhafte, gerichtete Zeit zur räumlichen Tiefe. Es liegt hier ein Mysterium vor, ein Urphänomen, das sich begrifflich nicht zerlegen läßt und das man hinzunehmen hat; aber ahnen läßt sich sein Sinn. Der Physiker, Mathematiker, Erkenntnistheoretiker kennt nur den gewordenen Raum, das Gegenbild der starren Geistesform. Hier aber ist angedeutet, wie der Raum wird. Der Raum, in all den verschiedenen Arten, in denen er sich für das einzelne Selbst verwirklicht, über die einander ganz zu verständigen eine ewige Unmöglichkeit ist, muß Zeichen und Ausdruck des Lebens selbst sein, das ursprünglichste und mächtigste seiner Symbole.
Das Gefühl davon soll vielleicht die gewagte Formel: „Der Raum ist zeitlos“ ausdrücken. Er ist geworden; er steht damit, daß er ist, ein Stück erstorbener Zeit, außerhalb des Zeitphänomens. Wir deuten — oder das Leben deutet in uns, durch uns — mit unbedingter, wahlloser Notwendigkeit jedes Moment der Tiefe. Von freiem Willen ist nicht mehr die Rede. Man denke an ein verkehrt gehängtes Bild, das als bloße Farbfläche wirkt und beim Umdrehen plötzlich ein Erlebnis der Tiefe hervorruft. In diesem Augenblick erfolgt mit schöpferischer Gewalt der Akt der Raumwerdung und dieser Augenblick, wo das gestaltlose Chaos gestaltete Wirklichkeit wird, könnte, wenn man ihn ganz verstünde, die ungeheure Einsamkeit des Menschen enthüllen, von denen jeder dieses Bild, diese erst jetzt zum Bilde gewordene Fläche, für sich besitzt. Denn hier empfindet der antike Mensch mit apriorischer Gewißheit das Körperliche, wir das unendlich Räumliche, der Inder, der Ägypter wieder andere Arten von Form als das Ideal des Ausgedehnten. Worte reichen nicht aus, um die ganze Vehemenz dieser Unterschiede zu fassen, die das Weltgefühl der einzelnen Arten höheren Menschentums für immer trennen, aber die bildenden Künste aller Kulturen, deren Substanz die Weltform ist, enthüllen sie.
Diese wahllose Deutung der Tiefe, die mit der Wucht eines elementaren Ereignisses das wache Bewußtsein beherrscht, ist[S. 242] es, welche zugleich mit dem Erwachen des Innenlebens beim einzelnen Menschen die Grenze von Kind und Knabe bezeichnet. Das Erlebnis der Tiefe ist es, welches dem Kinde fehlt, das nach dem Monde greift, das noch keine sinnvolle Außenwelt besitzt und gleich der urmenschlichen Seele in traumhafter Verbundenheit mit allem Empfindungshaften hindämmert. Nicht als ob ein Kind keine extensive Erfahrung einfachster Art hätte; aber das Weltbewußtsein ist nicht da, die große Einheit des Erlebens in einer Welt. Und dieses Bewußtsein gestaltet sich in einem hellenischen Kinde anders als in einem indischen oder abendländischen. Mit ihm gehört es einer bestimmten Kultur an, deren Glieder ein gemeinsames Weltgefühl und aus ihm eine gemeinsame Weltform besitzen. Eine tiefe Identität verknüpft beide Akte: Das Erwachen der Seele (des Innenlebens), ihre Geburt zum hellen Dasein im Namen einer Kultur, und das plötzliche Begreifen von Ferne und Tiefe, die Geburt der Außenwelt durch das Symbol der Ausgedehntheit, einer nur dieser einen Seele zugehörigen Raumart, die von nun an das Ursymbol dieses Lebens bleibt und ihm seinen Stil, die Gestalt seiner Geschichte als der fortschreitenden extensiven Verwirklichung intensiver Möglichkeiten gibt. Hier löst sich eine alte philosophische Frage in nichts auf: Angeboren ist diese Urgestalt der Welt, insofern sie ursprüngliches Eigentum des Seelentums (der Kultur) ist, dessen Ausdruck wir selbst durch die ganze Erscheinung unsres Einzeldaseins sind; erworben ist sie, insofern jede einzelne Seele jenen Schöpfungsakt für sich noch einmal wiederholt und das ihrem Dasein vorbestimmte Symbol der Tiefe in früher Kindheit, wie ein ausschlüpfender Schmetterling seine Flügel, entfaltet. Das erste Begreifen der Tiefe ist ein Geburtsakt, ein seelischer neben dem leiblichen. Mit ihm wird eine Kultur aus ihrer Mutterlandschaft geboren, denn die plötzliche Erscheinung der dorischen, arabischen, gotischen Raumsymbolik verrät das Dasein einer neuen Seele. Es entspricht dies im tiefsten dem griechischen Mythus der Gaia und dem dunklen Gefühl früher Völker, wenn sie ihre Toten in Hockergräbern (in Form des Embryo) der Mutter Erde zurückerstatten. Diese Geburt der ganzen Kultur wird innerhalb ihres Kreises von jeder einzelnen[S. 243] Seele wiederholt. Dies nannte Plato, der an einen hellenischen Urglauben anknüpfte, die Anamnesis. Die unbedingte Bestimmtheit der Weltform, die im Seelischen plötzlich da ist, wird aus dem Werden gedeutet, während Kant, der Systematiker, mit seinem Begriff der apriorischen Form bei der Deutung desselben Phänomens vom toten Resultat, nicht vom lebendigen Akt ausgeht.
Die Art der Ausgedehntheit soll von nun an das Ursymbol einer Kultur genannt werden. Die gesamte Formensprache ihrer Wirklichkeit, ihre Physiognomie im Unterschiede von der jeder andern Kultur und vor allem von der physiognomielosen Umwelt des primitiven Menschen ist aus ihr abzuleiten. Wie es eine Welt nur in bezug auf eine Seele gibt, als deren Abbild und Gegenpol im Bewußtsein, wie das Erwachen des Innenlebens mit einer spontanen und notwendigen Tiefendeutung von ganz bestimmtem Typus zusammenfällt, so gibt es Etwas, das als Formideal jedem einzelnen Symbol einer Kultur zugrunde liegt.
Aber das Ursymbol selbst ist nicht realisierbar, auch nicht in Definitionen. Es ist im Formgefühl jedes Menschen und jeder Zeit wirksam und diktiert ihnen den Stil sämtlicher Lebensäußerungen. Es liegt in der Staatsform, in den religiösen Dogmen und Kulten, den Formen der Malerei, Musik und Plastik, dem Vers, den Grundbegriffen der Physik und Ethik, aber es wird nicht durch sie dargestellt. Folglich ist es auch durch Worte nicht exakt darstellbar, denn Sprache und Erkenntnisformen sind selbst abgeleitete Symbole. Goethe und Plato haben es — wiewohl nicht genau in diesem Sinne — „die Idee“ genannt, die im Wirklichen unmittelbar angeschaut, aber als eine ewige und unerreichbare Möglichkeit niemals erkannt wird. Kant und Aristoteles haben es, mit einem für den Systematiker beinahe notwendigen Irrtum, im Erkenntnisakt begrifflich isolieren wollen.
Wenn das Ursymbol der antiken Seele, der antiken Welt fortan als der stoffliche Einzelkörper, das der abendländischen als der reine, unendliche Raum bezeichnet wird, so darf nie übersehen werden, daß Begriffe das nie zu Begreifende nicht darstellen, daß sie nur ein Gefühl des Verstehens wecken können.[S. 244] Auch die mathematische Zahl, an welcher der Unterschied in der Formensprache der einzelnen Kulturen zuerst festgestellt wurde und aus der Kant die Qualität der Tiefendeutung abzuleiten suchte, ist nicht das Ursymbol selbst. Die Zahl als das Grenzprinzip der Ausdehnung setzt das Tiefenerlebnis schon voraus und wenn das klassische Grenzproblem der Antike die Quadratur des Kreises, d. h. die Rückführung krummlinig begrenzter Flächen auf meßbare Größen, das klassische Problem unsrer Mathematik aber die Definition des Grenzwertes in der Infinitesimalrechnung ist, so verrät sich darin der Unterschied zweier Ursymbole mit voller Deutlichkeit, aber keines von beiden ist das unmittelbare Objekt dieser Probleme.
Der reine grenzenlose Raum ist das Ideal, welches die abendländische Seele immer wieder in ihrer Umwelt gesucht hat. Sie wollte es in ihr unmittelbar verwirklicht sehen und dies erst gibt den unzähligen Raumtheorien der letzten Jahrhunderte ihre tiefe Bedeutung als Symptomen eines Weltgefühls, jenseits aller vermeintlichen Resultate. Ihre gemeinsame Tendenz läßt sich so ausdrücken: Es gibt Etwas, das notwendig gestaltend den Welterlebnissen jedes Einzelnen zugrunde liegt. Alle haben, Kant mehr oder weniger ähnlich, dieses begrifflich überhaupt unbestimmbare, sicherlich höchst variable Etwas dem mathematischen Raumbegriff genau zugeordnet und ohne weiteres vorausgesetzt, daß eine These dieser Art für alle Menschen gültig sei. Was bedeutet das Pathos dieser Behauptung? Kaum ein andres Problem ist so ernsthaft durchdacht worden, und fast hätte man glauben sollen, es hinge jede andre Weltfrage von dieser einen nach dem Wesen des Raumes ab. Und ist es nicht in der Tat so? Warum hat denn niemand bemerkt, daß die gesamte Antike kein Wort darüber verlor, ja daß sie nicht einmal das Wort besaß, um das Problem genau umschreiben zu können? Warum schwiegen die großen Vorsokratiker? Übersahen sie etwa in ihrer Welt gerade das, was uns als das Rätsel aller Rätsel erscheint? Hätten wir nicht längst einsehen sollen, daß in diesem Schweigen gerade die Lösung lag? Wie kommt es, daß unserm tiefsten Gefühl nach „die Welt“ nichts anderes ist als jener durch das Tiefenerlebnis ganz eigentlich geborne Weltraum, dessen reine, erhabene Leere durch die in ihm verlornen[S. 245] Fixsternsysteme nur bestätigt wird. Hätte man dies Gefühl einer Welt einem Athener, Plato etwa, begreiflich machen können? Und hätte die griechische Sprache, in deren Grammatik und Wortschatz sich doch das antike Tiefenerlebnis ganz unverkennbar spiegelt, dies erlaubt? Man entdeckt plötzlich, daß dies „ewige Problem“, das Kant im Namen der Menschheit mit der Leidenschaft eines symbolischen Aktes behandelte, ein rein abendländisches ist und im Geiste der andern Kulturen gar nicht existiert.
Was war es denn, was dem antiken Menschen, dessen Blick in seine Umwelt sicher ebenso klar war, als das Urproblem des gesamten Seins erschien? Das der ἀρχή, des stofflichen Ursprungs der sinnlich-greifbaren Dinge. Begreift man dies, so wird man dem Sinn der Tatsache nahe kommen — nicht des Raumes, sondern der Frage, weshalb das Raumproblem mit schicksalhafter Notwendigkeit das der abendländischen Seele und dieser allein werden mußte. Die Zahlenwelten, wie sie sich innerhalb beider Kulturen entfaltet haben, machen dies völlig deutlich. Die antike Seele gestaltete das Gewordene zu einer geordneten Welt sinnlich meßbarer Größen. Das liegt, bisher unerkannt, in dem berühmten Parallelenaxiom Euklids,[56] dem einzigen der antiken mathematischen Sätze, der unbewiesen blieb und der, wie wir heute wissen, unbeweisbar ist. Gerade das aber macht ihn zum Dogma gegenüber aller apriorischen Erfahrung und damit zum metaphysischen Mittelpunkt, zum Träger jenes geometrischen Systems. Alles andre, Axiome wie Postulate, ist nur Vorbereitung oder Folge. Dieser einzige Satz ist für den antiken Geist notwendig und allgemein gültig — und doch nicht ableitbar. Was bedeutet das?
Daß er ein Symbol ersten Ranges ist. Er repräsentiert das So-Sein, die vorbestimmte Struktur der antiken Außenwelt, das Ideal ihrer Ausgedehntheit. Gerade dies theoretisch schwächste — notwendig schwächste — Glied der platonischen Geometrie, gegen das sich schon in hellenistischer Zeit Widerspruch erhob, offenbart ihre Seele, und gerade dies der populären Erfahrung selbstverständliche Element war es, an das sich[S. 246] der Widerspruch des abendländischen Zahlendenkens knüpfte. Es gehört zu den tiefsten Symptomen unsres Daseins, daß wir aus unsrem Zahlengefühl heraus der euklidischen Geometrie nicht etwa eine, sondern eine Mehrzahl von andern gegenüberstellen, die für uns — nicht für die Erkenntnisweise antiker Menschen — gleich wahr, gleich widerspruchslos sind. Die eigentliche Tendenz und Symbolik dieser als antieuklidische Gruppe aufzufassender Geometrien[57] liegt darin, daß sie das körperlich-greifbare Moment in aller Ausgedehntheit, das Euklid durch seine Sätze heilig sprach, verleugneten, daß sie unabhängig vom Sinnlichen und unter Überschreitung der Grenze des Sehvermögens ein neues Ideal schufen, das einer höheren Räumlichkeit, die über eine populär-anschauliche Evidenz erhaben ist, die mithin auch nicht eine einzige, punktuelle Lösung kennt. Die Frage, welche der drei nichteuklidischen Geometrien die „richtige“, in der äußeren Wirklichkeit vorhandene sei — obwohl selbst von Gauß ernsthaft geprüft — ist dem Weltgefühl nach antik, hätte also von einem Denker unserer Sphäre nicht gestellt werden sollen. Sie verschließt den Einblick in den wahren Tiefsinn dieses geistigen Phänomens: Nicht in der Realität der einen oder andern, sondern in der Vielheit gleichmäßig möglicher Geometrien liegt das spezifisch abendländische Symbol. Erst durch die Gruppe dieser dreidimensionalen Raumstrukturen, die eine echte Unendlichkeit des Möglichen darstellt und in deren Fülle die antike Nuance lediglich eine punktförmige Möglichkeit, einen bloßen Grenzfall bildet, wird der Rest des Plastisch-Sinnlichen im reinen Raumgefühl aufgelöst. Dem abstrakten Raum eine Struktur zuzusprechen — noch dazu die aus dem optischen Bilde gewohnheitsmäßig erschlossene — verrät immer noch eine statuenhafte, nicht kontrapunktische Tendenz; nur die variable Vielheit einander ausschließender Räume, von denen keiner gewählt werden darf, in ihrer seltsam transzendenten Totalität leistet uns Genüge. Die neueste geometrische Spekulation ist jenseits dieser Gruppe zu einer großen Anzahl weiterer, höchst transzendenter, zum Teil auch nicht entfernt mehr optisch zugänglicher Geometrien gelangt, die sämtlich in sich widerspruchslos[S. 247] sind und deren „Menge“ — im Sinne der Mengenlehre — eine „Zahl“ bedeutet, die nun allerdings ein sehr schwer zu fassendes Symbol des abendländischen Weltgefühls darstellt.
Hier drückt das Formbewußtsein der abendländischen Mathematik dasselbe aus, was die Erkenntnistheorie Kants durch die Überzeugung, der Raum liege a priori der Existenz der Dinge zugrunde, eigentlich hatte sagen wollen, eine Überzeugung, die den Resultaten der arabischen und indischen Erkenntnistheorie aufs schärfste widerspricht — daß nämlich „der Raum“ der Schöpfer und alles Stofflich-Gegenwärtige sein Geschöpf sei. Und gerade diese allmächtige Räumlichkeit, welche die Substanz aller Dinge in sich saugt, aus sich erzeugt, unser Eigentlichstes und Höchstes im Aspekt unseres Weltalls — wird von der antiken Menschheit, die nicht einmal das Wort und also den Begriff Raum kennt,[58] einstimmig als τὸ μὴ ὄν abgetan, als das, was nicht da ist. Man kann das Pathos dieser Negation gar nicht tief genug fassen. Die ganze Leidenschaft der antiken Seele grenzte durch sie symbolisch ab, was sie nicht als wirklich empfand, was nicht Ausdruck ihres Daseins sein durfte. Eine Welt von andrer Farbe liegt plötzlich vor unsern Augen da. Die attische Marmorstatue repräsentiert in ihrer sinnlichen Existenz für das antike Auge alles ohne Rest, was Wirklichkeit hieß. Das Stoffliche, sichtbar Begrenzte, Greifbare, unmittelbar Gegenwärtige — damit sind die Merkmale dieser Art von Gewordnem erschöpft. Dies antike Weltall, der Kosmos, die wohlgeordnete Menge aller nahen und vollkommen übersehbaren Dinge ist durch die körperliche Himmelskugel abgeschlossen. Es gibt nicht mehr. Unser Bedürfnis, jenseits dieser Schale wieder „Raum“ zu denken, fehlte dem antiken Weltgefühl vollständig. Τὸ μὴ ὄν — das ist der schärfste Widerspruch[S. 248] gegen das abendländische Gefühl, das eben diesen reinen, notwendig als grenzenlos empfundenen „absoluten“ Raum fordert, ihn als das Wirkliche, das eigentlich und einzig Seiende anerkennt und gerade die antike, plastische, absolute Stofflichkeit der Objekte anzweifelt. „Stoff“ ist derjenige Empfindungswert, von dem der abendländische Geist auf jedem Wege, philosophisch, physikalisch, religiös loskommen will. Unser Göttliches ist der ewige Raum, wie das von Dante bis Kant und Goethe jeder großen Denkweise zugrunde liegt. Die Dinge sind Erscheinung, nicht mehr, vom Raume bedingt, fragwürdig — τὸ μὴ ὄν. Man überzeuge sich, wie im Pantheismus des 18. Jahrhunderts Gott und der unendliche Raum für das Gefühl schlechthin identisch geworden sind. Die faustische Allgegenwart Gottes, die von den Kreuzzügen an mit steigender Klarheit das Weltbild beherrscht, und die Lehre, daß der Raum die erzeugende Form der objektiven Erscheinung sei, führen auf dasselbe innere Erlebnis zurück. Wenn man nach einem Substanzbegriff sucht, der dem antiken diametral entgegengesetzt ist, so trifft man mit Notwendigkeit den der abendländischen Physik. Die Masse wird von ihr als das konstante Verhältnis von Kraft und Beschleunigung definiert. Kann man „unstofflicher“ denken? Den antiken Begriffen Stoff und Form als den optischen Prinzipien körperhaften Daseins haben wir die vollkommen unanschaulichen der Kapazität und Intensität gegenübergestellt, in denen die Energie des reinen Raumes formal zum Ausdruck kommt. Aus dieser Art, Wirklichkeit aufzufassen, mußte als herrschende Kunst die Instrumentalmusik der großen Meister des 18. Jahrhunderts hervorgehen, die einzige von allen Künsten, deren Formenwelt der Intuition des reinen Raumes innerlich verwandt ist. In ihr gibt es, den Bildsäulen antiker Tempelbezirke und Marktplätze gegenüber körperlose Reiche von Tönen, Tonräume, Tonmeere; das Orchester brandet, schlägt Wellen, verebbt; es malt Fernen, Lichter, Schatten, Stürme, ziehende Wolken, Blitze, Farben von vollkommener Jenseitigkeit; man denke an die Landschaften der Instrumentation Glucks und Beethovens. „Gleichzeitig“ mit dem Kanon Polyklets, jener Schrift, in welcher der große Bildhauer die strengen Regeln der optischen Gliederung menschlicher Körper niederlegte, die bis auf Lysipp herab[S. 249] herrschend blieben, vollendete sich um 1740 der strenge Kanon des vierteiligen Sonatensatzes, der erst in Beethovens späten Quartetten und Sinfonien sich lockert, bis endlich in der einsamen, vollkommen „infinitesimalen“ Tonwelt der Tristanmusik alle irdische Greifbarkeit sich löst. Dies Urgefühl einer Lösung, Erlösung, Auflösung der Seele im Unendlichen, einer Befreiung von aller stofflichen Schwere, das die höchsten Momente unsrer Musik stets wachrufen, während die Wirkung antiker Kunstwerke bindend, einschränkend, das Körpergefühl festigend ist, wie man in der Poetik des Aristoteles zwischen den Zeilen liest — dies Gefühl ist es, das von der Erkenntnistheorie in die trockene Formel vom Raum als der apriorischen Bedingung der sinnlichen Erscheinung gekleidet wurde.
Für den antiken Geist gab es nur ein „zwischen“ den Dingen, dem der Wirklichkeitsakzent des Wortes Raum fehlt. Erst die neuere Geometrie (Hilbert, Peano) hat den metaphysischen Gehalt dieses „zwischen“ bemerkenswert gefunden. Von Archimedes, für den es nur Körper und deren wechselseitige Abstände gab, hätten wir die verwunderte Frage erlebt, wie ein leidlich vernünftiger Mensch zu einer solchen Inkarnation des Nichts, wie sie die Annahme eines reinen, die zufälligen Dinge durchdringenden und hinsichtlich ihrer Realität entwertenden Raumes doch darstellt, gelangen könne.
So hat es jede der großen Kulturen zu einer geheimen Sprache des Weltgefühls gebracht, die nur dem ganz vernehmlich ist, dessen Seele dieser Kultur angehört. Denn täuschen wir uns nicht. Wir können vielleicht, zufällig, in der antiken Seele ein wenig lesen, deren Formensprache annähernd die Umkehrung der abendländischen ist; von der sehr schwierigen Frage, in welchem Grade das möglich und erreicht worden ist, hat jede Kritik der Renaissance auszugehen. Aber wenn wir hören, daß wahrscheinlich — das Umdenken so heterogener Daseinsäußerungen bleibt unter allen Umständen ein höchst zweifelhafter Versuch — die alten Inder Zahlen konzipiert hatten, die nach unsren Begriffen, weder Wert noch Größe noch[S. 250] Beziehungsqualität besaßen, die erst durch ihre Stellung, durch gewisse Affixe, zu positiven, negativen, großen, kleinen Einheiten wurden, so müssen wir zugeben, daß unserem Denken die Möglichkeit fehlt, das exakt nachzuerleben, was seelisch diesem Zahlenphänomen zugrunde liegt. 3 ist für uns immer Etwas, sei es positiv oder negativ; für die Griechen war es unbedingt eine Größe, +3; für die Inder bezeichnet es eine wesenlose Möglichkeit, für die das Wort „etwas“ noch nicht gilt, jenseits von Sein und Nichtsein, die beide erst akzidentielle Eigenschaften sind. +3, −3, ⅓ sind emanierende Wirklichkeiten geringeren Grades, die in der rätselhaften Substanz (3) in einer uns völlig verschlossenen Art ruhen. Es gehört eine bramanische Seele dazu, diese Zahlen als selbstverständlich, als ideale Repräsentanten einer in sich vollkommenen Weltform zu empfinden; uns sind sie so unverständlich wie das Nirwana des Yogasystems, das jenseits von Leben und Tod, Schlaf und Bewußtsein, Leiden, Mitleiden und Leidlosigkeit dennoch etwas Wirkliches ist, für das uns selbst die sprachlichen Möglichkeiten fehlen. Nur aus diesem Seelentum konnte die großartige Konzeption des Nichts als einer echten Zahl, der Null, hervorgehen, und zwar als indische Null, für die wesenhaft und wesenlos gleich äußerliche Bezeichnungen sind. Diese Null, die vielleicht eine Ahnung von der indischen Idee des Ausgedehnten, von jener in den Upanishaden behandelten, unserem Raumbewußtsein völlig fremden Räumlichkeit der Welt gibt, fehlte selbstverständlich der Antike. Sie wurde auf dem Wege über die arabische Mathematik, gänzlich umgedeutet, erst 1544 durch Stifel bei uns eingeführt, und zwar, was ihr Wesen prinzipiell veränderte, als die Mitte zwischen +1 und −1, als Schnitt im linearen Zahlenkontinuum, das heißt, sie wurde in einem gänzlich unindischen Sinne von der abendländischen Zahlenwelt assimiliert.
Wenn arabische Denker der reifsten Zeit — und es waren Köpfe ersten Ranges wie Alfarabi und Al Kabi darunter — in ihrer Polemik gegen die Seinslehre des Aristoteles bewiesen — bewiesen —, daß der Körper als solcher den Raum zur Existenz nicht notwendig voraussetze, und das Wesen dieses Raumes, der arabischen Art der Ausgedehntheit also, aus[S. 251] dem Merkmal des „an einer Stelle sich Befindens“ herleiten, so beweist das nicht, daß sie gegen Aristoteles und Kant im Irrtum waren oder — wie wir das gern bezeichnen, was nicht in unsre Köpfe eingeht — daß sie unklar dachten, sondern daß der arabische Geist andere Weltkategorien besaß. Sie hätten Kant aus ihrer Begriffssprache heraus mit derselben Feinheit der Beweisführung widerlegen können, wie Kant sie, und beide wären von der Richtigkeit ihrer Aspekte überzeugt geblieben.
Wenn wir, Menschen der abendländischen Geistessphäre, vom Raume reden, so denken wir sicherlich in annähernd demselben Stil, so wie wir uns derselben Sprache und Wortzeichen bedienen, mag es sich um den Raum der Mathematik, Physik, Malerei oder der „Wirklichkeit“ handeln, obgleich alles Philosophieren, das an Stelle dieser Verwandtschaft eine Identität des Empfindens statuieren will (und muß), etwas höchst Fragwürdiges bleibt. Aber kein Hellene, kein Ägypter, kein Chinese hätte etwas davon unverändert nachgefühlt und kein Kunstwerk oder Gedankensystem hätte ihnen zeigen können, was „Raum“ für uns bedeutet. Die antiken Urbegriffe, aus einem anders gearteten Innenleben stammend, wie ἀρχή, ὕλη, μορφή, erschöpfen den Gehalt einer anders angelegten Welt, die uns fremd und fern bleibt. Was wir mit unseren eigenen Sprachmitteln als Ursprung, Stoff, Form aus dem Griechischen übersetzen, ist eine flache Anähnlichung, ein matter Versuch, in eine Gefühlssphäre einzudringen, die in ihrem Feinsten und Tiefsten doch stumm bleibt; es ist, als wollte man die Parthenonskulpturen für Streichmusik „setzen“ oder den Gott Voltaires in Bronze gießen. Die Kategorien des Denkens, Lebens, Weltbewußtseins sind so verschieden wie die Gesichtszüge der einzelnen Menschen; auch in bezug darauf gibt es „Rassen“ und „Völker“, Gemeinschaften durch den Besitz einer geistigen Form oder Idee; und sie wissen so wenig darum wie sie wissen, was „rot“ oder „gelb“ für den andern ist; die gemeinsame Symbolik vor allem der Sprache nährt die Illusion eines identischen Innenlebens und einer identischen Weltform. Die großen Denker der einzelnen Kulturen sind hierin den Farbenblinden ähnlich, die ihren Zustand nicht kennen und von denen einer über die Irrtümer des andern lächelt.
[S. 252]
Und nun ziehe ich die Folgerung. Es gibt eine Vielzahl von Ursymbolen. Das Tiefenerlebnis, durch das die Welt wird, durch das die Empfindung sich zur Welt dehnt, bedeutsam für die Seele, der es angehört, und für sie allein, anders im Wachen, Träumen, Hinnehmen und Beobachten, anders bei Kind und Greis, Städter und Bauer, Mann und Weib, verwirklicht und zwar mit tiefster Notwendigkeit für jede hohe Kultur eine Möglichkeit der Form, auf der ihr gesamtes Dasein beruht. Alle Begriffe formaler Einheiten wie Masse, Substanz, Materie, Ding, Körper, Ausdehnung und die Tausende in den Sprachen andrer Kulturen aufbewahrten Wortzeichen entsprechender Art sind unbewußte, vom Schicksal bestimmte Akzente, welche aus der unendlichen Fülle von Weltmöglichkeiten im Namen der einzelnen Kultur die bezeichnenden herausheben. Keines ist in die Erkenntnisweise einer andern Kultur genau übertragbar. Keines dieser Urworte kehrt zweimal wieder. Was für uns Gegensatz ist, wie etwa das mit den Worten Raum und Materie Bezeichnete, kann für einen andern Geist identisch sein. Die Wahl des Ursymbols in jenem Augenblick, wo die Seele einer Kultur in ihrer Landschaft zum Selbstbewußtsein erwacht, die für jeden, der die Weltgeschichte so zu betrachten vermag, etwas Erschütterndes hat, entscheidet alles. Hier erhebt sich das dürftige Raumproblem der kritischen Philosophie zur Idee des Makrokosmus, in welchem alles Gewordene für eine einzelne Art Mensch im Unterschied von jeder andern zu einer Einheit der Form, der Bedeutung verknüpft ist.
Menschliche Kultur als Inbegriff des sinnlich-gewordenen Ausdrucks der Seele, als ihr Leib, sterblich, vergänglich, dem Gesetz, der Zahl und der Kausalität verfallen; Kultur als historisches Phänomen, als Bild im Weltbilde der Geschichte, als Gleichnis und Gesamtheit von Symbolen: das ist die Sprache, durch welche allein eine Seele sagen kann, was sie leidet.
Überall ist lebendigstes Seelentum, das in ewiger Verwirklichung begriffen ist, das ursprüngliche. Aber es bleibt unfaßlich und ungreifbar. Alle Intuition, welcher Art sie auch sei, trifft nur auf Abbildungen und Symbole, die das Letzte und Tiefste noch dichter verhüllen, indem sie von ihm reden. Das Ewig-Seelische wird uns immer verschlossen bleiben; hier ist[S. 253] eine nie zu überschreitende Grenze gesetzt. Auf dem Wege der Deutung des Makrokosmos erreichen wir nicht die hypothetische Urseele, sondern lediglich die Gestalt einzelner Seelen. Das Urphänomen bleibt singulär. Kulturen sind die letzte uns erreichbare Wirklichkeit. Mag man sie Erscheinungen nennen: es gibt für uns nichts Wirklicheres. „Die Welt“ als absolutum, als Ding an sich ist ein Vorurteil. Wir gewinnen auf dem Wege der Morphologie nur Eindrücke von einzelnen Welten, dem Ausdruck einzelner Seelen; der Glaube, den heute noch der Physiker und Philosoph mit der Menge teilt, daß seine Welt die Welt sei, wird uns bald an den Glauben des Wilden erinnern, daß alle Götter schwarz seien.
Auch der Makrokosmos ist Eigentum einer einzelnen Seele, und wir werden nie wissen, wie es um den der andern steht. Was — über alle Möglichkeiten begrifflicher Erklärung hinausgreifend — „der Raum“, diese schöpferische Deutung des Tiefenerlebnisses durch uns Menschen des Abendlandes und uns allein sagen will, dies rätselhafte Symbol, das die Griechen das Nichts nannten und wir das All, taucht unsre Welt in eine Farbe, welche die antike, die indische, die ägyptische Seele nicht auf ihrer Palette hatten. Die eine Seele spielt das Welterlebnis in As-Dur, die andere in F-Moll; die eine empfindet es euklidisch, die andre kontrapunktisch, die dritte magisch. Vom reinsten analytischen Raume und vom Nirwana bis zur leibhaftigsten attischen Körperlichkeit führt eine Fülle an sinnlichem Gehalt steigender Seinssymbole, deren jedes fähig ist, eine vollkommene Weltform aus sich zu bilden. So fern, seltsam, flüchtig die indische oder babylonische Welt ihrer Struktur nach für die Menschen der fünf oder sechs ihnen folgenden Kulturen war, so unbegreiflich wird bald die abendländische Welt für die Menschen noch ungeborner Kulturen sein.
[52] Dasselbe drückt auch das Prinzip der abendländischen Zahl aus: Ist x eine Funktion von y, so ist y eine Funktion von x.
[53] Gewiß läßt sich ein geometrischer Lehrsatz an einer Zeichnung beweisen, richtiger demonstrieren. Aber der Lehrsatz erhält in jeder Art von Geometrie eine andre Fassung und hier entscheidet die Zeichnung nichts mehr.
[54] Die Zeit bleibt hier ganz aus dem Spiele. Übrigens erweist sich gerade in der Astronomie die Anwendung nichteuklidischer Geometrien zuweilen als vorteilhaft.
[55] Bekanntlich hat Gauß über seine Entdeckung bis fast an sein Lebensende geschwiegen, weil er „das Geschrei der Böoter“ fürchtete.
[56] Durch einen Punkt ist zu einer Geraden nur eine Parallele möglich.
[57] In denen es durch einen Punkt zu einer Geraden keine, zwei oder unzählige Parallelen gibt.
[58] Weder im Griechischen noch im Latein; τόπος (= locus) heißt Ort, Gegend, auch Stand in sozialem Sinne, χώρα (= spatium) Abstand („zwischen“), Distanz, Rang, auch Grund und Boden (τὰ ἑκ τῆς χώρας die Feldfrüchte); τὸ κενόν (= vacuum) bezeichnet ganz unzweideutig einen hohlen Körper, wobei der Akzent auf der Umschließung liegt. In der späten Literatur bedient man sich hilfloser Ausdrücke wie ὁρατὸς τόπος („Sinnenwelt“) oder spatium inane „unendlicher Raum“, aber auch weite Fläche; die Wurzel des Wortes spatium (bedeutet schwellen, fettwerden). In der frühen Literatur lag das Bedürfnis einer Umschreibung nicht vor, weil die Vorstellung völlig fehlte.
[S. 254]
Ich will von nun an die Seele der antiken Kultur, welche den sinnlich-gegenwärtigen Einzelkörper zum Idealtypus des Ausgedehnten wählte, die apollinische nennen. Seit Nietzsche ist diese Bezeichnung jedem verständlich. Ihr gegenüber stelle ich die faustische Seele, deren Ursymbol der reine grenzenlose Raum und deren „Leib“ die abendländische Kultur ist, wie sie mit der Geburt des romanischen Stils im 10. Jahrhundert in den nordischen Ebenen zwischen Elbe und Tajo aufblühte. Apollinisch ist die Bildsäule des nackten Menschen, faustisch die Kunst der Fuge. Apollinisch sind die mechanische Statik, die sinnlichen Kulte der olympischen Götter, die politisch vereinzelten Griechenstädte, das Verhängnis des Ödipus und das Symbol des Phallus, faustisch die Dynamik Galileis, die katholisch-protestantische Dogmatik, die großen Dynastien der Barockzeit mit ihrer Kabinettspolitik, das Schicksal Lears und das Ideal der Madonna von Dantes Beatrice bis zum Schlusse des zweiten Faust. Apollinisch ist die Malerei, welche einzelne Körper durch scharfe Linien, Konturen begrenzt; faustisch ist die, welche durch Licht und Schatten Räume imaginiert. So unterscheidet sich das Fresko Polygnots vom Ölgemälde Rembrandts. Apollinisch ist das Dasein des Griechen, der sein Ich als σῶμα bezeichnet und vom ὄνομα σώματος als dem Namen einer Persönlichkeit spricht, dem die Idee einer innern Entwicklung und damit eine wirkliche innere oder äußere Geschichte fehlt; es ist die euklidische, punktförmige, der Reflexion gänzlich fremde Existenz; faustisch ist ein Dasein, das mit tiefster Bewußtheit als Innenleben geführt wird, das sich selbst zusieht, eine eminent persönliche Kultur der Memoiren, Reflexionen, der Rück-[S. 255] und Ausblicke und des Gewissens. Stereometrie und Analysis, Sklavenmassen und Dynamomaschinen, stoische Ataraxie und sozialer Wille zur Macht, Hexameter und gereimte Verse: das sind Seinssymbole zweier grundverschiedener Welten. Und fernab, obwohl vermittelnd, Formen entlehnend, umdeutend, vererbend, erscheint die magische Seele der arabischen Kultur, zur Zeit des Augustus in der Landschaft zwischen Euphrat und Nil erwachend, mit ihrer Algebra und Alchymie, ihren Mosaiken und Arabesken, ihren Khalifaten und Moscheen, ihren sakralen Riten und ihrem „Kismet“.
Der Raum ist, ich darf jetzt sagen im faustischen Sprachgebrauche, ein von der augenblicklichen sinnlichen Gegenwart streng gesondertes Abstraktum, das in einer apollinischen Sprache, im Griechischen und Lateinischen nicht vertreten sein durfte. Ebenso fremd ist der Raum den apollinischen Künsten. Das antike Relief — man denke an die Metopen und Giebel des Parthenon — ist streng stereometrisch einer Fläche aufgesetzt. Es gibt ein „zwischen“ den Figuren, aber keine Tiefe. Eine Landschaft von Lorrain dagegen ist nur Raum. Alle Einzelheiten sollen hier seiner Verwirklichung dienen. Alle Körper besitzen nur als Träger von Licht und Schatten eine atmosphärische, perspektivische Bedeutung. Der Impressionismus ist die Entkörperung der Welt im Dienste des Raumes. Die faustische Seele mußte aus diesem Weltgefühl in ihrer Frühzeit zu einem Architekturproblem gelangen, dessen Schwergewicht in der räumlichen Wölbung mächtiger, vom Portal zur Tiefe des Chors strebender Dome lag. Das war der Ausdruck ihres Tiefenerlebnisses. Die antike — körperhafte — Architektur ist demgegenüber ganz eigentlich mit dem Typus des mit einem Blicke zu umfassenden Peripteros und der eminent stofflichen Tatsache der „drei Säulenordnungen“ erschöpft. Wir werden überall dasselbe finden. Wo auch in Kunst, Religion, Politik, Denken, Handeln beide Seelen nach einem Ausdruck suchen, liegt der erreichten Formensprache jedesmal das Ursymbol, dort der greifbare Einzelkörper, hier der eine unendliche Raum als gestaltendes Prinzip zugrunde.
Die antike Kultur beginnt darum mit einem großartigen Verzicht auf eine schon vorhandene reiche, malerische, höchst komplizierte Kunst, die nicht der Ausdruck ihrer neuen Seele[S. 256] sein durfte. Herb und eng, für unser Auge dürftig und ein Rückschritt, steht die frühdorische Kunst des geometrischen Stils seit 1100 neben der kretisch-mykenischen. Das homerische Epos beweist es. In ihm stammt der Achilleusschild mit seiner Bilderfülle, mykenische Arbeit, von „den Göttern“;[59] den Panzer Agamemnons, streng und einfach, haben Menschen geschmiedet. Der Hang zum Unendlichen schlummerte tief in der nordischen Landschaft, lange bevor der erste Christ sie betrat; und als die faustische Seele erwachte, schuf sie altgermanisches Heidentum und morgenländisches Christentum gleichmäßig im Sinne ihres Ursymbols um, gerade damals, als aus den flüchtigen Völkergebilden der Goten, Franken, Langobarden, Sachsen die physiognomisch streng charakterisierten Einheiten der deutschen, französischen, englischen, italienischen Nation hervorgingen. Die Edda hat diesen frühesten religiösen Ausdruck faustischen Seelentums aufbewahrt. Sie wurde gerade damals innerlich vollendet, als der Abt Odilo von Cluny die Bewegung einleitete, welche das magische, orientalisch-arabische Christentum in das faustische der abendländischen Kirche umwandelte. Um das Jahr 1000 waren zwei Möglichkeiten einer faustischen Religion gegeben, entweder durch Annahme und Umdeutung des magischen Christentums der Kirchenväter oder durch Ausgestaltung der germanischen Formen. Die Edda beweist, was auch noch möglich gewesen wäre. Walhall ist unter dem Eindruck der Klassiker und der Apokalypse entstanden, sicher erst nach Karl dem Großen. Frigga ist Maria, Sigurd ist der Heliand. Die Verse der Edda imaginieren den Weltraum. Gewaltiger ist die Durchbrechung alles Körperlich-Einschränkenden in keiner Poesie ausgedrückt worden. Das antike äolisch-dorische Epos repräsentiert die unbedingte Bejahung und Hingabe an die sinnliche Welt der zahllosen einzelnen Dinge. Der unendliche Raum, der durch sein transzendentes Pathos eine Überwindung eben dieser naiven Welt forderte, der dem Auge nicht gegeben ist, sondern erkämpft werden muß, schuf sich eine hohe Poesie der Kraft, des unbändigen Willens, der Leidenschaft, Widerstände zu bekämpfen und zu brechen. Sigurd ist[S. 257] die Inkarnation des Sieges dieser Seele über die Schranken von Stoff und Gegenwart. Es gab nie einen Rhythmus, der so ungeheure Räume und Fernen um sich breitet wie dieser nordische:
Die Akzente des homerischen Verses sind das leise Zittern eines Blattes in der Mittagssonne, Rhythmus der Materie: der Stabreim — wie die potentielle Energie im Weltbilde der modernen Physik — schafft eine verhaltene Spannung im Leeren, Grenzenlosen, ferne Gewitter in Nächten über den höchsten Gipfeln. In seiner wogenden Unbestimmtheit lösen sich alle Worte und Dinge; das ist sprachliche Dynamik, nicht Statik. Hier kündigen sich die Farben Rembrandts und die Instrumentation Beethovens an. Hier wird die grenzenlose Einsamkeit als die Heimat der faustischen Seele empfunden. Was ist Walhall? Es wurde, den Germanen der Völkerwanderung und selbst der Merowingerzeit unbekannt, von der erwachenden faustischen Seele erdacht, sicherlich unter den Eindrücken des antik-heidnischen und des arabisch-christlichen Mythus der beiden älteren südlichen Kulturen, die mit ihren klassischen oder heiligen Schriften, ihren Statuen, Mosaiken, Miniaturen, ihren Kulten, Riten und Dogmen überall wirksam waren. Und trotzdem schwebt Walhall jenseits aller fühlbaren Wirklichkeiten, in fernen, dunklen, faustischen Regionen. Der Olymp ruht auf der wirklichen griechischen Erde; das Paradies der Kirchenväter wie des Koran ist ein Zaubergarten irgendwo im magischen Weltall. Walhall ist nirgends. Es erscheint, im Grenzenlosen verloren, mit seinen ungeselligen Göttern und Recken, als das ungeheure Symbol der Einsamkeit. Siegfried, Parzeval, Tristan, Hamlet, Faust sind die einsamsten Helden aller Kulturen. Das gehört zur abendländischen Seele. Man lese in Wolframs Parzeval die wundervolle Erzählung vom Erwachen des Innenlebens. Die Waldsehnsucht, das rätselhafte Mitleid, die unnennbare Verlassenheit: das ist faustisch. Jeder kennt es. In Goethes Faust kehrt das Motiv in seiner ganzen Tiefe wieder:
[S. 258]
Von diesem Welterlebnis weiß der apollinische und der magische Mensch nichts, weder Homer noch St. Johannes. Der Höhepunkt der Dichtung ist jener wunderbare Karfreitagmorgen, wo der mit Gott und sich zerfallene Held den edlen Gawan trifft. „Wie, wenn bei Gott ich Hilfe fände?“ Und er pilgert zu Tevrezent. Hier liegt der Kern der faustischen Religion. Man begreift das Wunder der Eucharistie, das die an ihm Teilnehmenden zu einer mystischen Gemeinschaft, zur alleinseligmachenden Kirche verbindet. Man begreift aus dem Mythus vom heiligen Gral und seiner Ritterschaft die innere Notwendigkeit des germanisch-nordischen Katholizismus. Gegenüber den antiken Opfern, die jeder Einzelgottheit in ihrem Tempel gebracht wurden, erscheint hier das eine, unendliche Opfer, das sich überall und täglich wiederholt. Das ist eine faustische Idee des 9.–12. Jahrhunderts, der Eddazeit, von den angelsächsischen Missionaren wie Winfried vorgeahnt, aber erst damals zur Reife gediehen. Der Dom, dessen Hochaltar das vollzogene Wunder umschließt, ist ihr steingewordener Ausdruck.
Die Vielheit einzelner Körper, als welche der antike Kosmos sich darstellt, fordert eine gleichartige Götterwelt: dies ist der Sinn des antiken Polytheismus. Der eine Weltraum, sei er magisch-alchymistisch oder dynamisch-faustisch empfunden, fordert den einen Gott des morgenländischen oder des abendländischen Christentums (zweier Religionen unter derselben Maske). Zeus ist ein Mensch, mehr noch, er ist ein Leib. Die attische Plastik erst hat Athene und Apollon endgültig geformt, wie die Orgelfugen, Kantaten und Passionen von Schütz, Haßler und Bach den protestantischen Gott geformt haben. Von der Gestaltenfülle der Edda und der gleichzeitigen Heiligenlegende an bis auf Goethe vollzieht sich der umgekehrte Prozeß wie in der Antike. Dort eine immer weitergehende Atomisierung des Göttlichen, so daß für den Römer die Namen des Juppiter Latiaris und des Juppiter Feretrius streng verschiedene Einzelnumina[S. 259] decken, von denen jedes seinen eignen Kult fordert; hier ein Gott, der mehr und mehr mit dem alleinigen Raume identisch wird.
Die ganze magische, von der Kirche mit dem vollen Gewicht ihrer Autorität gedeckte himmlische Hierarchie von den Engeln und Heiligen an bis zu den Personen der Dreifaltigkeit entkörpert sich, verblaßt mehr und mehr und unvermerkt verschwindet der Teufel, der grosse Gegenspieler im Weltdrama, aus den Möglichkeiten des faustischen Weltgefühls. Er, nach dem noch Luther sein Tintenfaß warf, wird von den protestantischen Theologen längst mit verlegenem Schweigen übergangen. Die Einsamkeit der faustischen Seele verträgt sich nicht mit einem Dualismus der Weltmächte. Gott selbst ist das All. Im 17. Jahrhundert versagt dieser Religiosität gegenüber die Formensprache der Malerei und die Instrumentalmusik wird das einzige und letzte Mittel religiösen Ausdrucks. Man darf sagen, daß der katholische und der protestantische Glaube sich wie ein Altargemälde und ein Oratorium verhalten. Schon um die germanischen Götter und Helden spannen sich abweisende Weiten, rätselhafte Düsternisse; sie sind in Musik getaucht (nicht gerade die Musik des „Ringes“); nächtlich, weil das Tageslicht Grenzen für das Auge und also leibhafte Dinge schafft. Die Nacht entkörpert; der Tag entseelt. Apollon und Athene haben keine „Seele“. Auf dem Olymp ruht das ewige Licht eines tiefklaren südlichen Tages. Die apollinische Stunde ist der hohe Mittag, wenn der große Pan schläft. Walhall ist lichtlos. In der Edda schon spürt man jene tiefen Mitternächte, in denen Faust in seinem Studierzimmer brütet, die Rembrandts Radierungen festhalten, in die Beethovens Tonfarben sich verlieren. Wotan, Baldur, Freya hatten nie eine „euklidische“ Gestalt. Von ihnen wie von den vedischen Göttern Indiens läßt sich „kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen“. Diese Unmöglichkeit enthält eine Weihe des ewigen Raumes als des höchsten Symbols, im Gegensatz zum körperlichen Abbilde, das ihn zur „Umgebung“ herabsetzt, entheiligt, verneint. Das ist keine Welt für die Nähe und das Auge. Dies tiefgefühlte Motiv liegt dem Bildersturm im Islam und in Byzanz — beide im 8. Jahrhundert — wie später dem im protestantischen Norden[S. 260] zugrunde. War nicht auch die Schöpfung der antieuklidischen Analysis des Raumes durch Descartes ein Bildersturm? Die antike Geometrie imaginiert eine Zahlenwelt des Tages, die Funktionentheorie ist die eigentlich nächtliche Mathematik.
Zur Nacht, und sei es nur die innere, seelische Nacht, gehört das Gefühl der Verlassenheit. Der antike Mensch, das ζῷον πολιτικόν nach den Worten des Aristoteles, dessen Leben am Tage und also in Gesellschaft, auf der Agora seine Höhe erreichte, hat es nie gekannt. Die indische Seele wurde nie frei von ihm. Das unterscheidet Sokrates von Buddha und Rousseau. Das Helldunkel Rembrandts, das metaphysisch diese Einsamkeit, die grenzenlose Verlorenheit der Seele im Weltraume, bedeutet, hatte in dem schauerlichen Braun und Grau der nordischen Götterwelt seinen frühesten Anklang, wie es in den Nächten der letzten Quartette Beethovens mit ihren schmerzlichen Lichtblitzen und der trostlosen Wehmut der Tristanmusik zum letzten Male auftaucht, um dann rasch in einer verspäteten, vereinzelten und wenig zugänglichen Weltstadtlyrik bei Baudelaire, Verlaine, George und Droem zu verblassen.
Was diese Seele durch einen außergewöhnlichen Reichtum an Ausdrucksmitteln, in Worten, Tönen, Farben, malerischen Perspektiven, philosophischen Systemen, Legenden und nicht zum wenigsten in den Räumen gotischer Kathedralen und den Formeln der Funktionentheorie aussprach, ihr Weltgefühl nämlich, das hat die ägyptische Seele, fernab von allem theoretischen und literarischen Ehrgeiz, allein durch die unmittelbare Sprache des Steins — das stärkste Symbol des Gewordenen — ausgedrückt. Statt sich über ihre Form des Ausgedehnten, ihren „Raum“ und ihre „Zeit“, in Wortspielen zu ergehen, statt Hypothesen, Zahlensysteme und Dogmen zu bilden, stellte sie schweigend ihre ungeheuren Symbole in die Landschaft am Nil. Was für Menschen! Die faustische Seele, das „Fünklein“ Meister Eckarts, fühlte sich grenzenlos einsam in ungeheuren Weiten — wie die Hirtenmelodie am Anfang des[S. 261] dritten Aktes von Tristan und Isolde. Die apollinische Seele fühlte sich von der blinden είμαρμένη in eine sinnlose Welt zahlloser Einzeldinge geworfen, gestoßen und zerbrochen — König Ödipus, ihr ergreifendstes Abbild. Die ägyptische Seele sah sich wandernd auf einem engen und unerbittlich vorgeschriebenen Lebenspfad. Das war ihre Schicksalsidee. Das ägyptische Dasein ist das eines Wanderers; die gesamte Formensprache seiner Kultur dient der Versinnlichung dieses einen Motivs. Sein Ursymbol läßt sich, neben dem Raum des Nordens und dem Körper der Antike durch das Wort Weg am ehesten fühlbar machen. Es ist dies eine ganz andere und für uns äußerst schwierige Art, die Ausdehnung aufzufassen. Dieser Aspekt ist es, den die Pharaonenkunst von ihrer Geburt bis zu ihrem Erlöschen verwirklichen wollte. Die feierlich vorwärtsschreitende Statue, die endlosen, in strenger Folge geordneten Gänge der Pyramidentempel der 4. Dynastie (2930–2750), die düster, sich immer verengernd durch Hallen und Höfe zur Grabkammer führen; die Sphinxalleen vor allem der 12. Dynastie (2000–1788), die Reliefzyklen der Tempelwände, an denen der Betrachter entlang schreiten muß, die immer in bestimmter Richtung begleiten und leiten — all dies repräsentiert das Tiefenerlebnis eines eigenartigen Menschentums, das ägyptische Schicksal in seiner ehernen Notwendigkeit, die durch den Granit und Diorit symbolisiert wurde (man denke an den vielleicht verwandten Sinn, den der Granit für Goethe und seine Anschauung der Erdgeschichte besaß). Man nehme die Pyramiden, diese ungeheuren Schöpfungen einer traumschweren Frühzeit — sie gehören zur Gotik der ägyptischen Seele — ja nicht im Sinne stereometrischer Körper. So empfand sie der antike Betrachter, und zwar aus seinem Weltgefühl heraus mit zwingender Gewißheit. Für den Ägypter aber war das über seine Weltform entscheidende Tiefenerlebnis so streng hinsichtlich der Richtung betont, daß der Raum gewissermaßen in steter Verwirklichung begriffen blieb. Wir sahen, daß in diesem Urerlebnis des Menschen, das ihm zugleich ein Innenleben und den Besitz einer Außenwelt gewährt, die Richtung als das Merkmal des Lebendigen die sinnliche Empfindung zum Raume vertieft, die Zeit als Ferne erstarren läßt. Was ich hier mit dem Worte[S. 262] Weg anzudeuten versuche, ist das Bild dieses im Bewußtsein andauernden weltschaffenden Aktes. Weg bedeutet zugleich Schicksal und „dritte Dimension“. Die mächtigen Wandflächen, Reliefs, Säulenreihen, an denen er vorüberführt, repräsentieren „Länge und Breite“, d. h. die Empfindung, das Fremde, welches das Leben erst zur Welt dehnt. So erlebt der Wanderer den Raum gewissermaßen in seinen noch unvereinigten Elementen, während die Antike ihn nicht kannte und er uns in ruhender Unendlichkeit umgibt. Deshalb will diese Kunst Flächenwirkung und nichts anderes, auch dort, wo sie sich kubischer Mittel bedient. Für den Ägypter war die Pyramide über dem Königsgrabe ein Dreieck, eine ungeheure, den Weg abschließende, die Landschaft beherrschende Fläche von stärkster Kraft des Ausdrucks, von wo aus er auch sich ihr näherte; die Säulen der inneren Gänge, auf dunklem Hintergrunde, von strengster Komposition und mit Schmuck überdeckt, wirkten durchaus als vertikale Flächenstreifen, die den Zug der Priester rhythmisch begleiteten; das Relief ist peinlich — und sehr im Gegensatz zum antiken — in eine Fläche gebannt, nur seine Gestalten wandern mit. Alles bewegt sich machtvoll einem Ziele zu. Die Herrschaft der Horizontale, der Vertikale und des rechten Winkels, das Vermeiden jeder Verkürzung unterstützen das zweidimensionale Prinzip und isolieren das Erlebnis der Raumtiefe, die mit der Wegrichtung und dem Ziel — dem Grabe — zusammenfällt. Diese Kunst gestattet keine die Spannung der Seele erleichternde Ablenkung.
Ist es nicht dies — in der erhabensten Sprache ausgedrückt, die überhaupt gedacht werden kann — was in all unsern Raumtheorien sich aussprechen möchte? Auch in der physiologischen, denn das Netzhautbild des Auges ist flächenhaft und wird durch einen vitalen Akt in eine räumliche Erfahrung überführt.
Die Raumwerdung selbst, die den Sinn der Außenwelt in sich schließt, war das symbolische Erlebnis dessen, der vom Torbau des Pyramidentempels am Nilufer den verdeckten Opferweg entlang schritt, alle Symbole des Seins in tiefsinnigen Bildern zur Seite. Man fühlte inmitten dieser Formen die Identität des Raumwerdens mit dem Leben. Durch die schmale[S. 263] Pforte der mächtigen Pylonenwand — dem Sinnbilde der Geburt — leitete das Schicksal ohne Ausweichen durch stets sich verengende Räume zur letzten Zelle, die den zur Mumie verewigten Leib enthielt, der das „Ka“ des toten Pharao an sich fesselte. Dies ist eine Metaphysik in Stein, neben der die geschriebene — die Kants — wie ein hilfloses Stammeln wirkt. Dies eine Symbol des Weges stellt die Fassung des ägyptischen Makrokosmos reiner und erschöpfender dar, als es irgendeines der antiken und indischen vermocht hat. Dies verleiht der Formensprache des Ägyptertums eine Reinheit und Simplizität, die von Menschen andrer Kulturen, von uns, nur als Starrheit empfunden werden konnte.
Jede Kultur besitzt ihre Gotik, ihre Kindheit. Aber auch jeder einzelne Mensch in ihr durchlebt eine entsprechende Phase. Man ist auf die innere Verwandtschaft der urmenschlichen und der kindlichen Kunst längst aufmerksam geworden. Sicherlich ist die ursprüngliche, selbst unter Tieren vorkommende Freude, etwas nachzuahmen, ein beständig wirksamer Trieb in aller Kunst. Schon das Kind müht sich ab, durch Umrißzeichnungen etwas „herauszubringen“ oder Erwachsene in ihren Bewegungen und Ausdrücken zu imitieren. Wir kennen den Ursprung der griechischen τραγῳδία, die Bockstänze der Bauern am Seelenfeste des Dionysos, welche die neuerwachte Zeugungskraft der Natur versinnbildlichten. Die begabtesten Mimen unter ihnen zogen tiermäßig ausstaffiert (die „tragische Maske“) auf ihrem Karren (dem „Thespiskarren“) von Dorf zu Dorf und erregten Gelächter. Dergleichen kennt jedes Land. Wir haben die gut getroffenen Tierzeichnungen der Höhlenmenschen und Buschmänner kennen gelernt. Sei dies nun Musik oder Malerei — der echte Rationalist wird in der Kunst nie eine andere Tendenz bemerken. Noch Aristoteles bezeichnet die μίμησις als ihr Wesen, und von hier stammt der etwas platte Ausdruck Lessings, der Endzweck aller Kunst sei das Vergnügen.
Andrerseits bricht das Formgefühl einer erwachenden Kultur mit solcher Macht hervor, daß es Pflanzen, Tiere, menschliche[S. 264] Motive bis zur Unkenntlichkeit stilisiert. Das lehren gleichmäßig der Dipylonstil, die Romanik, die frühägyptische und früharabische (altchristliche) Kunst. Hier redet eine neue Seele in einer neuen, nie dagewesenen und nie sich wiederholenden Sprache. Hier handelt es sich nicht um eine imitative, sondern eine symbolische Tendenz, nicht um Vergnügen, sondern um einen dämonischen Drang, der alles andre eher als Unterhaltsamkeit, Erholung, „Heiterkeit der Künstlerseele“ gestattet. Diese Kunst ist es, auf welche allein der Begriff des Stils anwendbar ist, die ihre Macht über alle Formen des äußern Lebens erstreckt und deren Geist erlischt, sobald die Kultur zur Zivilisation, die Seele zum Intellekt wird.
In diesem Gegensatz von Künstlerheiterkeit und Künstlerernst, Spiel und Zwang, von Nachahmen und Beschwören der Sinnenwelt tauchen wieder jene Urgefühle der Weltsehnsucht und Weltangst auf, und wir begreifen mit einem Schlage, inwiefern hiermit alle Kämpfe um Kunstprobleme zusammenhängen; in allem Gegensatz zwischen apollinisch und dionysisch, klassisch und romantisch, Form und Gehalt, Regel und Laune, Artistik und Naturalismus wird irgendwie das Geheimnis berührt, das hier verborgen liegt. Nur der Systematiker, der Verstandesmensch wird hier trennen und werten wollen, wo historisch, psychologisch, persönlich nur ein Ganzes wirksam ist. Aber man muß wissen, daß von einer Wurzel der Kunst nicht die Rede sein kann.
Der kindliche Wechsel von tiefstem Entzücken über die ertagende Welt, über den Seelenfrühling, von unendlicher Sehnsucht nach Reife, Wachsen, Vollendung — und tiefster Angst vor dem Unfaßlichen, das in diesem Aufblühen liegt, vor dem Verhängnis, das mit ihm kam, der Notwendigkeit eines Endes, dem Geheimnis der Vergänglichkeit, ruft an der Schwelle einer jeden Kultur den strengen Stil dorischen und gotischen Charakters, die große Ornamentik und den Hang zu einer ungeheuren, späten Generationen oft so rätselhaften Baukunst hervor, deren keine reifgewordene Kultur, weder das Barock noch der Islam noch das Mittlere Reich Ägyptens mehr fähig gewesen ist.
Riesenwerke solcher Art sind überhaupt nicht das Produkt einer „Kunst“ im artistischen Sinne irgendeiner ihrer Mittel[S. 265] und Ziele bewußten, ihre Aufgabe wählenden Malerei, Skulptur oder Dichtung; sie entstanden als elementares Naturereignis. Ein Dom ist eine namenlose und wahllose Schöpfung aus der mütterlichen Landschaft mit ihrem jungen Menschentum, aus ihrem Schoße geboren, nicht eine persönlich-bewußte Konzeption aus dem Willen irgendeines Künstlers. Plötzlich, schlechthin vollkommen, überwältigend in ihrem Ausdruck von Trotz und Qual, voller süßer Schwermut und Hingabe treten diese Knabenträume einer frühen Seele allenthalben in die Tageswelt, die große Architektur, der große Mythus, das Epos, das neue Ornament, die Kriege der Heldenzeit.
Alle Weltangst, sahen wir, ist Angst vor dem Raume, dem Verwirklichten, der Grenze — dem Tode. Im Tiefenerlebnis, durch das die sichtbare Welt wird, hat sie ihren Ursprung. Gestalt, Zahl, Raum und Angst haben einen gemeinsamen Grund. Und so erscheint die vollzogene, der starren Ordnung durch das Ursymbol unterworfene und dadurch in ihrem ganzen Umfange zum Sinnbild einer und nur dieser einen Seele — zum Makrokosmos — erhobene Welt als das feindliche Prinzip, das Reich der dunklen Mächte, die Inkarnation des Bösen. Im Hinblick darauf ist die Feindschaft zwischen Seele und Welt der nie ganz unterdrückte Untergrund alles Weltbewußtseins. Deshalb wird die junge Seele sich plötzlich ihres einsamen Menschentums inmitten aller Vergänglichkeit bewußt. Dies ist das Dämonische in aller Natur — Natur als der Welt des Ausgedehnten —, das die antike Seele ebenso kennen lernte wie jede andre. Das faustische wie das magische Christentum, die Orphiker mit ihrer Formel σῶμα σῆμα und das ägyptische Totenbuch stimmen darin überein. Tausend mythische Gestalten, Legenden und Bräuche zeugen davon. Wie das geringste Ornament an einem Schwertgriff, Gefäß oder Säulenknauf, so ist auch das hellenische Kultdrama ein Mittel, den Zorn der Götter zu besänftigen. So nennt Livius (VII, 2) die szenischen Spiele (Tragödien), welche zur Abwendung der Pest in Rom veranstaltet wurden, caelestis irae placamina. Dies erst durch die Raumwerdung zur Erscheinung gezwungene Dämonische ist es, das die Seele abwehren, bannen, heiligen will, indem sie es durch den Zauber eines Symbols bannt. Sie gibt ihm Form, die Bedeutung besitzt, eine sinnvolle[S. 266] Grenze, einen Namen, das heißt, sie macht es von sich abhängig.[60]
Deshalb wendet sich die früheste und elementarste aller Künste an den Urstoff der Welt, die Inkarnation des Widerstandes, den die Angst brechen will, den Stein. Man wird die gigantische Architektur der Dome und Pyramiden nie begreifen, wenn man sie nicht als Opfer auffaßt, das die junge Seele den fremden Mächten bringt. Ein Opfer bedeutet im Ursinn der Menschheit die Darbringung von etwas, das teil an der eignen Seele hat. Vor allem ist es das Totemtier, in dem etwas von der Seele des Clans verweilt oder in das durch einen Akt der Weihe die Seele des Opfernden eingeht und das nun durch seine Darbringung eine mystische Vereinigung mit den Mächten bewirkt.[61]
Ein solches Opfer sind alle frühen Architekturen, das größte, das je gebracht wurde. Denn in ihnen liegt nicht nur dieser oder jener symbolische Sinn wie in kultischen Tänzen und Gesängen, in einem Gemälde, einer Statue oder Sonate, sondern der ganze Geist einer Kultur, die durch ihr steingewordenes Selbst eine Verbindung mit dem Weltgrunde sucht. Eine alte Kathedrale ist ein vollkommener Makrokosmos der faustischen Seele, ein Pyramidentempel der ägyptischen, einer jener Kuppelbasiliken von Ravenna und Byzanz der magischen. Alle spätern Kunstwerke sind daneben etwas Partielles. Töne und Farben, der durchscheinende Marmor, die gegossene Bronze, das gelesene und gesprochene poetische Wort sind Kunstmittel; sie verleugnen ihr urstoffliches Dasein oder besitzen es nicht. Alles bewußte Künstlertum ist egoistisch, voller Laune und „Freiheit“. Es ist nicht mehr die mütterliche Landschaft, aus der seine Werke wachsen. Die Idee des überpersönlichen Opfers der ganzen Seele ist mit der Frühzeit untergegangen.
Diese erste Kunst brauchte das Bewußtsein eines Sieges und so überwand sie den Stein und zwang ihn, in symbolischen[S. 267] Formen aus der Erde aufzuwachsen. Weil hier das Leben selbst in Frage stand, knüpften sich diese Formen unmittelbar an den Gedanken des Todes, in den Pyramidentempeln, deren innerer Weg zum Königsgrabe führt, wie in den Domen, deren hochgewölbte Schiffe mit ihren Pfeilerreihen dem Hochaltar zu geleiten, der das Geheimnis der Eucharistie in sich birgt, durch die ein menschgewordner Gott sich opfert. Einer solchen Kunst gegenüber wirken alle andern als Spiel, allzuirdisch, genießerisch. Deshalb diese Riesenlasten, die eine gläubige Menschheit sich auflud, um den Bau zu einem wahren Opfer zu machen. Die geistige Kraft, mit welcher Menschen so früher Stufe technische Aufgaben lösten, sofort, mit nachtwandlerischer Sicherheit, fast unbewußt, an denen das reife Wissen später Zeiten zu Schanden wird, erscheint wie ein Wunder. Ich denke an die riesenhaften Blöcke in den Fundamenten des Sonnentempels[62] von Baalbek, durch deren uns völlig rätselhafte Bewältigung die arabische Frühzeit der Idee ihres Daseins, dem Erlebnis ihres Weltraumes diente, und an die fabelhaften Steinmassen der Dome und Pyramiden, die von der Erde weg in den Weltenraum emporgetragen wurden. Wie um 1100 Fürsten, Bürger und Knechte die Karren zogen, um diese Dome inmitten winziger Städte zu errichten — der ganze Stolz der Erbauer spricht aus den Versen des jüngern Titurel — so muß der Bau der Cheopspyramide ein Akt der Weihe gewesen sein. Weder das Rokoko noch das Athen des Perikles noch das Bagdad Harun al Raschids wären — bei allem Überfluß an technischen und materiellen Mitteln — solcher Leistungen fähig gewesen. Die Akropolis, das Schloß von Versailles, die Alhambra, Werke eines raffinierten Kunstverstandes, erscheinen daneben klein und allzumenschlich.
Es sind immer die große Ornamentik und die große Architektur, diese beiden Traumkünste, die verschwistert den[S. 268] Anfang einer neuen Kulturentwicklung bilden. Wohl sind viele Motive des nordischen Ornaments urgermanisch, auch keltisch — auch in der Edda ist manches Keltische — von arabischen und antiken Entlehnungen ganz abgesehen, aber erst im 10. Jahrhundert entsteht die einheitliche und organische Bildung des faustischen Ornaments in seiner unermeßlichen Tiefe, wie wir sie an St. Trophîme in Arles, an St. Pierre in Aulnay, an St. Lazare in Autun, in Poitiers, in Moissac, in Deutschland vornehmlich an den Domen der Ottonen- und Stauferzeit, an Chorgestühlen, Geräten, Gewändern, Büchern, Waffen bewundern. Hier hat das neue Ursymbol, der unendliche Raum, den gesamten Formenschatz zu einer einheitlichen Sprache ausgeprägt. Gleichzeitig mit den magischen Kuppelräumen der Basiliken Syriens erwacht die zauberhafte Sprache der Arabeske, die flimmernd, verwirrend, alle Linien aufzehrend seitdem alles durchgeistigt und entkörpert, was seelischer Besitz der arabischen Kultur ist, — bis hinein in die Formenwelten der persischen, langobardischen, normannischen, der sogenannten „mittelalterlichen“ Kunst.
Eine heilige Strenge herrscht in diesen frühen Formen. Die älteste Dorik trägt nicht ohne Grund die Bezeichnung des geometrischen Stils. Die altchristlich-spätheidnische Kunst der Sarkophagreliefs und Bildnisse konstantinischen Stils galt deshalb und gilt heute noch als eine Kunst des Verfalls. Im Totentempel der Chephren (4. Dyn.) wird der Gipfel mathematischer Einfalt erreicht: überall rechte Winkel, Quadrate, rechteckige Pfeiler; keine Verzierung, keine Inschrift, kein Übergang; das die Spannung mildernde Ornament wagt sich erst einige Generationen später in die hehre Magie dieser Räume. Ebenso die edle Romanik Westfalens (Corvey, Minden, Freckenhorst) und Sachsens (Hildesheim, Gernrode), die mit einer unbeschreiblichen inneren Wucht und Würde über alle eigentliche Gotik hinaus den ganzen Sinn der Welt in eine Linie, ein Kapitäl, einen Bogen zu legen vermochte.
Der Simplizität dieser frühen Seelensprache erscheint nichts unmöglich. Wir finden in ihr Symbole, deren Charakter als[S. 269] Symbol bisher niemand auch nur geahnt hat. Die ägyptische Seele mit ihrem strengen Hange zum Chronologischen, einer unerhörten Gemessenheit und Abgewogenheit des sozialen Daseins — das sich in diesem einzigen Falle wirklich „sub specie aeternitatis“ abspielte — mit ihrer Wahl der härtesten Gesteine, mit ihrem Verzicht auf alles bloß Literarische, faßte schon am Anfang das alles mit leidenschaftlichem Ungestüm in einen Höhepunkt des Ausdrucks zusammen, in einen Staat, der den Geist dieser Kultur schlechthin darstellt. Auch der Staat ist ein Stück Architektur. Auch seine Formen, als Formen von Gewordnem, Verwirklichtem, Ausgedehntem, reden vom Ursymbol einer Kultur. Die antike Polis ist das Seitenstück des dorischen Tempels, ganz euklidischer Körper. Das abendländische Staatensystem ist eine Dynamik geographischer Räume. Noch deutlicher spricht die Form des ägyptischen Staates. Seine Maßnahmen und Institutionen rechnen nach Dynastien; seine Menschen bilden, sorgfältig geschichtet, wieder eine Pyramide, mit dem Pharao als Spitze. Jedermann hat ein Amt. Das Einzeldasein erschöpft sich in der Teilnahme an der großen Bewegtheit. Es gibt keine „Genies“, keine privaten Interessen. Dieser Staat ist das Schicksal; er stellt den Weg der ägyptischen Menschheit dar; er setzt sich selbst in Beziehung zur Idee des Todes. Die Pyramide ist das ungeheure Grab des Königs, dessen Grundsteinlegung den ersten Akt seiner Regierung bildet, an dem das ganze Volk arbeitet, solange er regiert. Zu ihm, dessen „Ka“, an der Mumie haftend, alle Dynastien überdauert, führt jene Prozessionsstraße von Pfeilersälen und Statuenhallen; die Säulenreihen, Reliefreihen, Statuenreihen wiederholen noch einmal das metaphysische Motiv der Herrscherreihen, die das Veränderliche im Unveränderlichen, das Lebendige im Ausgedehnten, im Staate als dem Gewordenen, darstellen. Was in andern Kulturen in tausendfacher Gestalt vorliegt, besitzt hier eine einzige. Der Staat ist die Wirklichkeit. Es gibt keine andere. Das Tiefenerlebnis, im Tempelwege symbolisiert, ist das des ganzen Ägyptertums, kaum das der partiellen Seelen. Es gibt in der gesamten organischen Welt nur ein erhabenes Seitenstück hierzu, an das noch niemand gedacht hat: den Bienenstaat.
Beide sind der höchste Ausdruck der Sorge; man könnte[S. 270] auch sagen der Pflicht. Wenn die kantische Ethik irgendwo ein Seitenstück hat, nicht in Formeln, sondern in Wirklichkeiten, so ist es hier. Es ist etwas Preußisches, etwas von Friedrich dem Großen in dieser Staatsgesinnung des ägyptischen Menschen. Dicht daneben aber steht die Kultur, welche ein Gefühl für die Zukunft — die Richtung des Lebens, den Sinn der Geschichte — und also eine Sorge nie gekannt hat, die antike. Deshalb hat sie es nie zu einem wirklichen Staate gebracht, so wenig als zu einer Früharchitektur großen Stils.
So erklärt es sich, weshalb man Weltgeschichte immer vornehmlich als die Geschichte von Staaten aufgefaßt und behandelt hat. Es liegt tiefste Notwendigkeit in diesem Zusammenhange. Eine Kultur (Seele), die kein Gefühl für das eigne Werden besitzt — das ist Geschichte, Verwirklichung von Möglichem — besitzt auch keinen Blick für das zu Vollendende. In einer Staatsidee stellt sich die Geschichte der Zukunft dar, wie eine Kultur sie will. Vergangenheit und Zukunft sind in gleicher Weise Phänomene der Ferne. Man sorgt um beide oder keines von beiden, um die Toten und die Ungebornen oder nur um das Glück der Stunde. Der Sozialismus setzt einen eminenten Sinn für Geschichte voraus, indem er Kommendes an Vergangenes knüpft, der Stoizismus ist ahistorisch. Er erinnert sich an nichts und sorgt um nichts. Der ägyptische Staat ist in gewissem Betrachte sozialistisch. Die indische Staatengeschichte — wenn man von einer solchen reden darf — hat im Hinblick auf ihre Sorglosigkeit und das Herankommenlassen der Dinge etwas Antikes. Wer eine innere Entwicklung — zu Goethes Zeit nannte man das die Kultur eines Menschen — besitzt und sich Rechenschaft über sie ablegt, hat auch eine innere Zukunft und den Willen zu ihr. Der „Staat“ des innern Menschen ist sein Charakter. Charakterbildung und Staatengeschichte sind in der Tiefe identisch als biographische Formen des Einzelnen und seiner Kultur. Shakespeare stellte neben seinen Othello und Macbeth die Reihe seiner Historien, Goethe neben den Egmont den Tasso, neben eine äußere eine innere Revolution. Don Quijote, Don Juan, Werther resümieren auch eine politische Phase und man darf die — gänzlich unantike — psychologische Dialektik in den Romanen von Choderlos de[S. 271] Laclos, Stendhal und Balzac eine Politik der Seele nennen; insofern ist Julian Sorel der Zögling Napoleons. Das attische Drama aber ist unpolitisch — also mythisch — und ohne das formale Motiv einer innern Entwicklung. So wenig Antigone ein Charakter, der sich „im Strome der Welt bildet“, so wenig war Athen ein Staat im westeuropäischen Sinne. Beide gehören dem Augenblick, dem blinden Ungefähr mit der ganzen Summe ihrer Existenz an. Sie sind immer fertig wie ein euklidischer Körper. Sie haben keine Genesis und kein Ziel ihres Daseins. Beide Erscheinungen, das Weltbild der Historie und das Phänomen des Staates, in dem nach Goethes Ausdruck die Idee unmittelbar angeschaut wird, verhalten sich wie Leben und Erlebtes. Die abendländische politische Geschichte und das abendländische Staatensystem verhalten sich wie Wollen und Erreichtes, die antike Geschichte und die lose Menge der πόλεις demgemäß wie ein Geschehenlassen und dessen Resultat.
Auch der gotische Dom verhält sich zum nordischen Glauben wie das Erlebte zum Erleben. Der Atem seines Raumes ist der Geist Gottes. Er symbolisiert den „Weg zu Gott“, zum Hochaltar, der in der geweihten Hostie das immerwährende Wunder umschließt, das die Teilnehmer an ihm zur sichtbaren Kirche, einer faustischen Gemeinschaft jenseits aller Grenzen von Raum und Zeit, vereinigt. Dieser Gedanke, der durchaus Eigentum der abendländischen Seele ist, der im 10. Jahrhundert konzipiert und 1215 auf dem lateranischen Konzil als Dogma fixiert wurde, schuf aus der arabischen Basilika des orientalischen Christentums den Dom. Das Raumgefühl des magischen Menschen, das sich in dem von einem Syrer erbauten Pantheon zu Rom ankündigt und über die Kuppelbauten von Ravenna und Byzanz zu den großen Moscheen des Islam führt, hat plötzlich einem neuen Tiefenerlebnis und folgerichtig einer neuen Architektur und Staatsidee den Rang abgetreten. Die Palastkapelle Karls des Großen zu Aachen — dem Geiste nach eine Moschee — ahnt hiervon noch nichts. Durch eine ebenso plötzliche Gedankenschöpfung muß zu Beginn der 4. Dynastie — um 3000, wo mit dem Ende der Thinitenzeit die ägyptische Kultur ins Leben tritt — zugleich mit dem neuen Weltgefühl die Idee einer Religion, die Idee des Pharaonenstaates und der sie verkörpernde[S. 272] Baugedanke jener ungeheuren Totentempel als ein Ganzes entstanden sein.
Man begreift nun, eben aus dem Unterschied von Dom und Pyramide, von unsichtbarer Kirche und sichtbarem Staat als den repräsentativen Formen der Seelengemeinschaft, das gewaltige Phänomen der gotischen Seele, die in prachtvollem Aufschwung über alle Grenzen optisch gebundener Sinnlichkeit hinausstrebt. Kann etwas dem Sinne des ägyptischen Staates, dem alle Pharaonen gedient haben, dessen Tendenz man als einen erhabenen Realismus bezeichnen möchte, fremder sein als der politische Ehrgeiz der großen Sachsen-, Franken- und Staufenkaiser, die am Überfliegen aller staatlichen Wirklichkeiten zugrunde gingen? Die Anerkennung einer Grenze wäre ihnen gleichbedeutend mit der Herabwürdigung der Idee des Herrschertums gewesen. Hier tritt der unendliche Raum als Ursymbol in seiner ganzen unbeschreiblichen Macht in den Umkreis öffentlichen Daseins, und man könnte zu den Gestalten der Ottonen, Konrads II., Heinrichs VI. und Friedrichs II. die Normannen, die Eroberer Islands und vor allem die großen Päpste Gregor VII. und Innocenz III. fügen, die alle die sichtbare Machtsphäre mit der damals bekannten Welt gleichsetzen wollten. Dies unterscheidet die homerischen Helden mit ihrem geographisch so genügsamen Gesichtskreis von den stets im Unendlichen schweifenden Helden der Gral-, Artus- und Siegfriedsage. Dies unterscheidet auch die Kreuzzüge, zu denen die Krieger von den Ufern der Elbe und Loire bis zu den Grenzen der bekannten Welt ausritten, von den Ereignissen, welche der Ilias zugrunde liegen und auf deren örtliche Enge und Übersehbarkeit man auf den Stil des antiken Seelentums mit Sicherheit schließen darf.
Die dorische Seele verwirklichte das Symbol des leibhaft gegenwärtigen Einzeldinges, indem sie auf alle großen und weitreichenden Schöpfungen Verzicht leistete. Es hat seinen guten Grund, wenn die erste nachmykenische Zeit unseren Archäologen nichts hinterlassen hat. Wenn die ägyptische und faustische Seele in der Sprache einer gewaltigen Architektur zuerst zum Ausdruck kam, so suchte die antike Seele ihren Ausdruck in[S. 273] einem ausdrücklichen Verzicht auf sie. Ihr endlich erreichter Ausdruck ist der dorische Tempel, der nur nach außen, als massives Gebilde in der Landschaft gelegen, wirkt und den künstlerisch überhaupt unbeachteten Raum in sich als das μὴ ὄν, das, was gar nicht da sein sollte, verleugnet. Die ägyptische Säulenreihe trug die Decke eines Saales. Der Grieche entlehnte das Motiv und wandte es in seinem Sinne an, indem er den Bautypus wie einen Handschuh umkehrte. Die äußeren Säulenstellungen sind Reste eines „Innenraums“.[63]
Demgegenüber ließen die magische und die faustische Seele ihre steinernen Traumgebilde als Überwölbungen bedeutungsvoller Innenräume emporsteigen, deren struktive Idee den Geist zweier Mathematiken, der Algebra und der Analysis, vorwegnimmt. In der von Burgund und Flandern ausstrahlenden Bauweise bedeuten die Kreuzrippengewölbe mit ihren Stichkappen und Strebepfeilern eine Auflösung des geschlossenen, durch sinnlich-greifbare Grenzflächen bestimmten Raumes überhaupt. Ein Innenraum ist noch immer etwas Körperhaftes. Hier aber wird der Wille fühlbar, aus ihm ins Grenzenlose zu dringen, wie es später die in diesen Wölbungen heimische Musik des Kontrapunkts wollte, deren körperlose Welt immer die der ersten Gotik geblieben ist. Wo auch in spätesten Zeiten die polyphone Musik zu ihren höchsten Möglichkeiten emporstieg wie in der Matthäuspassion, der Eroica und Wagners Tristan und Parzifal, wurde sie mit innerster Notwendigkeit domhaft und kehrte zu ihrer Heimat, zur steinernen Sprache der Kreuzzugszeit zurück. Die ganze Wucht einer tiefsinnigen Ornamentik mit ihren seltsam schauerlichen Umbildungen von Pflanzen, Tier- und Menschenleibern (St. Pierre in Moissac), welche die Substanz des Gesteins leugnet, welche alle Linien in Melodien und Figurationen eines Themas, alle Fassaden in vielstimmige Fugen, die Leiblichkeit[S. 274] der Statuen zu einer Musik der Gewandfaltung auflöst, mußte zu Hilfe kommen, um jeden antiken Hauch von Körperlichem zu bannen. Erst dies gibt den riesigen Glasfenstern der Dome mit ihrer farbigen, durchleuchteten, also völlig stofflosen Malerei — eine Kunst, die sich niemals wiederholt und die den stärksten überhaupt denkbaren Gegensatz zum antiken Fresko bildet — ihren tiefen Sinn. Er wird am deutlichsten etwa in der Sainte Chapelle zu Paris, in der neben dem leuchtenden Glas der Stein beinahe verschwunden ist. Im Gegensatz zum Fresko, dem mit der Wand körperlich verwachsenen Gemälde, dessen Farben als Materie wirken, finden wir hier Farben von der räumlichen Freiheit der Orgeltöne, völlig vom Medium einer tragenden Fläche gelöst, Gestalten, die frei im Unbegrenzten schweben. Mit dem faustischen Geiste dieser hochgewölbten, farbig durchleuchteten, zum Chore strebenden Kirchenschiffe vergleiche man die Wirkung der arabischen — also altchristlich-byzantinischen — Kuppeln. Auch die über der Basilika oder dem Oktogon scheinbar frei schwebende Hängekuppel bedeutet eine Überwindung des antiken Prinzips der natürlichen Schwere, wie sie das Verhältnis von Säule und Architrav ausdrückt. Auch hier verleugnet sich der Stein. Eine geisterhaft verwirrende Durchdringung der Formen von Kugel und Polygon, eine Last auf einem Steinring gewichtlos über dem Boden schwebend, alle tektonischen Linien verhüllt, kleine Öffnungen im höchsten Gewölbe, durch die ein Ungewisses Licht hereinfällt, das die Raumgrenzen noch unwirklicher macht — so stehen die Meisterwerke dieser Kunst, San Vitale in Ravenna, die Hagia Sophia in Byzanz, der Felsendom in Jerusalem vor uns. Statt der ägyptischen Reliefs mit ihrer reinen Flächenbehandlung, die jede in die Tiefe weisende Verkürzung peinlich meidet, statt der den äußeren Weltraum einbeziehenden Glasgemälde der Dome verkleiden hier flimmernde Mosaiken und Arabesken, in denen der Goldton vorherrscht, alle Wände und versenken das Wirkliche in einen märchenhaften, ungewissen Schein, der in aller maurischen Kunst für den nordischen Menschen immer so verlockend geblieben ist.
[S. 275]
So stammt das Phänomen des Stils also aus dem hier festgestellten Wesen des Makrokosmos, aus dem Ursymbol einer Kultur. Man wird, wenn man den Gehalt des Wortes zu würdigen weiß, die fragmentarischen und chaotischen Kunstäußerungen des Urmenschentums nicht zu der umfassenden Bestimmtheit eines Stils in Beziehung bringen. Erst die als Einheit nach Ausdruck und Bedeutung wirkende Kunst der großen Kulturen — und nun nicht mehr die Kunst allein — hat Stil.
Wir haben die guten Tierimitationen der Diluvialmenschen und einiger Naturvölker sowie die sehr hoch stehende mykenische und Merowingerkunst. Aber gerade das macht den Unterschied evident. Das ist kein Stil. Das ist alles isoliert, voller Freude am Gestalten und Nachahmen, voller Sinn für Harmonie und Nuancen, aber ohne ein, sagen wir ruhig metaphysisches Formgefühl, das unbewußt, wo es auch in Kraft tritt, an Kunstwerken, Bauten, Geräten, Schmuck, auf ein Ziel zustrebt. Damit erst gibt es Stil, eine ungewollte und unausweichliche (das soll man heute unterstreichen) Tendenz in aller Produktion, die von der frühesten Dorik bis zum Römertum, von der frühesten Romanik bis zum Empire die gleiche bleibt. Man vergleiche das Aachener Münster mit Bauten, die nur 150 Jahre später entstanden sind: inzwischen ist ein Stil erwacht. In Aachen ist er noch nicht da. Der Bau Karls des Großen ist ein Musterbeispiel für eine Kunst außerhalb und vor einer Stilatmosphäre, außerhalb einer Kultur also! Da gibt es kein Ursymbol, das hätte verwirklicht werden können und müssen. Ebenso unterscheiden sich durch eine innere Notwendigkeit der Form die geometrischen Verzierungen der spätmykenischen und der frühdorischen Kunst. Erst die Dorik legt eine Tendenz, ein Weltgesetz hinein. Andrerseits: in der Antike ist mit dem Alexandrinismus, bei uns um 1800 diese Tendenz zu Ende. Die Geschichte des Stils schließt ab. Die Möglichkeiten des einen Formgedankens haben sich erschöpft. Von da an macht man nach, erkünstelt, kreiert „Stile“, die alle zehn Jahre wechseln, mit denen jeder tut, was er will; man wiederholt, kombiniert, treibt Äußerlichkeiten auf die Spitze, weil das Bedürfnis,[S. 276] Kunst zu machen, noch fortdauert, während der Stil, d. h. die notwendige Kunst tot ist. Das ist die Lage von heute.
Im Stil offenbart sich in und über allem bewußten Künstlertum — das immer eine späte und städtische Erscheinung bildet — das unbewußt Seelische, das, was ich die Idee des Daseins nannte. Ein Stil ist ein Schicksal. Man hat ihn, aber man erwirbt ihn nicht. Bewußter, gewollter, gemachter Stil ist erlogener Stil, wie es alle Spätzeiten, allen voran die Gegenwart, beweisen. Große Künstler und Kunstwerke sind Naturereignisse. Die Welt — Natur — ist Schöpfung der Seele, das vollkommene Kunstwerk ist es auch: beide ungewollt, wahllos, notwendig, folglich beide „Natur“. Hierauf beruht die innere Identität eines Stils und der zugehörigen Mathematik. Stilformen sind, ohne Ausnahme, extensive Formen. Sie bannen das im Ausgedehnten als gegenwärtig empfundene Fremde. Von den beiden urmenschlichen Kunsttrieben, dem imitativen und dem symbolischen, ist es der letzte, das ornamentale Wollen, das den Stil hervorruft. Nicht in der Weltsehnsucht, allein in der Weltangst liegt die letzte erreichbare Wurzel aller elementaren Kunstform. Ein Kunstwerk besitzt Stil in genau demselben Sinne und Maße, wie eine physikalische Vorstellung außer theoretisch-bildhaftem auch mathematischen Gehalt besitzt.
Um ein Beispiel zu geben, fasse ich das ungeheure Phänomen des ägyptischen Stils noch einmal zusammen, so wie es seit wenigen Jahren übersehbar geworden ist. Wenn je, so ist in diesem Stil der Tod wirklich gebannt worden. Hier ruht Ewigkeit auf jedem Zuge; nicht jene ergreifende Leidenschaft, die in der Gotik die Flügel entfaltet, um dem Irdischen zu entrinnen und sich in jenseitige Räume zu verlieren; nicht der allzu-körperliche und für uns etwas oberflächliche Hang der Antike, das Behagen des Augenblicks um sich zu breiten und den Rest zu vergessen. Der ägyptische Stil ist von einem tiefen Realismus. Er ergreift die ganze Vergänglichkeit; er erkennt — und er hält sich deshalb bis in die letzten Epochen an den Stein als Material — das Gewordne und Begrenzte an, um es zu überwinden. Bei Rembrandt, Beethoven und Michelangelo redet die Furcht vor dem Raume aus jedem Zuge; in der Architektur von Memphis und Theben liegt sie weit zurück.
[S. 277]
Um das Jahr 1100 erfolgt gleichzeitig in Frankreich, Oberitalien und Westdeutschland die Einwölbung des bis dahin flach gedeckten Mittelschiffes der Dome. Mit einem schöpferischen Akt von gleicher Unbewußtheit und symbolischer Prägnanz beginnt der ägyptische Stil. Das Ursymbol des Weges ist plötzlich ins Leben getreten, mit dem Beginn der 4. Dynastie (2930 v. Chr.). Das weltbildende Tiefenerlebnis dieser Seele empfängt seinen Gehalt vom Richtungsfaktor selbst: die Tiefe des Raumes als erstarrte Zeit, die Ferne, der Tod, das Schicksal selbst beherrscht den Ausdruck; die bloß sinnlichen Dimensionen der Länge und Breite werden zur begleitenden Fläche, die den Weg des Schicksals einengt und vorschreibt. Das spezifisch ägyptische Flachrelief, auf Nahsicht berechnet und in seiner zyklischen Anordnung den Betrachter zwingend, in vorgeschriebener Richtung die Wandflächen abzuschreiten, taucht ebenso plötzlich gegen Beginn der 5. Dynastie auf.[64] Die noch späteren Reihen von Sphinxen und Statuen, die Felsen- und Terrassentempel, die Bildnisstatuen, die stets vorwärts schreitend und schauend, nie im Profil gedacht sind, verstärken ständig die Tendenz auf die einzige Ferne, welche die Welt des ägyptischen Menschen kennt, das Grab, den Tod. Man bemerke wohl, wie schon die Säulenreihen der Frühzeit nach Durchmesser und Abstand der mächtigen Schäfte genau so gegliedert sind, daß sie jeden seitlichen Durchblick verdecken. Dies hat sich in keiner andern Architektur wiederholt.
Die Größe dieses Stils erscheint uns starr und unveränderlich. Er steht allerdings jenseits der Leidenschaft, die noch sucht und fürchtet und dem untergeordneten Detail damit eine rastlose subjektive Bewegtheit im Lauf der Jahrhunderte erteilt. Diese Seele stellte fast alles uns Wesentliche in den Elementen ihres Makrokosmos zurück, aber sicherlich wäre dem[S. 278] Ägypter der ihm so fernliegende faustische Stil — er bildet von der frühesten Romanik bis zum Rokoko und Empire ebenfalls eine Einheit — in seiner Unruhe und seinem ständigen Suchen nach einem Etwas viel gleichförmiger erschienen, als wir uns vorstellen können. Vergessen wir jedenfalls nicht, daß aus dem hier vertretenen Begriff des Stils folgt, daß Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Rokoko nur Phasen ein und desselben Stils sind, an dem wir naturgemäß vor allem das Wechselnde, das Auge anders gearteter Menschen das Bleibende bemerken. In der Tat beweisen zahllose Umbauten romanischer Werke im Barock-, spätgotischer im Rokokostil, die durch nichts auffallen, die innere Harmonie der nordischen Renaissance und der Bauernkunst, in denen Gotik und Barock völlig identisch werden, die Straßen alter Städte, deren Giebel und Fassaden aller Stilarten einen reinen Einklang bilden, und die Unmöglichkeit, Romanik und Gotik, Renaissance und Barock, Barock und Rokoko in einzelnen Fällen überhaupt zu unterscheiden, daß die „Familienähnlichkeit“ dieser Phasen viel größer ist, als sie den Angehörigen erscheinen.
Der ägyptische Stil ist absolut architektonisch bis zum Erlöschen dieser Seele. Er gestattet keine Abschweifung zu unterhaltenden Künsten, keine Tafelmalerei, keine Büste, keine weltliche Musik. In der Antike geht mit der Ionik der Schwerpunkt der Stilbildung von der Architektur zu einer von ihr unabhängigen Plastik über, im Barock geht er zur Musik, deren Formensprache ihrerseits die gesamte Baukunst des 18. Jahrhunderts beherrscht, im Arabertum löst mit dem Beginn der islamitischen Phase die Ornamentik der Arabeske alle Formen der Architektur, Malerei und Plastik zu Stileindrücken auf, die wir heute etwa als kunstgewerblich bezeichnen könnten. In Ägypten bleibt die Herrschaft der Architektur unangefochten. Sie mildert lediglich ihre Sprache. In den Hallen der Pyramidentempel der 4. Dynastie (Pyramide des Chephren) stehen schmucklose, scharfkantige Pfeiler. In den Bauten der 5. Dynastie (Pyramide des Sahu-rê) erscheint die Pflanzensäule. Steingewordne Lotus und Papyrusbündel wachsen riesenhaft aus dem Fußboden von durchscheinendem Alabaster auf, der das Wasser bedeutet, eingeschlossen von purpurnen Wänden. Die Decke ist mit Vögeln[S. 279] und Sternen geschmückt. Der heilige Weg vom Torbau zur Grabkammer, das Bild des Lebens, ist ein Strom. Es ist der Nil selbst, der mit dem Ursymbol der Richtung eins wird. Der Geist der mütterlichen Landschaft vereinigt sich mit der aus ihm entsprungenen Seele. Ganz ebenso knüpft sich das euklidische Dasein der antiken Kultur in geheimnisvoller Weise an die vielen kleinen Inseln und Vorgebirge des ägäischen Meeres und die stets im Unendlichen schweifende Leidenschaft des Abendlandes an die weiten, fränkischen, burgundischen, sächsischen Ebenen.
Der ägyptische Stil ist von einer Erfülltheit des Ausdrucks, die unter andern Bedingungen schlechthin unerreichbar erscheint. Ich glaube, daß die Langeweile, jene Verdünntheit einzelner Lebensmomente, die uns so wenig fremd ist wie den Griechen, der ägyptischen Seele unbekannt war. Leben und nur leben, in jeden Augenblick den größtmöglichen Gehalt an Wirkung legen, ist aus diesem Weltaspekt, angesichts der Symbole der Hieroglyphen, Mumien und Pyramidengräber, eine Notwendigkeit. Man kann das Ethos dieser Art zu sein nur fühlen, nicht nennen. Nicht unser „Wille“, nicht die antike Sophrosyne, sondern die mit Worten gar nicht zu beschreibende Fülle des Daseins ist die Regel. Man schreibt und redet nicht; man bildet und tut. Ein ungeheures Schweigen — für uns der erste Eindruck alles Ägyptischen — täuscht über die Macht dieser Vitalität. Es gibt keine Kultur von höherer Seelenkraft. Keine Agora, keine geschwätzig-antike Öffentlichkeit, keine nordischen Berge von Literatur und Publizistik, nur sachlich-sichere, selbstverständliche Wirksamkeit. Einzelnes wurde schon erwähnt. Ägypten besaß eine Mathematik höchsten Ranges, aber sie äußerte sich durchaus in einer meisterhaften Bautechnik, einem unvergleichlichen Kanalsystem, einer erstaunlichen astronomischen Praktik, ohne auch nur ein theoretisches Buch zu hinterlassen (denn das „Rechenbuch des Ahmes“ wird man nicht ernst nehmen wollen). Schon das Alte Reich (der deutschen Kaiserzeit entsprechend) besaß eine selten übertroffene, auf Generationen vorausschauende Sozialökonomie, aber in Gestalt eines wohlgegliederten, das Geringste bedenkenden Beamtenstaates. Die Römer mußten sich auf ihn stützen, um ihr Imperium[S. 280] lebensfähig zu erhalten, ohne daß sie seinen Geist sonderlich begriffen hätten. Ägypten mußte ihr Reich füttern, bezahlen, verwalten; es wurde infolge der Mustergültigkeit seiner Institutionen der natürliche Schwerpunkt und Cäsar war im Begriff, seine Residenz in Alexandria zu nehmen. Aber es gibt kein ägyptisches Werk von staatsrechtlichem oder finanzwissenschaftlichem Inhalt. Die späten Römer haben sich den literarischen Ruhm angeeignet, indem sie einen Schatten dieser Weisheit in ein System brachten. Ich glaube, daß man heute noch nicht ahnt, wieviel vom Corpus Juris (dem Werke, nicht dem römischen Rechtsbewußtsein) vom Nil stammt. Die Ägypter waren Philosophen, aber sie hatten keine „Philosophie“. Überall nicht der geringste Versuch einer Theorie und eine von wenigen erreichte instinktive Meisterschaft in der Praxis.
Und wie jede Wissenschaft am Nil getan und nicht diskutiert wurde, so entstanden auch die frühen Epen und Idyllen, wie sie jede Kultur besitzt, nicht in poetischer Wortkunst, sondern in Stein. Die 5. und 6. Dynastie entspricht hierin der Zeit Homers, des Nibelungenliedes und des Parzival. Damals entstanden die Reliefreihen der großen Tempel. Etwas so Lebensprühendes, von einer so kindlichen und köstlichen Laune Erfülltes wie diese steinernen Idyllen von 2700 v. Chr. mit ihren Jagden, Fischzügen, Hirtenszenen, mit Zank und Spiel, Festen und Familienszenen, Spazierfahrten, Bildern von Ackerbau und tätigem Gewerbe, die das ganze Leben in heiterster Kraft und Fülle, ohne nachdenkliche — homerische — Reflexion, in graziösester Sinnlichkeit erzählen, ist ohne Beispiel. Man spricht so oft von der Heiterkeit der Menschen anderer Kulturen und nennt neben Homer Theokrit, neben Walter von der Vogelweide womöglich Rabelais oder Mozart. Aber dies haben die Hellenen in ihren höchsten Momenten nicht erreicht, von Florentinern und Niederländern, Raffael und Rubens zu schweigen. Das ist „Glück“. Erst dies macht die Symbolik der Pyramidentempel vollkommen. Neben dem architektonischen Formelement, das die Idee des Todes begreift und überwindet, steht das lyrische, imitative, welches das Leben in Gestalt bringt. Im Gotischen hat das eine in den Domen, das andre in den epischen Dichtungen getrennte Formenwelten geschaffen; hier ist eine erhabene[S. 281] Einheit durch die Beziehung auf das Symbol des Weges gewahrt.
Goethe hat einmal das Glück seiner Existenz in den Ausspruch gefaßt: „Als ich achtzehn Jahre war, war Deutschland auch erst achtzehn.“ Unter allen Kulturen ist vielleicht nur die ägyptische sich dieses Glückes bewußt geworden. Als sie geboren wurde, begann die höhere Menschlichkeit überhaupt. Diese Idyllen, eine imitative, nicht symbolische Kunst, entsprangen aus der Weltsehnsucht der jungen Kultur, aus der reinen Freude am aufsteigenden Leben. Tiefe, klare, durch keinen Anblick älterer, absterbender Kulturen getrübte Heiterkeit — den Griechen stand schon der greisenhafte Orient, uns der Untergang des „Altertums“ vor Augen — hellste Geistigkeit, Vollgefühl eigner Kraft, Beherrschtheit, Gewißheit des Ziels, der erreichten und gewohnten strengen Ordnung und Disziplin,[65] keine schwermütigen Träume, keine verflatternden Wünsche, kein ängstliches stoisches Sichbescheiden, nichts von dem etwas gewollten Lachen der Renaissance oder der am Entbehren gereiften γαλήνη der perikleischen Zeit, sondern naives, gefühltes, unreflektiertes Glück — das alles liegt in der Sprache dieser Reliefs, die den Weg zur Totenkammer der Könige schmücken.
Der ägyptische Stil ist der Ausdruck einer tapferen Seele. Seine Strenge und Wucht ist vom ägyptischen Menschen nie empfunden und betont worden. Man wagte alles, aber man schwieg darüber. In der Gotik und im Barock wird die Überwindung des Schweren zum stets bewußten Motiv der Formensprache. Das Drama Shakespeares redet laut von den verzweifelten Kämpfen zwischen Wille und Welt. Der antike Mensch war den „Mächten“ gegenüber schwach. Die κάθαρσισ von Furcht und Mitleid, das Aufatmen der apollinischen Seele im Augenblick der Peripetie war nach Aristoteles die Wirkung der attischen Kulttragödie. Indem der Grieche das Schauspiel vor sich hatte, wie jemand, den er kannte — denn jeder kannte den[S. 282] Mythus und lebte mit ihm, in ihm — und der vom Geschick sinnlos zertreten wurde, ohne daß ein Widerstand gegen die Mächte denkbar war, in prachtvoller Haltung, trotzend, heroisch untergeht, erfolgte tatsächlich in seiner euklidischen Seele eine wunderbare Erhebung. War das Leben nichts wert, so war es doch die große Geste, mit der man es verlor. Man wollte und wagte nichts, aber man fand eine berauschende Schönheit im Ertragen. Schon die Gestalt des Odysseus, in viel höherem Grade das Urbild des hellenischen Menschen als Achill, zeugt davon. Die Moral der Cyniker, der Stoa. Epikurs, das allgemeine hellenische Ideal der σωφροσύνη und ἀταραξία, Diogenes in seinem Fasse, der θεωρία huldigend, — das alles ist verkappte Feigheit und sehr verschieden von dem Stolz der ägyptischen Seele; der apollinische Mensch geht dem Leben im Grunde aus dem Wege, bis zum Selbstmord, der in dieser Kultur allein den Rang eines positiv ethischen Aktes erhielt und mit der Feierlichkeit eines sakralen Symbols behandelt wurde; der dionysische Rausch erscheint der gewaltsamen Übertäubung von etwas verdächtig, das die ägyptische Seele gar nicht kannte. Die griechische Architektur mit ihrem Gleichmaß von Stütze und Last und den ihr eigentümlichen kleinen Maßstäben wirkt wie eine ständige Ausflucht vor schweren tektonischen Problemen, die man am Nil und später am Rhein mit einer Art von dunklem Pflichtgefühl geradezu aufsuchte und die man in der mykenischen Zeit gekannt und sicherlich nicht vermieden hat. Der Ägypter liebte das harte Gestein massiger Bauten; es entsprach seinem Selbstbewußtsein, nur das Höchste als Aufgabe zu wählen; der Grieche mied es. Es ist sehr merkwürdig, wie er als Erbe der hochentwickelten mykenischen Steinbehandlung, noch dazu in einem felsigen, kaum waldreichen Lande, zur Verwendung des Holzes zurückkehrte. Die Absicht auf Dauer gehört nicht zu den Tendenzen seiner Technik. Erst suchte seine Baukunst kleine Aufgaben, dann hörte sie ganz auf. Vergleicht man sie in ihrem vollen Umfange mit der Gesamtheit der indischen, ägyptischen oder gar abendländischen, so ist man über die Geringfügigkeit des Phänomens erstaunt. Mit einigen Variationen des dorischen Tempeltyps ist sie erschöpft und mit der Erfindung des korinthischen Kapitäls (um 400) abgeschlossen. Alles Spätere ist Kombination von Vorhandenem.
[S. 283]
Der Stil — wie die Handschrift — verschweigt nichts. Das antike Sein, mag man noch so sehr an die Überfülle seiner Vitalität glauben, erhält sich nur durch eine bewunderungswürdige Weisheit der Beschränkung. Es hatte seelisch nichts zu verschwenden. Es hält sich an das Jetzt und Hier der Vordergründe des Lebens, ohne die Fernen von Geburt und Tod, Vergangenheit und Zukunft, deren Assimilation eine ganz andere Willenskraft und Stärke des Seelischen voraussetzt, in das Bild der Welt einzubeziehen, Fernen, an die noch der urhellenische Mythus, dessen letzte lebendige Spuren man bei Äschylus findet, tiefsinnig angeknüpft hatte.
Dies liegt in dem apollinischen Prinzip der Vereinzelung der Kunstwerke und Lebensformen. Damit wird die Historie so gut wie die räumliche Weite abgelehnt. Ein Tempel, eine Statue, eine Stadt, lauter punktförmige Einheiten, in die das Sein sich zurückzieht wie die Schnecke in ihr Haus. Jede andre Kultur kennt politische Fernwirkungen, Kolonien und Kolonialreiche. Aber diese Hunderte von winzigen Griechenstädten sind ebensoviele politische Punkte, „wie ein hellenischer Saum — nach Cicero — den Landschaften der Barbaren angewebt“. Jeder Versuch, eine Einwirkung im Sinne der Ausbildung eines größeren politischen Organismus auf die Pflanzstädte auszuüben, führte sofort zu wütenden Kriegen (Korinth und Korkyra um 670). Jeder Tempel mit seiner Priesterschaft bildet ein religiöses Atom. Man ist auf das Groteske dieser Erscheinung kaum recht aufmerksam geworden. Narren haben darin die „gesunde Abneigung der Hellenen gegen den Klerikalismus“ gefunden. Obwohl Apollo und Athene dem Namen nach allgemein hellenische Gottheiten sind, besitzen sie keinen allgemeinen Kultus. Man lasse sich nicht durch die Dichtung täuschen. Die großen Götternamen waren bis zu einem gewissen Grade (durchaus nicht ganz) Gemeingut, aber das mit dem Worte Apollo bezeichnete numen war an jedem Orte etwas Selbständiges. Die Zeusheiligtümer von Dodona, Olympia und andern Orten sind ohne jede Verbindung miteinander und ebenso die Tempel verschiedener Götter in derselben Stadt. Von einer religiösen Gemeinschaft im Sinne der Priesterschaft des Ra, der Mithrasreligion, der altpersischen, altchristlichen Gemeinschaften oder der Sekten[S. 284] des Islam und des Protestantismus ist selbst bei den Orphikern und im Pythagoräerbunde nicht die Rede. Aber eben das ist auch der Grundzug der attischen Plastik, der frei im Raum stehenden, vollkommen beziehungslosen Statue. Und er wiederholt sich in jedem antiken Stadtbilde. Keine großgedachten Straßenzüge, kein planmäßig ausgebauter Platz; ein wirres Durcheinander von Gebäuden und Bildwerken auf der Akropolis wie in den Weihbezirken von Delphi und Olympia, bis der großstädtische Hellenismus an der Nachahmung orientalischer, von einem Gesamtgeist geregelter Stadtpläne Geschmack fand.
Der Organismus historischer Stilfolgen wird nun übersehbar geworden sein. Stile folgen nicht aufeinander wie Wellen und Pulsschläge. Mit der Persönlichkeit einzelner Künstler, ihrem Willen und Bewußtsein haben sie nichts zu schaffen. Im Gegenteil, das Medium des Stils liegt seinerseits dem Phänomen der künstlerischen Individualität a priori zugrunde. Der Stil ist wie die Kultur ein Urphänomen im strengsten Sinne Goethes, sei es der Stil von Künsten, staatlichen Bildungen, Gedanken, Gefühlen, Ausdrucksformen des religiösen Bewußtseins oder einer andern Gruppe von Wirklichkeiten. So gut „Natur“ ein immer neues Erlebnis des Menschen ist, als der umfassende Ausdruck der augenblicklichen Beschaffenheit seines Werdens, als sein alter ego und Spiegelbild, so der Stil. Deshalb kann es im historischen Gesamtbilde einer Kultur nur einen, den Stil dieser Kultur geben. Es war falsch, bloße Stilphasen, wie Romanik, Gotik, Barock, Rokoko, Empire als Stile zu unterscheiden und mit Einheiten von ganz anderem Range wie dem ägyptischen, dorischen oder maurischen Stil oder gar einem „prähistorischen Stil“ gleichzusetzen. Gotik und Barock: das ist Jugend und Alter desselben Inbegriffs von Formen, der reifende und der gereifte Stil des Abendlandes. Es fehlt unsrer Ästhetik in diesem Punkte an Distanz, an der Unbefangenheit des Blickes und dem guten Willen zur Abstraktion. Man hat es sich bequem gemacht und alle stark empfundenen Formdifferenzen unterschiedslos als „Stile“ aufgereiht. Daß auch hier das Schema Altertum-Mittelalter-Neuzeit den Blick endgültig verwirrte, braucht kaum erwähnt zu werden. In der Tat steht selbst ein Meisterwerk der strengsten Renaissance wie der Hof des Palazzo Farnese, der[S. 285] Vorhalle von St. Patroklus in Soest, dem Innern des Magdeburger Doms und den Treppenhäusern süddeutscher Schlösser des 18. Jahrhunderts unendlich viel näher als dem Tempel von Pästum oder dem Erechtheion. Dasselbe Verhältnis besteht zwischen Dorik und Ionik. Deshalb kann die ionische Säule mit dorischen Bauformen eine ebenso vollkommene Verbindung eingehen wie Spätgotik und frühes Barock in St. Lorenz zu Nürnberg oder späte Romanik mit spätem Barock in dem schönen Oberteil des Mainzer Westchores. Deshalb hat unser Auge noch kaum gelernt, im ägyptischen Stil die der dorisch-gotischen Jugend und dem ionisch-barocken Alter entsprechenden Elemente des Alten und des Mittleren Reiches zu unterscheiden, die seit der 12. Dynastie sich in der Formensprache aller größeren Werke mit vollkommener Harmonie durchdringen.
Der Kunstgeschichte steht die Aufgabe bevor, die vergleichenden Biographien der großen Stile zu schreiben. Sie haben alle, als Organismen derselben Gattung, eine Lebensgeschichte von verwandter Struktur.
Am Anfang steht der verzagte, demütige, reine Ausdruck einer eben erwachenden Seele, die noch nach einem Verhältnis zur Welt sucht, der sie, obwohl einer eigenen Schöpfung, doch fremd und befremdet gegenüber steht. Es liegt Kinderangst in den Bauten des Bischofs Bernward von Hildesheim, in der altchristlichen Katakombenmalerei und den Pfeilersälen vom Anfang der 4. Dynastie. Ein Vorfrühling der Kunst, ein tiefes Ahnen künftiger Gestaltenfülle, eine mächtige verhaltene Spannung liegt über der Landschaft, die sich, noch ganz bäuerlich, mit den ersten Burgen und kleinen Städten schmückt. Dann folgt der jauchzende Aufschwung in der hohen Gotik, den Hochreliefs der konstantinischen Zeit mit ihren Säulenbasiliken und Kuppelkirchen und den reliefgeschmückten Tempeln der 5. Dynastie. Man begreift das Sein; der Glanz einer vollkommen gemeisterten wunderbaren Formensprache breitet sich aus und der Stil reift zu einer majestätischen Symbolik der Tiefe und des Schicksals heran. Aber der jugendliche Rausch geht zu[S. 286] Ende. Aus der Seele selbst erhebt sich Widerspruch. Renaissance, dionysisch-musikalische Feindschaft gegen die apollinische Dorik, der ägyptisierende Stil im Byzanz von 450 gegenüber der heiter-lässigen antiochenischen Kunst bedeuten eine Phase der Auflehnung und versuchten oder erreichten Zerstörung des Erworbenen, deren sehr schwierige Erörterung hier nicht am Platze ist.
Damit tritt das Mannesalter des Seelentums in Erscheinung. Die Kultur wird zum Geiste der großen Städte, die jetzt die Landschaft beherrschen; sie durchgeistigt auch den Stil. Die erhabene Symbolik verblaßt; das Ungestüm übermenschlicher Formen geht zu Ende; mildere weltlichere Künste verdrängen die große Kunst des gewachsenen Steins; selbst in Ägypten wagen Plastik und Fresko sich etwas leichter zu bewegen. Der Künstler erscheint. Er „entwirft“ jetzt, was bis dahin aus dem Boden wuchs. Noch einmal steht das Dasein, das bewußt gewordne, vom Ländlich-Traumhaften und Mystischen gelöst, fragwürdig da und ringt nach einem Ausdruck seiner neuen Bestimmung: zu Beginn des Barock, wo Michelangelo in wildem Unbefriedigtsein und sich gegen die Schranken seiner Kunst bäumend die Peterskuppel auftürmt, zur Zeit Justinians I., wo seit 520 die Hagia Sophia und die mosaikgeschmückten Kuppelbasiliken von Ravenna entstehen, im Ägypten der Zeit vor 2000 und um 600 in Hellas, wo viel später noch Äschylus verrät, was eine hellenische Architektur in dieser entscheidenden Epoche hätte ausdrücken können und müssen.
Dann erscheinen die leuchtenden Herbsttage des Stils: noch einmal malt sich in ihm das Glück der Seele, die sich ihrer letzten Vollkommenheit bewußt wird. Die „Rückkehr zur Natur“, damals schon als nahe Notwendigkeit von Denkern und Dichtern, von Rousseau, Gorgias und den „Gleichzeitigen“ der andern Kulturen gefühlt und angekündigt, verrät sich in der Formenwelt der Künste als empfindsame Sehnsucht und Ahnung des Endes. Hellste Geistigkeit, heitre Urbanität und Wehmut eines Abschiednehmens: von diesen letzten farbigen Jahrzehnten der Kultur hat Talleyrand später gesagt: „Qui n’a pas vécu avant 1789, ne connait pas la douceur de vivre.“ So erscheint die freie, sonnige, raffinierte Kunst zur Zeit der Sesostris und[S. 287] Amenemhet (nach 2000). Dieselben kurzen Momente gesättigten Glücks tauchen auf, als unter Perikles die bunte Pracht der Akropolis und die Werke des Phidias und Praxiteles entstanden. Wir finden sie ein Jahrtausend später zur Abassidenzeit in der heitern Märchenwelt maurischer Bauten mit ihren fragilen Säulen und Hufeisenbögen, die sich im Leuchten der Arabesken und Stalaktiten in die Luft auflösen möchten, und wieder ein Jahrtausend darauf in der Kammermusik Haydns und Mozarts, den Schäfergruppen von Meißner Porzellan, den Bildern Watteaus und Guardis und den Werken deutscher Baumeister in Dresden, Potsdam, Würzburg und Wien.
Dann erlischt der Stil. Auf die bis zum äußersten Grade durchgeistigte, zerbrechliche, der Selbstvernichtung nahe Formensprache des Erechtheion und des Dresdner Zwingers folgt ein matter und greisenhafter Klassizismus, in hellenistischen Großstädten ebenso wie im Byzanz von 900 und im Empire des Nordens. Ein Hindämmern in leeren, ererbten, in archaistischer oder eklektischer Weise vorübergehend wieder belebten Formen ist das Ende. Gewaltsam in Szene gesetzte „Stile“ und exotische Entlehnungen sollen den Mangel an Schicksal, an innerer Notwendigkeit ersetzen. Halber Ernst und fragwürdige Echtheit beherrschen das Künstlertum. In diesem Falle befinden wir uns heute. Es ist ein langes Spielen mit toten Formen, an denen man sich die Illusion einer lebendigen Kunst erhalten möchte.
Erst wenn man sich von der Täuschung jener antiken Kruste befreit hat, die mit einer solchen archaistischen und eklektischen Fortsetzung innerlich längst erstorbener Kunstübungen den jungen Orient in der Kaiserzeit überlagert; wenn man in der altchristlichen Kunst und in allem, was in der spätrömischen wirklich lebendig ist, die Frühzeit des arabischen Stils erkannt hat; wenn man in der Epoche Justinians I. das genaue Seitenstück des spanisch-venezianischen Barock wiederfindet, wie es unter den großen Habsburgern Karl V. und Philipp II. Europa beherrschte; in den Palästen von Byzanz mit ihren mächtigen Schlachtenbildern und Prunkszenen, deren längst[S. 288] untergegangene Pracht höfische Literaten wie Prokop von Cäsarea in euphuistisch schwülstigen Reden und Versen feiern, Madrid, Rubens und Tintoretto; erst dann gewinnt das bisher als Einheit nicht begriffene Phänomen der arabischen Kunst — das volle erste Jahrtausend unserer Zeitrechnung umfassend — Gestalt. Da es an entscheidender Stelle im Bilde der Gesamtkunstgeschichte steht, so hat das bisher waltende Mißverständnis die Erkenntnis der organischen Zusammenhänge überhaupt verhindert.
Merkwürdig und für den, der hier einen Blick für bisher unbekannte Dinge gewonnen hat, ergreifend ist es zu sehen, wie diese junge Seele, vom Geist der antiken Zivilisation in Fesseln gehalten, unter den Eindrücken vor allem der politischen Allmacht Roms es nicht wagte, sich frei zu regen, wie sie demütig sich veralteten und fremden Formen unterwarf und sich mit griechischer Sprache, griechischen Ideen und Kunstelementen zu bescheiden suchte. Die inbrünstige Hingabe an die Mächte der jungen Tageswelt, wie sie die Jugend jeder Kultur bezeichnet, die Demut des gotischen Menschen in seinen frommen, hochgewölbten Räumen mit den Pfeilerstatuen und lichterfüllten Glasgemälden, die hohe Spannung der ägyptischen Seele inmitten ihrer Welt der Pyramiden, Lotossäulen und Reliefsäle am Nil mischt sich hier mit einem geistigen Niederknien vor erstorbenen Formen, die man für ewig hielt. Daß ihre Herübernahme und Weiterbildung trotzdem nicht gelang, daß wider Willen und unvermerkt, ohne den Stolz der Gotik auf das Eigne, das man hier, im Syrien der Kaiserzeit, fast beklagte und als Verfall empfand, eine geschlossene neue Formenwelt emporstieg und mit ihrem Geiste — unter der Maske griechisch-römischer Baugewohnheiten — selbst Rom erfüllte, wo syrische Meister am Pantheon und den Kaiserforen arbeiteten, das beweist wie kein zweites Beispiel die Urkraft eines jungen Seelentums, das seine Welt erst noch zu erobern hat.
Die Seelengeschichte dieser Frühzeit erzählt die Basilika, der Typus der morgenländischen Kirche, von ihrer heute noch rätselhaften Abkunft aus späthellenistischen Formen bis zu ihrer Vollendung im Zentralkuppelbau der Hagia Sophia. Sie ist von Anfang an, und darin liegt das magische Weltgefühl, als Innenraum[S. 289] gedacht. Der antike Tempel war bis zuletzt ein Körper. Aber man kann diese früharabische Kunst nicht verstehen, wenn man sie, wie es heute geschieht, durchaus als altchristliche behandelt und auf die produktiven Grenzen dieser Glaubensgemeinschaft beschränkt. Man müßte dann auch die Kunst des Mithras-, Isis-, Sonnenkultus, der Synagoge des Neuplatonismus zunächst für sich, nach Architektur, Symbolik und Ornament behandeln und dann aus der Gruppe dieser Äußerungen eines und desselben Kunstwollens das Früharabische als Einheit destillieren. Aber die Macht der antiken Vormundschaft hat es beinahe niemals ganz rein hervortreten lassen. Die frühchristlich-spätantike Kunst zeigt dieselbe ornamentale und figürliche Mischung von ererbtem Fremden und eben geborenem Eignen wie die karolingisch-frühromanische. Dort mischt sich Hellenistisches mit Frühmagischem, hier Maurisch-Byzantinisches mit Faustischem. Der Forscher muß Linie für Linie, Ornament für Ornament auf das Formgefühl hin untersuchen, um die beiden Schichten voneinander zu trennen. In jedem Architrav, jedem Fries, jedem Kapitäl findet ein heimliches Ringen zwischen dem gewollten alten und den ungewollten, aber siegreichen neuen Formen statt. Überall wirkt das Sichdurchdringen späthellenistischen und früharabischen Formgefühls verwirrend, in den Bildnisbüsten der Stadt Rom, wo oft nur die Haarbehandlung der neuen Formweise angehört, in den Akanthusranken oft ein und desselben Frieses, wo die Arbeit des Meißels und des Tiefbohrers nebeneinander stehen, in den Sarkophagen des 2. Jahrhunderts, wo eine primitive Stimmung in der Art Giottos und Pisanos sich mit einem gewissen späten großstädtischen Naturalismus, bei dem man etwa an David oder Carstens denkt, kreuzt, und in Bauten wie dem von einem Syrer erbauten Pantheon — der Urmoschee! —, der Basilika des Maxentius und dem Trajansforum neben manchen noch sehr antik empfundenen Teilen der Thermen und Kaiserfora, dem Forum des Nerva z. B.
Trotzdem ist das arabische Seelentum um seine Blüte betrogen worden, wie ein junger Baum, den ein gestürzter Urwaldstamm im Wachsen hindert und verkümmern läßt. Hier findet sich keine leuchtende Epoche, die als solche gefühlt und erlebt wurde wie damals, als mit den Kreuzzügen zugleich die[S. 290] Holzdecken der Dome sich zu Kreuzgewölben schlossen und die Idee des unendlichen Raumes durch ihr Inneres verwirklicht und vollendet wurde. Die politische Schöpfung Diokletians — des ersten Kalifen — wurde durch die Tatsache in ihrer Schönheit gebrochen, daß es die ganze Masse stadtrömischer Verwaltungspraktiken war, die er, auf antikem Boden, als gegeben anerkennen mußte und die sein Werk zu einer bloßen Reform verjährter Zustände herabsetzte. Und doch tritt mit ihm die Idee des arabischen Staates ans Licht. Erst aus ihm und dem politischen Typus des eben damals entstandenen Sassanidenreiches zusammen läßt sich das Ideal ahnen, das hier zur Entfaltung hätte kommen sollen. Und so war es überall. Man hat bis zum heutigen Tage als letzte Schöpfungen der Antike bewundert, was sich selbst nicht anders aufgefaßt wissen wollte: Das Denken Plotins und Mark Aurels, die Kulte der Isis, des Mithras, des Sonnengottes, die diophantische Mathematik und die gesamte Kunst, welche die Renaissance nachher unter Ausscheidung alles echt Griechischen als „antik“ wieder aufleben läßt.
Dies allein erklärt die ungeheure Vehemenz, mit welcher die durch den Islam endlich befreite und entfesselte arabische Kultur sich auf alle Länder warf, die ihr seit Jahrhunderten innerlich zugehörten, das Zeichen einer Seele, die fühlt, daß sie keine Zeit zu verlieren hat, die voller Angst die ersten Spuren des Alters bemerkt, bevor sie eine Jugend hatte. Diese Befreiung des magischen Menschentums ist ohne Gleichen. Syrien wird 634 erobert, man möchte sagen erlöst, Damaskus 635, Ktesiphon 637. 641 wird Ägypten und Indien erreicht, 647 Karthago, 676 Samarkand, 710 Spanien; 732 stehen die Araber vor Paris. So drängt sich hier in der Hast weniger Jahre die ganze Summe aufgesparter Leidenschaft, verspäteter Schöpfungen, zurückgehaltener Taten zusammen, mit denen andre Kulturen, langsam aufsteigend, die Geschichte von Jahrhunderten füllen konnten. Die Kreuzfahrer vor Jerusalem, die Hohenstaufen in Sizilien, die Hansa in der Ostsee, die Ordensritter im slawischen Osten, die Spanier in Amerika, die Portugiesen in Ostindien, das Reich Karls V., in dem die Sonne nicht unterging, die Anfänge der englischen Kolonialmacht unter Cromwell — das alles sammelt[S. 291] sich in der einen Entladung, welche die Araber nach Spanien, Frankreich, Indien und Turkestan führte.
Es ist wahr: Alle Kulturen mit Ausnahme der ägyptischen und vielleicht der chinesischen haben unter der Vormundschaft älterer Kultureindrücke gestanden; fremde Elemente erscheinen in jeder dieser Formenwelten. Die faustische Seele der Gotik, schon durch die arabische Herkunft des Christentums in der Richtung ihrer Ehrfurcht geleitet, griff nach dem reichen Schatz spätarabischer Kunst. Das Arabeskenwerk einer unleugbar südlichen, ich möchte sagen Arabergotik umspinnt die Fassaden der Kathedralen von Burgund und der Provence, beherrscht die Sprache des Straßburger Münsters mit einer Magie in Stein und führt überall, an Statuen und Portalen, in Gewebemustern, Schnitzereien, Metallarbeiten, nicht zum wenigsten in den krausen Figuren des scholastischen Denkens und einem der höchsten abendländischen Symbole, der Sage vom heiligen Gral,[66] einen stillen Kampf mit dem nordischen Urgefühl einer Wikingergotik, wie sie im Innern des Magdeburger Domes, der Spitze des Freiburger Münsters und der Mystik Meister Eckarts herrscht. Der Spitzbogen droht mehr als einmal seine bindende Linie zu sprengen und in den Hufeisenbogen maurisch-normannischer Bauten überzugehen.
Die apollinische Kunst der dorischen Frühzeit, deren erste Intentionen fast verschollen sind, hat ohne Zweifel ägyptische Formen wie den Typus der frontalen Statue und das Motiv der Säulenreihe herübergenommen, um an ihnen zu einer eignen Symbolik zu gelangen. Nur die magische Seele wagte es nicht, die Mittel sich anzueignen, ohne sich ihnen hinzugeben, und das macht die Psychologie des arabischen Stils so unendlich aufschlußreich.
So erwächst aus der Idee des Makrokosmos, die im Stilproblem vereinfacht und faßlicher vor Augen tritt, eine Fülle von Aufgaben, deren Behandlung der Zukunft angehört. Die[S. 292] Formenwelt der Künste für eine Durchdringung des Seelischen nutzbar zu machen, indem man sie durchaus physiognomisch und symbolisch auffaßt, ist ein Unternehmen, dessen bisher gewagte Versuche von unverkennbarer Dürftigkeit sind. Man weiß nichts von einer wirklichen Psychologie der architektonischen Grundformen. Man ahnt nicht, welche Aufschlüsse in dem Bedeutungswandel liegen, den eine solche Form bei der Übernahme durch eine andere Kultur erfährt. Die Seelengeschichte der Säule ist noch nie erzählt worden. Man hat keinen Begriff von der Tiefe einer Symbolik der Kunstmittel, der Kunstwerkzeuge. Ich deute hier nur einzelnes an, um diese Fragen einer späteren Erörterung vorzubehalten.
Da sind die Mosaiken, die in hellenischer Zeit, aus Marmorstücken, undurchsichtig, leibhaft-euklidisch gebildet, wie die berühmte Alexanderschlacht in Neapel den Fußboden verzierten, die aber mit dem Erwachen der arabischen Seele, nunmehr aus Glasstiften zusammengesetzt und mit einer Unterlage von Goldschmelz, die Wände und Decken der Kuppelbasiliken gleichsam verhüllen. Diese früharabische, von Syrien ausgehende Mosaikmalerei entspricht durchaus der Stufe nach den Glasgemälden gotischer Dome; es sind zwei frühe Künste im Dienste der religiösen Architektur. Die eine weitet den Kirchenraum durch das einströmende Licht zum Weltraum, die andere verwandelt ihn in jene magische Sphäre, deren Goldflimmer aus der irdischen Wirklichkeit zu den Visionen Plotins, des Origenes, der Manichäer, Gnostiker und Kirchenväter und der apokalyptischen Dichtungen — von der des Johannes bis zu der des Styliten Ephraim im 4. Jahrhundert — entrückt.
Da ist das prachtvolle Motiv der Verbindung des Rundbogens mit der Säule, ebenfalls eine syrische Schöpfung des 3. — „hochgotischen“ — Jahrhunderts. Die eminente Bedeutung dieses spezifisch magischen Motivs, das allgemein als antik gilt und für die meisten die Antike geradezu repräsentiert, ist bisher nicht im entferntesten erkannt worden. Der Ägypter hatte seine Pflanzensäulen ohne tiefere Beziehung zur Decke gelassen. Sie repräsentierten das Wachstum, nicht die Kraft. Die Antike, für welche die monolithe Säule das stärkste Symbol euklidischen Daseins war, ganz Körper, ganz Einheit und Ruhe, verband sie in strengem Gleichmaß von Vertikale und Horizontale, von Kraft und Last, mit dem Architrav. Hier[S. 293] aber — das von der Renaissance mit tragikomischem Irrtum als echt antik bevorzugte Motiv, das die Antike gar nicht besaß und nicht besitzen konnte! — wächst unter Verleugnung des stofflichen Prinzips der Last und Trägheit der lichte Bogen aus schlanken Säulen auf; die hier verwirklichte Idee der Lösung von aller Erdenschwere ist mit der gleichzeitigen der frei über dem Boden schwebenden Kuppel aufs tiefste verwandt, ein magisches Motiv von stärkster Kraft des Ausdrucks, das seine Vollendung folgerichtig im maurischen „Rokoko“ der Moscheen, z. B. der von Cordova fand, wo überirdisch zarte Säulen, oft ohne Basis aus dem Boden wachsend, nur durch einen geheimen Zauber fähig erscheinen, diese ganze Welt zahlloser gekerbter Bögen, leuchtender Ornamente, Stalaktiten und farbensatter Gewölbe zu tragen. Man kann, um die ganze Bedeutung dieser architektonischen Grundform der arabischen Kunst herauszuheben, die Verbindung von Säule und Architrav das apollinische, die von Säule und Rundbogen das magische, die von Pfeiler und Spitzbogen das faustische Leitmotiv nennen.
Nehmen wir ferner die Geschichte des Akanthusmotivs. In der Form, wie es z. B. am Lysistratesdenkmal erscheint, ist es eines der bezeichnendsten der antiken Ornamentik. Es hat Körper. Es bleibt Einzelding. Es ist mit einem Blick in seiner Struktur zu erfassen. Schon in der Kunst der römischen Kaiserfora (des Nerva, des Trajan), am Mars-Ultortempel erscheint es schwerer und reicher. Die organische Gliederung wird so kompliziert, daß sie in der Regel studiert sein will. Die Tendenz, die Fläche zu füllen, tritt hervor. In der byzantinischen Kunst — von deren „latentem sarazenischem Zuge“ schon A. Riegl spricht, ohne den hier aufgedeckten Zusammenhang zu ahnen — wird das Akanthusblatt in ein unendliches Rankenwerk zerlegt, das wie in der Hagia Sophia völlig unorganisch ganze Flächen deckt und überzieht. Zu dem antiken Motiv treten die ursemitischen des Weinlaubs und der Palmette, die schon im altjüdischen Ornament eine Rolle spielen. Die Flechtbandmuster „spätrömischer“ Mosaikfußböden und Sarkophagkanten, auch geometrische Flächenmuster werden aufgenommen und endlich entsteht in Syrien und dem Sassanidenreich bei steigender Bewegtheit und verwirrender Wirkung die Arabeske. Sie ist, antiplastisch[S. 294] bis zum Äußersten, das eigentlich magische Motiv. Selbst unkörperlich, entkörpert sie den Gegenstand, den sie in endloser Fülle überzieht. Ein Meisterwerk dieser Art, ein Stück Architektur, das völlig der Ornamentik unterworfen ist, stellt die Fassade des von den Ghazaniden erbauten Wüstenschlosses M’schatta (jetzt in Berlin) dar. Die über das ganze Abendland verbreitete und das Karolingerreich völlig beherrschende Kunst byzantinisch-islamitischen Stils wird größtenteils von orientalischen Künstlern gepflegt oder als Ware importiert. Ravenna, Lucca, Venedig, Granada sind die Wirkungszentren dieser damals hochzivilisierten Formensprache, die in Italien noch um 1000 ausschließlich galt, als im Norden die Formen einer neuen Kultur schon fertig und gefestigt waren.
Endlich die veränderte plastische Auffassung des menschlichen Körpers. Sie erfährt mit dem Siege des arabischen Weltgefühls eine völlige Umkehrung. Fast in jedem Römerkopfe der vatikanischen Sammlung, der zwischen 100 und 250 entstanden ist, läßt sich der Gegensatz von apollinischem und magischem Gefühl, zwischen der Fundamentierung des Ausdruckes in der Lagerung der Muskelpartien oder im „Blick“ feststellen. Man arbeitet — in Rom selbst seit Hadrian — vielfach mit dem Steinbohrer, einem Werkzeug, das dem euklidischen Gefühl dem Stein gegenüber völlig widerspricht. Das Körperhafte, Stoffliche des Marmorblocks wird durch die Arbeit mit dem Meißel, der die Grenzflächen heraushebt, bejaht, durch den Bohrer, der die Flächen bricht und damit Helldunkelwirkungen schafft, verneint. Dementsprechend erlischt, gleichviel ob bei „heidnischen“ oder christlichen Künstlern, der Sinn für die Erscheinung des nackten Körpers. Man betrachte die flachen und leeren Antinousstatuen, die doch entschieden antik gemeint waren. Hier ist nur der Kopf physiognomisch bemerkenswert, was in der attischen Plastik nie der Fall ist. Die Gewandung erhält einen ganz neuen Sinn, der die Erscheinung schlechthin beherrscht. Die Konsularstatuen auf dem Kapitol sind vorzügliche Beispiele. Durch die gebohrten Pupillen der ins Weite gerichteten Augen wird der gesamte Ausdruck dem Körper entzogen und in jenes „pneumatische“, magische Prinzip gelegt, das der Neuplatonismus und die Beschlüsse der christlichen Konzilien nicht weniger als die Mithrasreligion und der stadtrömische Isiskult im Menschen voraussetzen.
[59] Wir wissen heute, daß der Dichter dieser Iliaspartie mykenische Kunstwerke vor Augen hatte, deren Sinn er vielfach falsch verstand.
[60] So wirkt die Angst noch in späten Zuständen. Alle furchtsamen Menschen sind konventionell. Alle sozialen Konventionen repräsentieren die Furcht eines Standes vor dem Unvorhergesehenen.
[61] Auch die sozialen Konventionen spätester Zeiten haben den Charakter eines Opfers nicht ganz verloren. In der französischen Verfassungsgeschichte seit 1789 liegt ein Schatten der Fabel vom Ring des Polykrates.
[62] Die syrischen Sonnenkulte gehören wie der Mithras- und Serapiskult neben dem Urchristentum zu den früharabischen Religionen magischen Stils. Außer dem Tempel von Baalbek, der trotz völlig antiker Details mit seinen Innenhöfen als Ganzes einen neuen Baugedanken, ein neues Weltgefühl ausdrückt, hatten auch das Serapeion zu Milet und die große Synagoge zu Alexandria eine hohe formale Verwandtschaft mit dem altchristlichen Basilikentypus.
[63] Es steht mir außer Zweifel, daß die Griechen, als sie vom Antentempel zum Peripteros kamen, zur selben Zeit, wo die Rundplastik sich ebenfalls an unzweifelhaft ägyptischen Vorbildern vom Reliefmäßigen emanzipierte (Apoll von Tenea), unter dem mächtigen Eindruck ägyptischer Säulenreihen standen. Das läßt die Tatsache unberührt, daß das Motiv der antiken Säule und die antike Verwendung des Reihenprinzips etwas vollkommen Selbständiges sind.
[64] Die Klarheit in der Anlage der ägyptischen und abendländischen Geschichte gestattet einen bis ins einzelne gehenden Vergleich, der wohl einer kunsthistorischen Untersuchung wert wäre. Die 4. Dynastie des strengen Pyramidenstils (2930–2750, Cheops, Chephren) entspricht der Romanik und Frühgotik (900–1100); die 5. Dynastie (2750–2625, Sahu-rê) der Hochgotik (1100 bis 1250); die 6. Dynastie, die Blütezeit der archaischen Bildniskunst (2625 bis 2475, Phiops I. und II.) der späten Gotik (1250–1400).
[65] Wie die vornehme Welt des 18. Jahrhunderts die vollkommene, leichte und selbstverständliche Beherrschung guter Formen genoß.
[66] Die Gralssage enthält neben altkeltischen starke arabische Gefühlsmomente, aber die Gestalt Parzevals, dort, wo Wolfram von Eschenbach über sein Vorbild Chrestien hinausgeht, ist rein faustisch.
[S. 295]
[S. 297]
Am Anfang einer Betrachtung, für die nicht Entstehung und Sinn von Kunstwerken, sondern von Kunstgattungen Problem ist, wird eine Andeutung dessen notwendig, was unter Kunstform verstanden werden soll, insofern es sich nämlich nicht um Mittel und Ziele des persönlichen, bewußten Kunstwollens, sondern um den Drang ganzer Zeitalter handelt, der sich in einer Richtung bewegt, die niemand kennt und will und der jeder Einzelne trotzdem unterworfen ist. Definitionen und ästhetische Thesen sind hier gleich unzulänglich. Wer auch das Wort Kunstform gebrauchte, hat nicht hindern können, daß jeder dabei an etwas anderes dachte. Es gibt ohne Zweifel überall, wo eine lebendige Kunst ausgeübt wird, eine gewisse Summe formaler Grundsätze, nenne man sie Kanon, Tradition, Schule, die gelehrt und gelernt werden kann, deren Beherrschung Meisterschaft verleiht und deren Entwicklung mancher ausschließlich im Auge hat, wenn er seinem Buche den Titel Kunstgeschichte gibt. Ästhetik und Philosophie haben sich immer darin gefallen, dies kommensurable Element in ein System zu bringen.
Das eigentliche Geheimnis der Form scheint auf diesem Wege aber eher verfehlt als erreicht. Ein Kunstwerk ist etwas Unendliches. Es enthält die ganze Welt in sich. Es ist, wenn es überhaupt Bedeutung besitzt und nicht lediglich ein gewolltes und geleistetes Stück Arbeit darstellt, ein Mikrokosmos, unerschöpflich im ganzen und begreiflich nur in den vordersten Einzelheiten. Was man an ihm durch den Verstand erfassen und also in ein System bringen kann, gehört zur Oberfläche.[S. 298] Wäre es nicht der eigentliche Sinn der großen Schulen, mit und unter dem Schatz mitteilbarer Fertigkeiten noch etwas ganz anderes weniger zu vererben als zu erwecken, so wäre ihre tatsächlich entscheidende Bedeutung — denn ohne Konvention gibt es keine Kunst — kaum verständlich.
Eine ganz andre Form, Form der Seele, wenn man das Unbeschreibliche so bezeichnen darf, steckt in dem, was die Leute „Inhalt“ nennen. „Ich litt und liebte, das war die eigentliche Gestalt meines Herzens,“ heißt es im Wilhelm Meister, in den Bekenntnissen einer schönen Seele. Es gibt, nicht nur im Bereich der Kunst, Form, die aus der Angst, und Form, die aus der Sehnsucht stammt. Die eine bannt, indem sie Namen nennt und Regeln auferlegt, die andere offenbart. Für jene ist die sinnliche Empfindung Substanz, für diese Medium. Es gibt Künstler, die nur eine von ihnen in der Gewalt haben. Jean Paul ist arm an Form, sobald man an die denkt, welche Racine mit Meisterschaft handhabt. Bei Beethoven droht die eine die andre ständig zu vernichten.
Es gibt eine stets gewordne, also wirkliche, und eine ewig werdende, also unwirkliche Form.[67] Die erste, starre, bedingt das Dasein alles schon Vollendeten, alles dessen, was im Bereiche der natürlichen Welt „ist“. Die Grundregeln einer Fuge oder plastischen Gruppe liegen der Erscheinung der einzelnen Kunstwerke für das Auge oder Ohr in genau derselben Art a priori zugrunde, wie Kants Anschauungsformen und Verstandeskategorien der Erscheinung der natürlichen Dinge. Diese elementare Gestalt, der „Körper“ des Werkes, kausalen Prinzipien — der „künstlerischen Logik“ — unterworfen, durch die jedes Kunstwerk der Wirklichkeit, dem Inbegriff alles Begrenzten und Gesetzten angehört, ist wie alles Wirkliche vergänglich. Es gibt keine „unsterblichen Meisterwerke“. Die letzte Orgel, die letzte Stradivariusgeige wird endlich einmal zertrümmert sein. Die ganze Zauberwelt unsrer Sonaten, Trios, Sinfonien, Arien, deren Formensprache samt der ganzen Fülle eigens für sie erfundener[S. 299] und nur zur faustischen Seele redender Instrumente erst vor wenigen Jahrhunderten entstand, für uns und aus uns heraus, wird wieder verstummen und verschwinden. Denn was wissen wir von der indischen, der chinesischen Musik und den seelischen Erschütterungen, die ihre Regeln weckten? Die höchsten Momente Beethovenscher Melodik und Harmonik, für uns, die Eingeweihten, wundervoll, sind für alle fremden und kommenden Kulturen ein törichtes Gekrächz, das mit sonderbaren Instrumenten hervorgerufen wurde. Von den Fresken Polygnots ist nichts geblieben, und das erspart uns die Notwendigkeit, sie mißzuverstehen. Die Bauten der Maya, sicherlich Meisterwerke für die Generationen ihrer Erbauer, sind für uns Kuriositäten, nicht mehr, und dasselbe werden das Straßburger Münster, der Palazzo Farnese, Radierung, Kupferstich, Reim und Drama für spätere Menschen sein. Die Leinwand, auf die Rembrandt und Tizian ihre tiefsten Schöpfungen malten, geht der Vernichtung entgegen, aber noch früher vielleicht der Rest von Menschen, für die diese Gemälde mehr als eben bunte Leinwand sind. Was sind für den Fellachen Ägyptens und den indischen Kuli die Pyramidentempel und die Veden ihrer Vorfahren? Was wissen wir von der Wirkung griechischer Verse auf die Menschen ihrer Zeit? Was da vernichtet wird und vernichtet werden kann, indem es aufhört, für die Seele irgendeines Menschen noch Wirklichkeit zu sein und Sinn zu haben, ist gewordene Form.
Alles dies berührt die andre nicht, die in stetem Werden sich erschließt, die eigentlich lebendige, die Gestalt der Seele. Auch ein Kunstwerk hat Seele: es ist das Seelentum überhaupt, jenseits der Grenze von Raum, Grenze und Zahl. Diese Gestalt bedarf keiner Wirklichkeit, um zu sein. Sie entsteht und vergeht nicht. Selbst die verlornen — aus dem sinnlichen, natürlichen Dasein verschwundenen — Tragödien des Äschylus sind noch, nicht in ihrer geschriebenen oder gesprochnen Form, nicht als körperhafte Werke, nicht für das Tagesbewußtsein irgendeines Menschen, aber in einer Wesenheit, die unzerstörbar ist. Es ist dies ein Mysterium, das alle Worte nur unzulänglich und falsch ausdrücken können. Deshalb haftet, aus einem sehr tiefen Zusammenhange, an der körperhaften Erscheinung der größten Kunstwerke etwas Fragmentarisches, ohne daß die Mehrzahl der[S. 300] Betrachter sich dessen bewußt würde. Nach außen hin, für den Kunstverstand, für die Sinne, mögen sie vollendet sein, nach innen sind sie es nie und man fühlt in gewissen Stunden, weshalb es so sein muß. Das gilt nicht nur von Lionardos Gemälden und Goethes Faust und Meister; auch Rembrandts Radierungen haben etwas Suchendes, nichts „Fertiges“; die Musik des Tristan fragt und fragt, ohne zu antworten; der Hamlet ist nicht weniger Torso als der Sturm und das Wintermärchen; Kleist hat den Robert Guiskard immer wieder verbrannt und Dostojewski die Brüder Karamasow und Raskolnikow unvollendet gelassen, im sichren Bewußtsein der Unzulänglichkeit jeder Verwirklichung der Idee. Von allen Künstlern und Dichtern, die über ihre Wirksamkeit Rechenschaft ablegten, wissen und sehen wir, wie vieles Entwurf und Idee — innere Gestalt — blieb, nur weil die Möglichkeit einer wirklichen, natürlichen, äußeren Form nicht erschien. Fertig zu werden, vollkommen abgeschlossen und beendet, nicht nur geendet zu sein, ist das Kennzeichen von Werken geringeren Ranges; eine Sache der Übung, der Erfahrung, des spezifischen Talents. Diese Form ruft den Typus des Virtuosen und den des Kenners hervor. Die andre ist ein mystisches Erlebnis, über das weder der echte Künstler noch der, für den er schafft, Gewalt hat. Der letztere vollendet sich, der erstere vollendet seine Werke. In den Händen des einen erfahren die technischen Mittel, die sich eine Kultur gewählt hat, ihre höchste Vervollkommnung; der andre ist selbst Mittel in den Händen des Schicksals einer Kultur.
Was Sätze nicht deutlicher sagen können, mag vielleicht so versinnbildlicht werden:
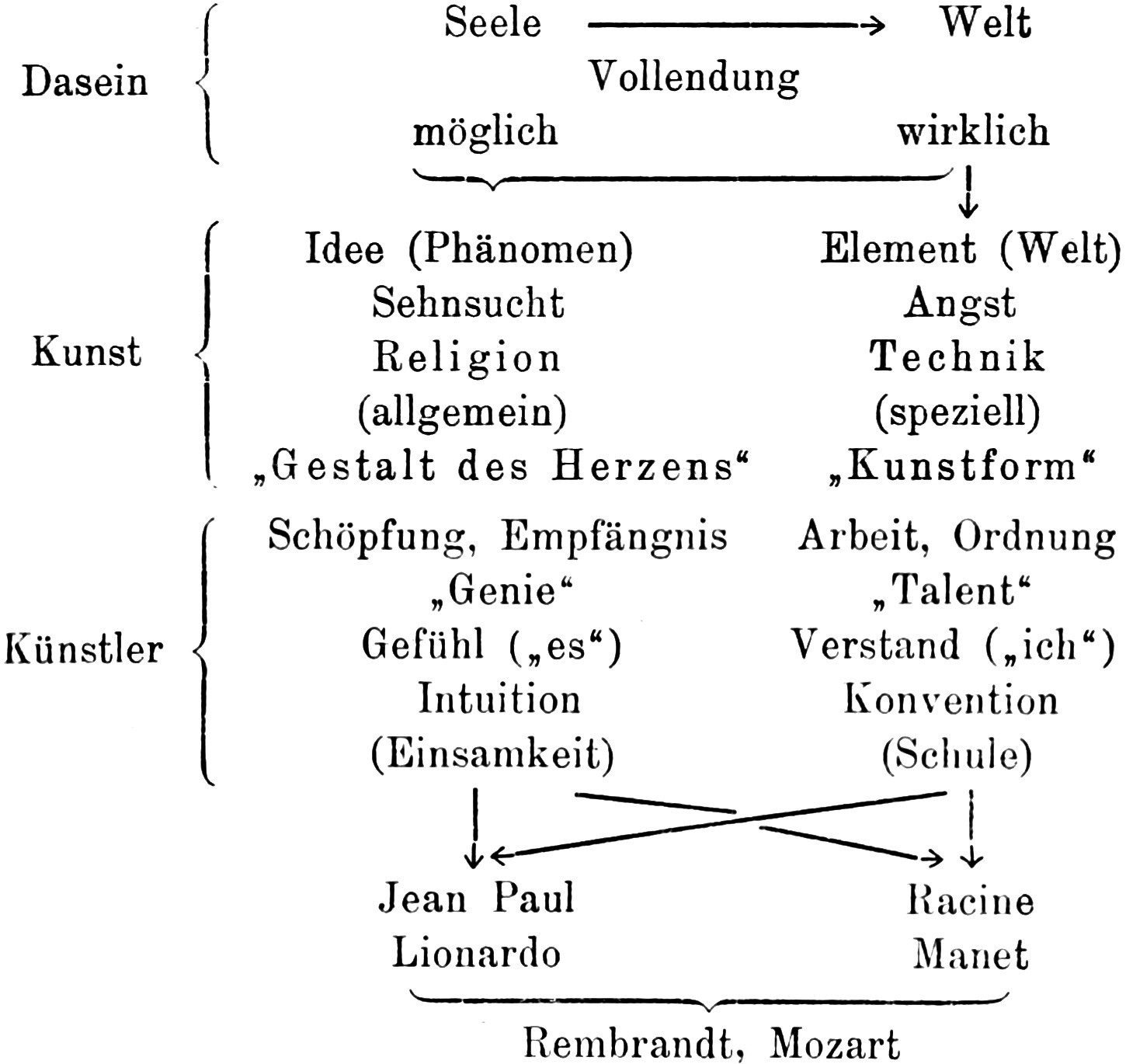
Das Weltgefühl des höheren Menschen hat seinen symbolischen Ausdruck, wenn man von den mathematischen und physikalischen Vorstellungskreisen absieht, am deutlichsten in den bildenden Künsten gefunden, deren es unzählige gibt. Auch die Musik gehört dazu und hätte man ihre sehr verschiedenen Arten in die abstrakten Erwägungen über den Gang der Kunstgeschichte einbezogen, anstatt sie vom Gebiet der malerisch-plastischen Künste zu trennen, so wäre man im Verstehen dessen, um was es sich in dieser Entwicklung auf ein Ziel hin überhaupt handelt, sehr viel weiter gekommen. Aber man wird den Gestaltungsdrang, der hier seiner selbst unbewußt am Werke ist, niemals begreifen, wenn man die Unterscheidung optischer und akustischer Mittel für mehr als äußerlich hält. Das ist es nicht, was Künste voneinander scheidet. Die Kunst des Auges und Ohres — damit ist gar nichts gesagt. Die physiologischen Bedingungen des Ausdrucks, der Empfängnis, der Vermittlung hat nur das 19. Jahrhundert überschätzen können. So wenig ein Bild von Lorrain und Watteau sich im eigentlichen Sinne an das leibliche Auge wendet, so wenig die Musik seit Bach an das leibliche Ohr. Das antike Verhältnis zwischen Kunstwerk und Sinnesorgan, an das hier immer, und zwar durchaus nicht in richtiger Weise gedacht wird, ist ein ganz anderes, viel einfacheres und stofflicheres als das unsrige. Wir lesen Othello und Faust, wir studieren Partituren, um den Geist dieser Werke ganz rein auf uns wirken zu lassen. Hier wird von den äußeren[S. 302] Sinnen immer an den inneren, die Einbildungskraft appelliert. Der unendliche Szenenwechsel gegenüber der antiken Einheit des Ortes ist nur so zu verstehen. Im extremen Falle, wie gerade beim Faust, ist eine den Gehalt des Ganzen erschöpfende, reale Wiedergabe gar nicht möglich. Aber auch in der Musik, bei Mozart, bei Beethoven, bei Wagner erleben wir hinter dem sinnlichen Eindruck eine ganze Welt andrer, in der erst alle Fülle und Tiefe zum Vorschein kommt und über die sich nur in übertragenen Bildern — denn die Harmonik zaubert uns da blonde, braune, düstre, goldige Farben, Dämmerungen, Gipfelreihen ferner Gebirge, Gewitter, Frühlingslandschaften, versunkene Städte, seltsame Gesichter hin — reden läßt. Es ist kein Zufall, daß Beethoven seine letzten Werke geschrieben hat, als er taub war. Damit hatte sich gleichsam die letzte Fessel gelöst. Für diese Musik ist Sehen und Hören gleichmäßig eine Brücke zur Seele, nicht mehr. Dem Griechen ist diese visionäre Art des Kunstgenießens ganz fremd. Er betastet den Marmor mit dem Auge. Auge und Ohr sind für ihn Empfänger des ganzen gewollten Eindrucks. Uns waren sie es schon in der Gotik nicht mehr.
In Wirklichkeit sind Töne etwas Zahlenmäßiges so gut wie Linien; Harmonien, Melodien, Reime, Rhythmen, so gut wie Perspektive, Proportion, Schatten und Kontur. Der Abstand zwischen zwei Arten von Malerei kann unendlich viel größer sein als der zwischen einer gleichzeitigen Malerei und Musik. Gegenüber einer Statue des Myron gehören eine Landschaft von Rembrandt und die Pastoralsinfonie von Beethoven zu ein und derselben Kunst. Ihre innere Formensprache ist in dem Grade identisch, daß der Unterschied optischer und akustischer Mittel dagegen verschwindet.
Der Wert, welchen die Kunstwissenschaft von jeher auf eine reinliche begriffliche Abgrenzung der einzelnen Kunstgebiete gelegt hat, beweist lediglich, daß man in die Tiefe des Problems nicht eingedrungen ist. Vor allem hat die Pedanterie der Systematiker und das oberflächliche Bedürfnis nach bequemer Einteilung den Erfolg kunstphilosophischer Arbeiten verdorben. Nach den alleräußerlichsten Kunstmitteln das unendliche Gebiet in vermeintlich stationäre Einzelkünste — mit unwandelbaren[S. 303] Formprinzipien! — aufzulösen, das war immer der erste Schritt. Man trennte Musik und Malerei, Musik und Drama, Malerei und Plastik; dann definierte man „die“ Malerei, „die“ Plastik, „die“ Tragödie. Aber das greifbare Resultat technischer Ausdrucksmittel ist nicht viel mehr als die Maske des eigentlichen Werkes. Stil ist nicht, wie der flache Semper — ein echter Zeitgenosse Darwins und des Materialismus — meinte, das Produkt von Material, Technik und Zweck. Er ist im Gegenteil das, was dem Kunstverstand gar nicht zugänglich ist, ein Schicksal, eine Atmosphäre des Geistigen. Er hat mit den materiellen Grenzen der Einzelkünste nicht das geringste zu schaffen.
Eine Einteilung der Künste nach Konventionen rein technischer Art zugrunde legen, heißt also, das Problem der Form von vornherein verderben. Wie konnte man „die Plastik“ a priori als Gattung ansetzen und aus ihr allgemeine Grundgesetze entwickeln wollen? Was ist „Plastik?“ Was unterscheidet sie von einem gemalten Relief? Die Malerei — das gibt es nicht. Wer nicht fühlt, daß Handzeichnungen von Raffael und Tizian, von denen der eine mit Umrissen, der andre mit Licht- und Schattenflecken arbeitet, zu zwei verschiedenen Künsten gehörten, daß die Kunst Giottos oder Mantegnas und die Vermeers oder Van Goyens kaum etwas miteinander zu tun haben, daß der eine mit dem Pinselstreich eine Art Relief, der andre eine Art Musik auf der farbigen Fläche ins Leben rief, während ein Fresko Polygnots und ein ravennatisches Mosaikgemälde nicht einmal durch das Werkzeug der Gattung eingefügt werden können, der wird die tieferen Fragen nie begreifen. Die Ölmalerei und Instrumentalmusik von 1720 sind der innern Gestalt, dem Formgefühl nach beinahe identisch. Watteau gehört zu Couperin und Ph. Em. Bach, nicht zu Raffael. Und was hat eine Radierung Rembrandts mit der Kunst Fra Angelicos, was ein proto-korinthisches Vasengemälde mit einem gotischen Domfenster, was ein ägyptisches Relief mit denen des Parthenon zu tun?
Wenn eine Kunst Grenzen hat — Grenzen ihrer Formenwelt —, so sind es historische, nicht technische oder physiologische. Eine Kunst ist ein Organismus, kein System. Es gibt keine Kunstgattung, die durch alle Jahrhunderte geht. Selbst wo technische Traditionen — wie im Falle der Renaissance —[S. 304] den Blick zunächst täuschen und von einer ewigen Gültigkeit antiker Kunstgesetze zu zeugen scheinen, herrscht in der Tiefe völlige Fremdheit. Es gibt nichts in der griechisch-römischen Kunst, was mit der Formensprache einer Statue Donatellos, einem Gemälde Signorellis, einer Fassade Michelangelos verwandt wäre. Innerlich verwandt mit dem Quattrocento ist ausschließlich die gleichzeitige Gotik. Kunstgattungen gehen flüchtig vorüber und kehren nie zurück. Jede Kultur hat ihre eignen, die Gruppe ihrer eignen, deren Theorie und Technik sogar ein Symbol ihres Menschentums ist. Es gibt apollinische, magische, faustische Arten von Künsten, denen gegenüber der Unterschied von Flächen- und Körperkunst zur Nebensache herabsinkt. Griechische Musik steht der griechischen Plastik tausendmal näher als der Kunst Palestrinas. Was man heute farbig nennt — eine Imagination des Räumlichen durch Farbentöne — wäre einem Maler der sikyonischen Schule unverständlich gewesen. Das Ursymbol zweier Kulturen ist es, das die „gleichzeitigen“ Gemälde Polygnots und Rembrandts trennt: im Fresko eine statuenhafte und euklidische Nebeneinanderstellung massiv farbiger Flächen, im Ölbilde eine kontrapunktische Durchdringung mittels des Pinselstrichs.
Der Begriff der Form erfährt hier eine mächtige Erweiterung. Nicht nur das technische Werkzeug, nicht nur der Stoff, die Wahl der Kunstgattung selbst ist ein Mittel des Ausdrucks. Was für den einzelnen Künstler die Schöpfung eines Hauptwerkes, für Rembrandt die Nachtwache, für Wagner die Meistersinger bedeuten, eine Epoche nämlich, das bedeutet für die Lebensgeschichte einer Kultur die Schöpfung einer Kunstart, als Ganzes begriffen, wie die der freistehenden griechischen Statue, des Kontrapunkts, des byzantinischen frontalen Porträts, des perspektivischen Ölgemäldes. Jede dieser Künste ist ein Organismus für sich, ohne Vorgänger und Nachfolger, wenn man vom Äußerlichsten absieht. Alle Theorie, Technik, Konvention gehört zu ihrem Charakter und besitzt nichts Ewiges und Allgemeingültiges. Wann eine dieser Künste beginnt, wann sie erlischt, ob sie erlischt, ob sie in eine andre verwandelt wird, warum die eine oder andre unter den Künsten einer Kultur fehlt, das alles gehört noch mit zur Form im höchsten Sinne,[S. 305] ebenso wie jene andre Frage, warum der einzelne Maler oder Musiker — ohne sich dessen bewußt zu sein — auf bestimmte Farbentöne und Harmonien Verzicht leistet und andre so bevorzugt, daß man ihn daran erkennt.
Die Theorie, auch noch die der Gegenwart, hat die Bedeutung dieser Gruppe von Fragen nicht erkannt. Und trotzdem gibt erst diese Seite einer Physiognomik der Künste den Schlüssel zu ihrem Verständnis. Man hat bis jetzt alle Künste — unter Voraussetzung der erwähnten „Einteilung“ — ohne irgendwelche Nachprüfung dieser schwerwiegenden Frage für möglich gehalten, immer und überall, und wo die eine oder andre fehlte, schrieb man es dem zufälligen Mangel an schöpferischen Persönlichkeiten oder an Förderung durch Umstände und Mäcene zu, die geeignet waren, die Kunst „auf ihrem Wege weiter zu führen“. Das ist es, was ich die Übertragung des physikalischen Kausalitätsprinzips aus der Welt des Gewordnen auf die Welt des Werdens nannte. Weil man kein Auge für die ganz andersartige Logik und Notwendigkeit des Lebendigen, für das Schicksal, hatte, zog man materielle, handgreifliche, an der Oberfläche liegende Ursachen heran, um eine materielle Folge von kunsthistorischen Ereignissen zu konstruieren. Aber es gibt keine Geschichte der Kunst, der Architektur, der Musik, des Dramas. Die Auswahl der innerhalb einer Kultur möglichen Künste — von denen niemals eine auch in einer andern Kultur möglich ist —, ihr Rang, ihr Umfang, ihre Schicksale: das gehört zur Symbolik, zur Psychologie der Kultur und nicht zu den Folgen irgendwelcher Ursachen.
Es war gleich zu Anfang auf die flache Vorstellung einer linienhaften Fortentwicklung „der Menschheit“ durch Altertum, Mittelalter und Neuzeit hingewiesen worden, die uns für das wahre Bild der Historie und seine Struktur blind gemacht hat. Die Kunstgeschichte ist ein besonders deutliches Beispiel. Nachdem man das Vorhandensein einer Anzahl konstanter und wohldefinierter Kunstgebiete als selbstverständlich angenommen hatte, entwarf man die Geschichte dieser Einzelgebiete nach dem ebenso selbstverständlichen Schema Altertum — Mittelalter — Neuzeit, wobei z. B. die indische und ostasiatische Kunst keinen Platz fanden, ohne daß jemandem an dieser Folge die Sinnlosigkeit[S. 306] der Konstruktion aufgegangen wäre: Dieses Schema wollte und mußte nun mit Tatsachen um jeden Preis ausgefüllt sein. Man konstatierte unbedenklich ein sinnloses Auf und Nieder. Man sprach von Zeiten des Stillstandes als „natürlichen Pausen“, von „Zeiten des Niedergangs“ dort, wo in Wirklichkeit eine große Kunst starb, von „Zeiten der Wiedergeburt“, wo für den unbefangenen Blick ganz deutlich eine andre Kunst in einer andern Landschaft und als Ausdruck eines andern Menschentums geboren wurde. Man lehrt noch heute, daß die Renaissance eine Wiedergeburt der Antike gewesen sei. Man folgerte endlich daraus die Möglichkeit und das Recht, Künste, die man schwach oder schon tot fand — die Gegenwart ist da ein wahres Schlachtfeld — durch bewußte Neubildungen und Synthesen, durch gewaltsame „Wiederbelebungen“ neuerdings in Gang zu bringen.
Aber gerade die Frage, weshalb eine große Kunst — das attische Drama mit Euripides, die florentinische Plastik mit Michelangelo, die Instrumentalmusik mit Liszt und Wagner — mit einer als Symbol wirkenden Plötzlichkeit zu enden pflegt, ist geeignet, das Phänomen dieser Künste zu erleuchten. Man sehe genau zu und man wird sich überzeugen, daß von der „Wiedergeburt“ auch nur einer bedeutenden Kunst noch nie die Rede gewesen ist.
Wir sahen, wie die Formen einer strengen, unter dem Ursymbol des Weges stehenden Wirklichkeit, Pyramiden, Reliefs, Hieroglyphen, Staat und Technik, ein peinliches Zeremoniell und ein das gesamte wache Dasein beherrschender Totenkult die Sprache der ägyptischen Seele waren. Diese Seele besaß deshalb keine „Literatur“, vor allem kein Drama großen Stils. Die arabische Seele gestaltet alles sinnlich reicher, zufälliger, lasziver, aber ohne Form im monumentalen Sinne und deshalb ebenfalls, obwohl in andrer Weise, höchst abstrakt. Da das magische Weltgefühl eine Logik des Wirklichen nicht kennt, so verliert die Kunst der Flächen und Räume die Logik der Linien und Proportionen; Malerei und Plastik altchristlich-byzantinischen Stils verschwinden langsam und der Ausdruck wird zuletzt auf die Arabeske, das sarazenische Ornament, reduziert.
[S. 307]
Die Arabeske ist, worüber man sich leicht täuscht — der magischen Schicksalsidee, dem „Kismet“ entsprechend — das passivste aller Ornamente. Sie ist, obwohl aus dem im höchsten Grade sprechenden und bis ins einzelne plastisch geregelten, optisch übersehbaren antiken Ornament hervorgegangen, ohne positivern Ausdruck. Antike Motive wie der Mäander oder die Akanthusranke sind euklidisch, in sich geschlossen, körperhaft isoliert und können also nur wiederholt und additiv aufgereiht werden. Arabisch-persische Muster aber lassen sich nach allen Seiten ins Grenzenlose fortsetzen. Das romanisch-gotische Ornament stellt ein Maximum an Kraft des Ausdrucks dar, die träumerische Arabeske verneint den Willen. Es geht von ihr eine suggestive Wirkung aus, die auch in der arabischen Musik, im arabischen Tanz liegt und die genau dem entspricht, was das Wort magisch bezeichnen soll. Sie ist, da man im Ornament die unmittelbare Handschrift eines kulturbildenden Seelentums zu erkennen hat, das Zeichen einer eigentlich negativen Weltgesinnung, wie die algebraische Zahl vom euklidischen Standpunkt aus als Negation der Zahl überhaupt erscheint. Die Arabeske bedeutet, was dem Weltgefühl des Urchristentums, der Gnosis, des Mithraskultes, des Neuplatonismus, der Abwendung der ersten Christen vom Staate, dem bis zum Typus der Styliten gesteigerten morgenländischen Einsiedlertum genau entspricht, eine ungeheure Entwertung des Wirklichen, dem sie die eigne Bedeutung abspricht und das sie — man denke an die Alhambra — nur eines lässigen Genusses für wert hält. Der gotische Stil löst das Stoffliche im Raume auf, die Arabeske läßt beides in einer Ungewissen Scheinbarkeit verschwimmen. Deshalb sind die Kalifenreiche in Bagdad, Kairo, Granada — im Vergleich zum Staat der Pharaonen und zu dem Ludwigs XIV. und der Hohenzollern — Negationen eines zielbewußten Staatsgedankens, denen gegenüber unsre Empfindung des Märchenhaften durchaus richtig ist; deshalb löst die Arabeskenlyrik die Architektur der Kuppelbauten von Ravenna zuletzt zur freien Laune der Moschee von Cordova auf; deshalb verschwinden die Statue und das Mosaik der Frühzeit und deshalb gibt es kein arabisches Drama. Es besteht eine Homologie zwischen der maurischen Kunst und dem Rokoko, aber Mozart, Pöppelmann[S. 308] und Watteau verleihen einer heiteren, späten Sinnlichkeit trotz aller ätherischen Leichtheit ein Maximum an disziplinierter, durchgearbeiteter, streng durchdachter Form, die Erbauer des Schlosses M’schatta und des Alkazar von Sevilla berauben sie des Restes zugunsten eines phantastischen Spiels.
Diese Tendenz, die alle andern Künste ausschloß und zuletzt nur das Ornament zuließ, ist früh nachzuweisen. In der hellenistischen Zeit erlebt die ideale Bildnisplastik — vom Typus der Sophoklesstatue — allenthalben eine plötzliche Blüte, mit Ausnahme von Antiochia und Alexandria, obwohl gerade dort die uralte Kunst Babylons und Ägyptens eine bedeutende Tradition geschaffen hatte.
Mit Mohammeds Bilderverbot erfolgt auch der Bildersturm im christlichen Byzanz,[68] obwohl die Bildung menschlicher Gestalten durch die Kunst damals schon im Erlöschen begriffen war. Dieser symbolische Akt des christlich-islamischen Weltgefühls wiederholt also lediglich etwas, das die Formentendenz der magischen Künste durch ihre Auflösung in die unkörperliche, bildlose Arabeske schon verwirklicht hatte. Es ist darauf hinzuweisen, daß die bilderstürmerische Bewegung in den reformierten Niederlanden und im puritanischen England etwas Ähnliches verrät, daß nämlich die Musik im Begriff war, die Malerei zu überwinden. Die gotisch-florentinische Plastik war im 16. Jahrhundert zu Ende. Die letzten großen Meister der Ölmalerei starben am Ende des 17. Jahrhunderts. Hier muß man fühlen, was es bedeutet, wenn eine Kunst stirbt. Die Weihe des Raumes, sei er magisch oder faustisch, gestattet das „Bild“ nicht länger. Das Ursymbol der Kultur tritt mit steigender Klarheit hervor. Arabeske und Musik heben jede Stofflichkeit auf. Man bemerke wohl, was von den Bilderstürmern als unzulänglich empfunden und verbannt wird: Im Abendlande aller sinnliche Schmuck, alle Zieraten, alles, was „endlich“ und unräumlich ist; im Arabischen nur das Bildnis, als eine Herabwürdigung des Menschen zum Dinge. Es ist dasselbe Weltgefühl, das 449 zur endgültigen Trennung des monophysitischen Christentums von der morgenländischen Kirche führte, ein[S. 309] Schisma, dessen landschaftliche Grenze, innerhalb deren es nicht wieder zu überwinden war, genau die der spätern islamitischen Kultur zwischen Bagdad und Kairo war und dessen Sinn als dogmatische Vorform des Islam man noch in keiner Weise gewürdigt hat. Was damals über das Wesen der Person Christi — das magische Problem seiner „zwei Naturen“ — leidenschaftlich umstritten wurde, deckt sich durchaus mit den gefühlten oder metaphysisch entwickelten Einwänden, die seitdem gegen die bildliche Darstellung des Menschen als des Gefäßes des göttlichen Pneuma erhoben worden sind. Schon die Plastik und die Mosaikmalerei der späten Kaiserzeit — arabischen Ursprungs, wie wir gesehen haben — wies auf dies Ende hin. Der magische Ausdruck des konstantinischen Porträts, das den Leib durch den starren, alles beherrschenden Blick gewissermaßen in seiner Wesenheit herabsetzte, ihn entkörperte, hatte zu einem großen Stil geführt, welcher dem gnostischen und plotinischen Weltgefühl entsprach. Er hatte an Stelle des antiken Prinzips des allseitig freistehenden Körpers das frontale gesetzt, das eine Beziehung zwischen dem Geiste des Dargestellten und dem des Betrachters schafft. Es erlosch mit der arabischen Frühzeit. Aus einem ebenso tiefliegenden Grunde ist die frühe Plastik des Abendlandes, die der Dome von Bamberg, Naumburg, Chartres, Reims und die der Renaissance von Florenz und Nürnberg lange vor Palestrinas und Tizians bester Zeit erloschen.
Der Poseidontempel von Pästum und das Ulmer Münster, Werke der reifsten Dorik und Gotik, unterscheiden sich wie die euklidische Geometrie der körperlichen Grenzflächen und die analytische Geometrie der Lage von Raumpunkten in bezug auf die Raumachsen. Alle antike Baukunst beginnt von außen, alle abendländische von innen. Die altchristlichen Basiliken im innern Syrien und in Nordafrika, mit Entschiedenheit sich vom antiken Baugedanken abwendend, zeigen die magisch geheimnisvollen Schwingungen eines voll umschlossenen Raumes. Es war der erste starke Ausdruck einer neuen Seele. Sobald der germanische Geist diesen basilikalen Typus in Besitz nimmt, beginnt[S. 310] eine wunderbare Veränderung aller Bauelemente nach Lage und Sinn, die strenge Ausbildung abgestufter Seitenschiffe und vor allem des für die Symbolik der Dome unendlich wichtigen Querschiffes, durch das nach dem Maße der Vierung eine strophische Gliederung des bewegten Rauminnern erzeugt wird. Hier im faustischen Norden bezieht sich von nun an die äußere Gestalt des Bauwerkes, und zwar vom Dom bis zum schlichten Wohnhause, auf den Sinn, in welchem die Gliederung des Innenraumes erfolgt ist. Die Moschee verschweigt sie, der Tempel kennt sie nicht. Man hat es wohl nicht genügend beachtet, daß das Motiv der Fassade, deren Architektur das Innere physiognomisch spiegelt und das nicht nur unsere großen Einzelbauten, sondern das gesamte Bild unsrer Straßen, Plätze, Städte beherrscht, der Antike ebenso fern liegt wie dem Arabertum.
Der hellenische Tempel ist als massiver Körper gedacht und gestaltet. Eine andere Möglichkeit gab es für das hier wirkende Formgefühl nicht. Deshalb ist die Geschichte der antiken bildenden Kunst die unablässige Arbeit an der Vollendung eines einzigen Ideals gewesen, der Eroberung des freistehenden menschlichen Körpers als dem Inbegriff der reinen, dinglichen Gegenwart. Man hat das Pathos dieser durch Jahrhunderte verfolgten Tendenz gar nicht verstanden. Denn man hat nie gefühlt, daß es der rein stoffliche, seelenlose Körper, das σῶμα ist, auf den das archaische Relief, die korinthische Tonmalerei und das attische Fresko zielen, bis Polyklet und Phidias ihn vollkommen zu bewältigen gelehrt haben. Man hielt mit einer erstaunlichen Blindheit diese Art von Plastik für eine allgemein gültige und überall mögliche, für die Plastik schlechthin, und schrieb ihre Geschichte und Theorie, in der alle Völker und Zeiten aufgeführt wurden; und unsre Bildhauer reden unter dem Eindruck ungeprüft hingenommener Renaissancedogmen noch heute davon, daß der nackte menschliche Körper der vornehmste und eigentliche Gegenstand der bildenden Kunst sei. Man hat, wie es scheint, nie bemerkt, wie selten diese Gattung ist, ein Einzelfall, eine Ausnahme, nichts weniger als eine Regel. In Wahrheit hat es diese den nackten Leib frei auf die Ebene stellende und allseitig durchbildende Statuenkunst nur einmal gegeben, eben in der Antike, und nur dort, weil es nur diese[S. 311] eine Kultur mit einer vollkommenen Ablehnung der Überschreitung sinnlicher Grenzen zugunsten des Raumes gab. Die ägyptische Statue war immer auf die Vorderansicht hin gearbeitet, mithin eine Abart des Flachreliefs, und die scheinbar antik empfundenen Statuen der Renaissance — man ist über ihre geringe Zahl erstaunt, sobald man einmal daran denkt, sie nachzuzählen[69] — sind nichts als eine Reminiszenz.
Diese apollinische Plastik ist das Seitenstück zur euklidischen Mathematik. Sie leugnen beide den reinen Raum und sehen in der körperlichen Form das a priori der Anschauung. Diese Plastik kennt weder in die Ferne weisende Ideen noch Persönlichkeiten noch historische Ereignisse, sondern nur das auf sich selbst beschränkte Dasein flächenbegrenzter Leiber. Man erinnere sich hier, daß das Wort σῶμα von den griechischen Mathematikern für stereometrische Gebilde, von den Physikern für Substanz, vom sophokleischen Ödipus aber als Bezeichnung seiner Person gebraucht wird.
Die Entwicklung dieser raumlosen Kunst par excellence füllt die drei Jahrhunderte von 650–350, von der Vollendung der Dorik, die gleichzeitig mit dem Beginn einer Tendenz auf Befreiung der Figur von der frontalen ägyptischen Gebundenheit erfolgte (Apoll von Tenea, bald nach 650) bis zum Anbruch des Hellenismus und seiner Illusionsmalerei, die den großen Stil abschließt. Man wird diese Plastik nie würdigen können, wenn man sie nicht als letzte und höchste antike, aus der Freskomalerei hervorgegangene und sie überwindende Kunst begreift. Gewiß läßt sich der technische Ursprung aus den Versuchen ableiten, die dorische Holzsäule (Hera des Cheramyes) und die zur Verkleidung am Holztempel dienende Metallplatte (Artemis der Nikandre) figürlich zu behandeln. Als Formideal aber folgt die attische Statue aus der Einzelgestalt des Fresko. Sie hat diese Herkunft nie verleugnet. Ihre Formensprache ist der Vierfarbenmalerei Polygnots aufs engste verwandt, ohne sich von deren Prinzipien je ganz befreit zu haben. Man denke an die polychrome Behandlung des Marmors — von der die Renaissance und Goethe nichts wußten und die sie als barbarisch[S. 312] empfunden haben würden[70] — an die Statuen aus Gold und Elfenbein und die Emailverzierung der im natürlichen Goldton leuchtenden Bronzen. Der Erzguß hat die Verwendung des bemalten Marmors in der besten Zeit entschieden überragt.
Die antike Zahl — die Größe, das Maß — entspricht zunächst der Formensprache der Tonmalerei rotfigurigen Stils und dem späteren Fresko. Die Planimetrie insbesondere gehört zum strengsten Flächenstil Polygnots, der weder Licht noch Schatten noch perspektivische Verhältnisse kennt. Diese Kunst ist die organische Vorstufe der Skulptur. Sie steht nicht neben ihr. Noch um 475 gibt es neben Polygnot keinen ebenbürtigen Bildhauer, wie es um 1650 neben Rembrandt noch keinen Musiker vom gleichen Range gibt. Erst das letzte Jahrhundert hat in beiden Kulturen den Sieg der strengsten Kunst gebracht. Polyklet, der Schüler Polygnots, hat den Kanon der nackten Statue geschaffen. Um 1740, als die großen Meister der Ölmalerei alle tot waren und Bach auf der Höhe seiner Kraft stand, ist der strenge Kanon des vierteiligen Sonatensatzes vollendet worden. Beide bezeichnen das Maximum an Form, das aus dem Grunde des Ursymbols — dort des Körpers, hier des Raumes — überhaupt zu erreichen war. Beide behaupten ihre Geltung bis herauf auf Skopas und Beethoven, die, an der Grenze von Kultur und Zivilisation, dem großen Stil nicht mehr gewachsen sind. Lysippos und Wagner haben ihn zerstört.
Die Pythagoräer schufen seit 540 eine Geometrie der Körper; Descartes, Fermat und Pascal seit 1620 eine Geometrie des Raumes. So steht die absolute Flächen- und Körperwirkung der attischen Vasengemälde homolog neben der perspektivischen Raumkunst der Ölmalerei, die Szenen der Françoisvase (etwa 570) neben den Landschaften Lorrains (1600 bis 1682). Jene gestalten Menschen ohne Hintergründe, diese Hintergründe ohne Menschen (außer als „Staffage“). Das apollinische Tiefenerlebnis kennt die Ausdehnung als Körper ohne Raum, das faustische als Raum ohne Körper.
Dem Fresko nächstverwandt und darum der Tendenz Rembrandts bis zum äußersten entgegengesetzt ist das Hochrelief,[S. 313] eine lose Summe, keine beziehungsreiche Gruppe von Körpern, die durchaus stereometrisch auf die Rückwand aufgesetzt sind. Auch hier war Ägypten zweifellos das Vorbild, an dem die Sehnsucht nach Ausdruck eigner Möglichkeiten sich zur Klarheit der Form entwickelte. Aber die dem ägyptischen Weltgefühl — dem Ursymbol des Weges — entsprechende Kunst war das Flachrelief gewesen, das durch die bedeutsame Zerlegung des werdenden Raumes in Fläche und Tiefe, in Sinneseindruck und lebendige Bewegung der Betrachtenden, religiös gesprochen in Zufall und Notwendigkeit, den Wandgemälden nur Länge und Breite zugesteht, während durch die richtunggebende Gliederung des Bauwerks selbst die Tiefe, die „dritte Dimension“ repräsentiert wird. Die Folge ist, daß das Relief mit seinen fortlaufenden Szenen (das antike ist immer statisch) auch die geringste dreidimensionale Körperlichkeit vermeidet und endlich auf diesem Wege zu der bizarren Form des eingesenkten Reliefs (relief en creux) vor allem der 18. Dynastie gelangt, das — wenn man von einer einzigen, aber höchst bezeichnenden Ausnahme in der altchinesischen Kunst absieht — ohne Beispiel in der Welt ist und die extremste Form einer unkörperlichen, zweidimensionalen Plastik darstellt.
Während die ägyptische Statue an eine Wand gelehnt war und die gotische, selbst die Donatellos, nur als architektonisches Motiv, etwa im Einklang mit einem Nischenraum, ganz zu verstehen ist, stand die hellenische allseitig frei auf der Ebene. Es ist das einzige, auch von der Renaissance nicht wiederholte Beispiel eines Kunstwerks, das von allen Seiten, nicht nur von der durch den Künstler gewählten, betrachtet sein will. So verlangte es der Weltgedanke eines Kosmos, in dem alle Einzeldinge sichtbar und gleichgeordnet sind, ohne in ihrer Wesenheit durch irgendwelche (notwendig räumliche) Beziehungen beschränkt zu sein. Denn einen bestimmten Standort für den gewollten Eindruck voraussetzen heißt eine räumliche Beziehung zwischen Betrachter und Werk in dessen Formensprache legen. Die Geometrie Euklids aber kennt keine „Funktionen“. Auch die Giebelgruppen hellenischer Tempel stellen, wenn man nicht gewaltsam etwas hineindeuten will, lediglich die ökonomische Füllung einer Lücke mit Einzelmotiven dar.
[S. 314]
Damit enthält die Gesamtheit der antiken Künste eine gemeinsame Tendenz, der mit steigender Reife die Bedeutung, der Umfang und selbst die weitere Existenz der einzelnen unterliegt. Bei Homer ist von Götterstatuen keine Rede. Man sieht auch nicht, inwiefern der frühdorische Dipylonstil mit ihnen vereinbar wäre. Auf den altattischen Grabvasen erscheinen dann mythische Szenen. Die altionische Tonmalerei von Milet und Samos kannte Historienbilder und Schlachtenschilderungen (der Maler Bularchos war berühmt). Dann aber beginnt die Reduktion der Möglichkeiten. Die große Symbolik der apollinischen Seele wählt und scheidet aus. Der dorische Peripteros und die Aktstudie gestatten gleichwenig Variationen. Polygnot erreicht den Gipfel des malerischen Ausdrucks unter diesen strengen Bedingungen und erschöpft ihn. Seine Kunst ist rein linienhaft, ohne Übergänge, ohne Licht- und Schattenwirkungen, ohne Hintergrund. Er stellt auf derselben Bildfläche eine regellose Menge von Szenen dar, die untereinander keinerlei Verhältnis im Sinne einer Raumperspektive besitzen. Jeder Körper steht für sich da. Der Raum zwischen ihnen, die Atmosphäre ist das „μὴ ὄν“ und deshalb keiner malerischen Repräsentation fähig. Der Grieche ignoriert die Tatsache, daß ferne Dinge kleiner erscheinen; er ignoriert die Ferne, den Horizont überhaupt. Die Statue ist der Inbegriff des Nahen, Raumlosen, optisch zu Erschöpfenden. Sie bezeichnet den Schwerpunkt antiker Kunst. Das Drama wurde nach ihrem Vorbilde zur Kunst der berühmten „drei Einheiten“, der Einheit des Ortes vor allem, die ein Prinzip der Statue ist. Die Szenen der antiken Tragödie sind durchaus als Fresken gedacht. Die hellenische Musik wurde zu einer Plastik von Tönen, ohne Polyphonie und Harmonie — die einen Tonraum imaginieren — und damit als selbständige Kunst ohne tiefere Möglichkeiten. Während sie im Abendlande zur ersten aller Künste aufstieg, sank sie in Athen zur bloßen Begleiterin der andern, des Tanzes und des Dramas herab.
Die entsprechende Phase der abendländischen Kunst füllt die drei Jahrhunderte von 1500 bis 1800, vom Ende der Spätgotik[S. 315] bis zum Verfall des Rokoko und damit dem Ende des faustischen Stils überhaupt. In dieser Zeit hat sich, entsprechend dem immer stärker ins Bewußtsein tretenden Willen zur räumlichen Transzendenz, die polyphone Instrumentalmusik zur herrschenden Kunst entwickelt. Die Plastik wird mit steigender Entschiedenheit aus den tieferen Möglichkeiten dieser Formenwelt ausgeschieden.
Was die Malerei vor und nach ihrer Verlagerung von Florenz nach Venedig, was also die Malerei Raffaels und Tizians als zwei ganz verschiedene Künste kennzeichnet, ist der plastische Geist in der einen, der ihre Gemälde neben das Relief, der musikalische Geist in der andern, der ihre mit sichtbaren Pinselstrichen und Schattenwirkungen arbeitende Technik neben die Kunst der Fuge stellt. Die Einsicht, daß hier ein Gegensatz, kein Übergang vorliegt, ist für das Verständnis des Organismus dieser Künste entscheidend. Hüten wir uns gerade hier vor der Annahme stationärer „Kunstgebiete“. Malerei ist nur ein Wort. Die gotische Plastik und Malerei war ein Bestandteil der gotischen Architektur. Sie diente ihrer strengen Symbolik wie die frühägyptische, die früharabische, wie jede andre Kunst in diesem Stadium der Sprache des Steins dient. Man baute Gewandfiguren auf wie Dome. Die Falten waren ein Ornament von höchster Intensität des Ausdrucks. Man ist auf falschem Wege, wenn man vom naturalistisch-imitativen Standpunkt aus ihre „Steifheit“ kritisiert. Die Renaissancemalerei andrerseits ist ein höchst komplizierter Sonderfall mit antigotischen Tendenzen auf der Oberfläche der technischen Konvention und sehr anders gerichteten in der Tiefe.
Ebenso ist Musik ein vages Wort. Es gab immer und überall Musik, auch vor aller eigentlichen Kultur. All diese Künste sind an sich bereits urmenschlich. Es gibt Zeichnungen von Eiszeitmenschen, szenische Spiele, Dichtungen und Musik von Naturvölkern aller Erdteile. Sie bilden ein Chaos wirrer Möglichkeiten, bis die Seele einer erwachenden Kultur hineingreift und mit Ungestüm eine gigantische Gruppe von Künsten großen Stils — ausnahmslos Sonderkünste und nie wiederkehrende Formenwelten von vorübergehendem Dasein, jung, reifend, alternd, sterbend, voller Konvention und Bedeutsamkeit, sämtlich in die[S. 316] Farbe eines einzigen Ursymbols getaucht — entwickelt. Die antike Musik war, weil sie zum Prinzip der stofflichen Ausdehnung kein Verhältnis besaß, wesentlich Urmusik geblieben. Hier aber, in der faustischen Kultur, hebt sich als vollkommenes Novum die kontrapunktische Instrumentalmusik, eine reine, selbständige, alle Nachbarkünste überschattende, mit steigender Kraft alle andern in sich auflösende Kunst von der Basis urseelenhafter Möglichkeiten ab.
Es gibt in der Geschichte wenig Phänomene von so wunderbarer Durchsichtigkeit wie die Entwicklung der abendländischen Musik.
Gleichzeitig mit der Geburt des romanischen Stils im 10. Jahrhundert beginnt die Polyphonie die einstimmigen Parallelfolgen der „Kirchentöne“ aufzulösen.[71] Man schreibt die Einführung der Gegenstimme (dis-cantus) dem Benediktiner Hucbald zu. Englische (keltische) Einflüsse erscheinen wesentlich und ich glaube, daß hier eine bedeutsame Parallele zu der ebenfalls damals erfolgten Vollendung der Artussagen vorliegt, die einen mächtigen Teil des faustischen Mythus bilden — die Sagen von der Tafelrunde, vom Gral, vom Parzeval und Tristan. Es sind uralte keltische Motive, die von der germanischen Gefühls- und Gedankenwelt assimiliert werden. Man wird das Musikhafte dieser Stoffe, das Verschwebende der Gestalten, das Grenzenlose der Gefühle und Horizonte gegenüber der eng umschriebenen Plastizität der homerischen Welt nicht verkennen.
Der strenge Kontrapunkt — der Name (punctus contra punctum) wird für die „ars nova“ etwa seit 1330 gebraucht — entsteht infolge der Einführung der Terzen und Sexten seit dem 14. Jahrhundert, und zwar in Burgund und den Niederlanden, der Heimat der Ölmalerei und des gotischen Stils. Dieser gemeinsame landschaftliche Ursprung der drei großen faustischen Formenwelten ist von höchster Bedeutung. Hier rühren wir an ein letztes Geheimnis allen Menschentums: die Verbundenheit der Seele mit der mütterlichen Erde, aus der alte Mythen sie hervorgehen und zurückkehren lassen. Weiterhin[S. 317] erschließt sich die innere Identität dieser Kunstform mit dem zugehörigen Prinzip der Zahl. Die Kunst der Fuge ist das genaue Seitenstück zur analytischen Geometrie. Die Koordinaten wurden durch Oresme, den Bischof von Lisieux (1323–1382), gerade zur selben Zeit eingeführt, als der große Niederländer Heinrich von Zeelandia (etwa 1330–1370) den fugierten Stil zur sicheren Grundlage einer großen Kunst erhob. Von hier an erfährt die Sprache des Tonraumes in engster Nachbarschaft zu der des perspektivischen Bildraumes eine mächtige Entwicklung. Mit Orlando Lasso (1532–1594) erreicht sie ihre höchsten Möglichkeiten. Sie wird — im strengen Gesang, in den Formen der Kantate (Messe, Passion, Motette) — fähig, die ganze faustische Seele, ihr ganzes Weltgefühl, ihr ganzes Schicksal zum Ausdruck zu bringen.
Als dann Newton und Leibniz — seit 1660 — die Infinitesimalrechnung schufen, siegte die „sonata“, die reine Instrumentalmusik, über die „cantata“. Es war der unendliche Raum, der Töne wie der Funktionen, der den Rest des Greifbaren und Körperhaften — hier die menschliche Stimme, dort die linienhaften Koordinaten — überwältigte. Die Elemente des Nahen schwinden. Die Ferne siegt. Der Weg vom Gesang zum körperlosen Orchesterklang entspricht dem Wege von der geometrischen zur rein funktionalen Analysis. Zuerst entsteht eine Anzahl kleiner Instrumentalsätze, tanz- und marschartig, alle jene Gavotten, Gaillarden, Sarabanden, Pavanen, Giguen, Menuetten. Das „Orchester“ bildet sich. Dann, um 1660, von der Lautenmusik ausgehend, entsteht als große Form die Suite, eine zyklische Gruppe kurzer Sätze.
Alle Einzelheiten dieses Aufstieges lassen sich mit Beispielen aus der gleichzeitigen Mathematik belegen. Die Dehnung des Tonkörpers ins Unendliche, seine Auflösung vielmehr in einen unendlichen Raum von Tönen, innerhalb dessen der fugierte Stil seine Gebilde wirken läßt, wird durch die Entwicklung der Instrumentation bezeichnet, die nach immer neuen Instrumenten greift, das Orchester fortgesetzt bereichert und differenziert, immer „entferntere“ Klänge, Farben und Dissonanzen aufsucht. Schon Monteverdi wagte es — bald nach 1600 — den Dominantseptakkord einzuführen. Im concerto grosso wirkt die[S. 318] Klangmasse des großen Orchesters im continuo der der concertino (des Streichkörpers) in einer Weise entgegen, die man beinahe nur durch analoge Vorstellungen der höheren Analysis anschaulich machen kann. Uns ist diese Kunst natürlich und von höchster seelischer Deutlichkeit. Ein Grieche würde mit Erstaunen diese fantastische Ausgeburt eines seltsamen Ausdrucksbedürfnisses betrachtet haben. Der Tonkörper oder Klangraum ist ein Gebilde von derselben Transzendenz und anti-euklidischen „Unwirklichkeit“ wie der optisch unzugängliche Zahlenkörper und die vieldimensionalen Räume, Mengen und Gruppen der Mengenlehre. Um 1740, als Euler begann, die endgültige Fassung der funktionalen Analysis festzulegen, entsteht die Sonate, die reifste und höchste Form des instrumentalen Stils. (Einzelformen sind neben der Sonate für Soloinstrumente die Sinfonie, das Konzert, Ouvertüre und Quartett.) Ihre vier Sätze, deren erster die drei Themen in streng geregelter Abwandlung bringt, bilden ein System von ebenso mächtiger Logik der Form als von absoluter „Jenseitigkeit“. Ihr Ursprung liegt in den formalen Möglichkeiten unsrer innigsten und innerlichsten, der Streichmusik (Corelli, Tartini, Stamitz haben an ihrer Ausbildung teil), und so gewiß die Geige das edelste aller Instrumente ist, welche die faustische Musik für sich erfand und ausbildete, so gewiß liegen ihre tiefsten, ihre heiligen Momente völliger Verklärung im Streichquartett und den verwandten Kompositionsformen. Hier, in der Kammermusik, erreicht die abendländische Kunst überhaupt ihren Gipfel. Das Symbol des reinen Raumes, das überirdischste unter allen, ist hier ebenso vollkommen zum Ausdruck gelangt, wie das rein irdische, das der vollen Körperlichkeit, in einer attischen Bronzestatue. Wenn eine dieser unsagbar sehnsüchtigen Geigenmelodien einsam und klagend den Raum durchirrt, den die Töne des Tutti um sie breiten — bei Haydn, Mozart, Beethoven und den großen Italienern — so befindet man sich der Kunst gegenüber, die allein der reinsten apollinischen an die Seite zu stellen ist, wie sie in der Athena Lemnia des Phidias erscheint.
Damals beherrscht die Musik alle andern Künste. Sie verbannt die Plastik der Statue und duldet nur die vollkommen musikalische, raffiniert unantike und renaissancewidrige Kleinkunst[S. 319] des Porzellans, das erfunden wurde, als die Kammermusik zur entscheidenden Geltung gelangte. Während die gotische Plastik durchaus architektonisches Ornament ist, menschliches Rankenwerk, ist die des Rokoko das merkwürdige Beispiel einer Scheinplastik, die in der Tat der Formensprache der Musik, ihres Gegensatzes im Kreise der Künste unterliegt. Hier sieht man, bis zu welchem Grade die den Vordergrund des Kunstlebens beherrschende Technik dem Geiste der durch sie geschaffenen Formenwelt widersprechen kann — zwischen welchen Faktoren die gewöhnliche Ästhetik das Verhältnis von Ursache und Wirkung annimmt. Man vergleiche die kauernde Venus des Coyzevox (1686) im Louvre mit ihrem antiken Vorbilde im Vatikan. Das ist Plastik als Musik und Plastik in ihrem eignen Namen. Man kann hier die Art der Bewegtheit, den Fluß der Linien, das Fließende im Wesen des Steines selbst, der wie das Porzellan gewissermaßen den festen Aggregatzustand verloren hat, am besten durch musikalische Wendungen: staccato, accelerando, andante, allegro, beschreiben. Daher das Gefühl, als ob der körnige Marmor hier nicht am Platze ist. Daher die ganz unantike Berechnung auf Licht und Schatten hin. Das entspricht dem leitenden Prinzip der Ölmalerei seit Tizian. Was man im 18. Jahrhundert Farbigkeit — einer Radierung, einer Zeichnung, einer plastischen Gruppe — nennt, bedeutet Musik. Sie beherrscht die Malerei Watteaus und Fragonards und die Kunst der Gobelins und Pastelle. Sprechen wir nicht seitdem von Farbentönen und Tonfarben? Ist damit nicht die endlich erreichte Gleichartigkeit zweier oberflächlich so verschiedener Künste anerkannt? Und sind diese Bezeichnungen nicht angesichts jeder antiken Kunst gegenstandslos? Aber die Musik schuf auch die Architektur des berninischen Barock in ihrem Geiste um, zum Rokoko, über dessen transzendenter Ornamentik Lichter — Töne — „spielen“, um Decken, Wände, Bögen, alles Konstruktive und Wirkliche in Polyphonie und Harmonie aufzulösen, dessen architektonische Triller, Kadenzen und Passagen die Identität der Formensprache dieser Säle und Galerien und der für sie erdachten Musik zu Ende führen. Dresden und Wien sind die Heimat dieser späten und rasch verlöschenden Wunderwelt der Kammermusik, der geschweiften Möbel, Spiegelzimmer,[S. 320] Schäferpoesien und Porzellangruppen. Sie ist der letzte, herbsthaft sonnige, vollkommene Ausdruck der abendländischen Seele. Im Wien der Kongreßzeit starb sie dahin.
Die Renaissance ist, aus diesem Gesichtspunkt betrachtet — der sie bei weitem nicht erschöpft —, eine Auflehnung gegen den Geist dieser fugierten, faustischen, wälderhaften Musik, die sich eben anschickte, ihre Diktatur über die gesamte Formensprache der abendländischen Kultur aufzurichten. Sie ging folgerichtig aus der reifen Gotik hervor, in der dieser Wille unverhüllt hervorgetreten war. Sie hat diese Abkunft nie verleugnet und ebensowenig den Charakter einer bloßen Gegenbewegung, deren Art notwendig von den Formen der Urbewegung, deren Rückwirkung auf die zögernde Seele sie darstellt, abhängig blieb. Sie ist folgerichtig deshalb ohne wahre Tiefe, und zwar in beiderlei Sinne — ohne Tiefe der Idee und ohne Tiefe der Erscheinung. Was das erste betrifft, so braucht man nur an die entfesselte Leidenschaft zu denken, mit der das gotische Weltgefühl sich in der ganzen abendländischen Landschaft entlädt, um zu fühlen, was für eine Bewegung es ist, die um 1420 von einem kleinen Kreise erlesener Geister, Gelehrter, Künstler, Humanisten ausging. Dort handelt es sich um Sein oder Nichtsein eines neuen Seelentums, hier um eine Frage des Geschmacks. Die Gotik ergreift das ganze Leben bis in seine geheimsten Winkel. Sie hat einen neuen Menschen, eine neue Welt geschaffen. Sie hat von der Idee des Katholizismus bis zum Staatsgedanken der deutschen Kaiser, vom ritterlichen Turnier bis zum Bilde der eben entstehenden Städte, vom Dom bis zur Bauernstube, vom Bau der Sprache bis zum Brautschmuck der Dorfmädchen, vom Ölgemälde bis zum Spielmannslied allem die Sprache einer einheitlichen Symbolik aufgeprägt. Die Renaissance bemächtigte sich einiger Künste und damit war alles getan. Sie hat die Denkweise Westeuropas, das Lebensgefühl in nichts verändert. Sie drang bis zum Kostüm und zur Geste vor, nicht bis zu den Wurzeln des Daseins. Sie hat zwischen Dante und Michelangelo, die ihre Grenzen schon überschreiten,[S. 321] keine geniale Persönlichkeit aufzuweisen. Und was das zweite betrifft, so hat sie selbst in Florenz das Volkstum nicht berührt, in dessen Tiefe — erst dies macht die Erscheinung Savonarolas und seine ganz andre Gewalt über die Gemüter verständlich — der gotisch-musikalische Unterstrom ruhig dem Barock zufließt.
Der Renaissance als einer antigotischen und dem Geiste der Instrumentalmusik feindlichen Bewegung entspricht in der Antike genau die dionysische als eine antidorische und dem plastisch-apollinischen Weltgefühl entgegengesetzte. Sie ist nicht aus dem thrakischen Dionysoskult hervorgegangen. Sie hat ihn erst als Waffe und Gegensymbol zur olympischen Religion herangezogen, ganz ebenso wie man in Florenz den Kult der Antike erst zur Rechtfertigung und Stärkung des eigenen Gefühls zu Hilfe rief. Die große Auflehnung erfolgte dort 700–600 und also hier 1400–1500. Es handelt sich in beiden Fällen um einen Seelenkampf, um einen Zwiespalt im Untergrunde der Kultur, der seinen physiognomischen Ausdruck in einer ganzen Epoche des Geschichtsbildes, vor allem in deren künstlerischer Formenwelt gefunden hat, um einen Widerstand der Seele gegen ihr Schicksal, das sie nunmehr in seinem vollen Umfange begriffen hat. Die innerlich widerstrebenden Mächte, Fausts zweite Seele, die sich von der andern trennen will, suchen den Sinn der Kultur umzubiegen; die unausweichliche Notwendigkeit soll verleugnet, aufgehoben, umgangen werden; es ist Angst vor der Vollendung der historischen Geschicke durch Ionik und Barock darin. Dort knüpft sie sich an den Dionysoskult mit seinem musikalischen, entwirklichenden, den Körper vergeudenden Orgiasmus, hier an die literarische Tradition des „Altertums“ und dessen Kultus der Plastik, die beide als fremde Faktoren herangezogen werden, um durch die suggestive Kraft ihrer gegensätzlichen Formensprache dem unterdrückten Gefühl einen Schwerpunkt, ein eigenes Pathos zu verleihen und damit der Strömung in den Weg zu treten, die dort von Homer und dem geometrischen Stil zu Phidias, hier von den gotischen Domen über Rembrandt zu Beethoven geht.
Aus dem Charakter einer Gegenbewegung folgt, daß es ebenso leicht ist zu definieren, was sie bekämpft, als schwer, was sie erreichen will. Das ist die Klippe aller Renaissanceforschung.[S. 322] Im Gotischen (und Dorischen) ist es gerade umgekehrt. Es kämpft für, nicht gegen etwas. Aber Renaissancekunst — das ist ganz eigentlich antigotische Kunst. Renaissancemusik ist eine contradictio in adjecto. Soweit ist alles klar. Das Übrige bringt in Verlegenheit.
Denn die Beurteilung dieses Phänomens ist bezeichnend dafür, wie sehr man die laut ausgesprochene Absicht mit dem tieferen Sinn einer Bewegung verwechseln kann. Die Kritik hat seit Burckhardt jede einzelne Behauptung der führenden Geister über ihre Tendenzen widerlegt, aber nachdem dies abgetan war, das Wort Renaissance im alten optimistischen Sinne weiter gebraucht. Gewiß, der Unterschied im Architektonischen, überhaupt im künstlerischen Gesamtbilde ist auffallend, sobald man über die Alpen kommt. Aber eben deshalb, weil diese Empfindung allzu populär ist, hätte man ihr mißtrauen und sich fragen sollen, ob hier nicht oft der Unterschied von Nord und Süd innerhalb ein und derselben Formenwelt einen Unterschied von gotisch und antik vortäuscht. Der Laie wird, wenn man ihn vor die Frage stellt, ob der große Klosterhof von S. Maria Novella oder die Fassade des Palazzo Medici zur Gotik gehört, sicherlich falsch raten. Andernfalls hätte der plötzliche Wandel des Eindrucks nicht jenseits der Alpen, sondern erst jenseits des Apennins beginnen müssen, denn Toskana ist eine künstlerische Insel in Italien selbst. Oberitalien gehört einer byzantinisch gefärbten Gotik, Rom ist bereits die Stadt des Barock. Die Änderung der Empfindung erfolgt aber gleichzeitig mit der des Landschaftsbildes.
Tatsächlich hat Italien die Geburt des gotischen Stils nicht miterlebt. Es stand um 1000 unter der unbedingten Herrschaft morgenländischer Kunstformen. Erst die reife Gotik hat hier Wurzel gefaßt, aber als klimatisch gemilderte Fremdheit. Sie assimilierte oder verdrängte nicht etwa einen angeblichen Nachklang der Antike, sondern ausschließlich eine byzantinisch-sarazenische Formensprache, die von der Levante ausstrahlt und der Ravenna, Lucca, Pisa, Venedig, unter den einflußreichen Bauten das moscheenhafte Pantheon, San Marco, aber auch der Komposition und dem Geiste nach San Miniato und das Baptisterium in Florenz angehören.
[S. 323]
Wäre die Renaissance eine Erneuerung des antiken Weltgefühls gewesen — aber was heißt das? —, so hätte sie den Kultus des umschlossenen und rhythmisch gegliederten Raumes durch den des massiven Baukörpers ersetzen müssen. Aber davon ist nie die Rede gewesen. Im Gegenteil. Die Renaissance pflegt ganz ausschließlich eine Architektur des Raumes, den ihr die Gotik vorschrieb, nur daß sein Atem, seine klare, ausgeglichene Ruhe im Gegensatz zum Sturm und Drang, zur wilden Bewegtheit des Nordens anders ist, nämlich südlich, sonnig, sorglos, hingegeben. Nur darin liegt der Widerspruch. Man kann diese Architektur beinahe auf Fassaden und Höfe reduzieren.
Aber die Konzentration des Baugedankens auf eine Außenseite, welche den Geist der innern Struktur spiegelt, ist spezifisch nordisch und in einer sehr tiefen Weise mit der Porträtkunst verwandt, und der Hallenhof ist vom Sonnentempel zu Baalbek bis zum Löwenhof der Alhambra spezifisch arabisch.[72] Der Tempel von Pästum, ganz Körper, steht inmitten dieser Kunst vollkommen vereinsamt da. Ebensowenig ist die florentinische Plastik freie Rundplastik attischer Art. Jede ihrer[S. 324] Statuen fühlt noch eine unsichtbare Nische oder Wand hinter sich, in welche die gotische Plastik deren wirkliche Urbilder hineinkomponiert hatte.
Zieht man von den Vorbildern der Renaissance alles ab, was nach der augusteischen Zeit entstanden, also der magischen Formenwelt zugehörig ist, so bleibt buchstäblich nichts übrig. Nicht einmal die meist von Semiten entworfenen Bauten der Kaiserzeit, die Thermen, Tempel, Fora, haben wesentlich eingewirkt. Um so stärker wirkte Byzanz. Ich hatte schon auf die entscheidende Tatsache hingewiesen, daß jenes Motiv, welches die Renaissance geradezu beherrscht und seiner Südlichkeit wegen uns als ihr edelstes Kennzeichen gilt, die Verbindung von Rundbogen und Säule, allerdings höchst ungotisch, im antiken Stil aber gar nicht vorhanden ist, vielmehr das in Syrien entstandene Leitmotiv der magischen Architektur darstellt. Als wirklich am Ende des Quattrocento einige Meister begannen, streng antike Formen zu kopieren und den Inhalt römischer Schriften in akademische Wirklichkeit umzusetzen, war die Bewegung innerlich schon zu Ende. Nicht sie hat den Norden unterworfen und das Barock geschaffen. Der Barockstil, der legitime Erbe des gotischen, hat ihre Formen als Beute sich angeeignet.
Alles „Antigotische“, das sie heranzieht, ist demnach byzantinisch oder sarazenisch; der gesamte Kirchenstil Italiens — und eine Kunst ohne Beziehung zur Kirche ist damals kaum denkbar — stammt von den Sitzen arabischen Formgefühls. Und gerade jetzt empfängt man vom Norden die entscheidenden Einwirkungen, welche im Süden den Schritt von der Gotik zum Barock vollziehen halfen. In der flämisch-burgundischen Landschaft (dem Gegenpol von Toskana im Stilwerden!), zwischen Paris,[73] Amsterdam und Köln sind gleichzeitig um 1400 die Kunst des Kontrapunkts und der Ölmalerei entwickelt worden, jener durch Heinrich von Zeelandia, Dufay und Okeghem, diese durch Jan van Eyck und Rogier van der Weyden. 1428 kam Dufay in die päpstliche Kapelle und um 1450 war Rogier in[S. 325] Italien und übte dort einen kaum zu unterschätzenden Einfluß auf die florentiner Meister. Antonello da Messina, der um 1470 die Ölmalerei nach Venedig brachte, war der Schüler eines Flamländers. Wie viel Niederländisches und wie wenig „Antike“ ist in den Bildern von Filippo Lippi, Ghirlandajo und Botticelli, vor allem von Pollaiuolo! Was verdankt die römische und venezianische Schule dem Meister Willaert aus Brügge (1516 in Rom), dem Erfinder des Madrigals! Aus Flandern und Brabant dringt in die lombardische Gotik, die eben im Begriffe stand, durch die Aneignung südöstlicher Formen in Widerspruch zum nordischen Geist zu treten, eben jenes Element nordischen Unendlichkeitsgefühles, das den künstlerischen Geist der Renaissance wieder auflösen und durch die Sprache des Barock in den großen Strom zurückführen sollte.
Gerade damals führte auch Nikolaus Cusanus, Kardinal und Bischof von Brixen (1401–1464), das Infinitesimalprinzip, diese kontrapunktische Methode der Zahlen, in die Mathematik ein, die er aus der Idee Gottes als des unendlichen Wesens ableitete. Leibniz verdankt ihm die entscheidende Anregung zur Durchführung der Differentialrechnung. Aber damit bereits hatte er der dynamischen, der Barockphysik Newtons die Waffe geschmiedet, mit der sie die statische Idee einer südlichen Physik, die an Archimedes anknüpfte und noch in Galilei wirksam war, überwand.
Die Hochrenaissance ist der Augenblick einer scheinbaren Verdrängung des Musikalischen aus der faustischen Kunst. In Florenz, an dem einzigen Punkte, wo die antike und die abendländische Kulturlandschaft aneinandergrenzen, ist während einiger Jahrzehnte durch einen großartigen Akt ganz eigentlich metaphysischer Auflehnung ein Bild der Antike aufrecht erhalten worden, das seine tieferen Züge ohne Ausnahme der Negation gotischer verdankte und das dennoch seine Gültigkeit vor unserem Gefühl, wenn auch nicht vor unserer Kritik, über Goethe hinaus noch heute behauptet. Das Florenz des Lorenzo de Medici und das Rom Leos X. — das ist für uns antik; das ist das ewige Ziel unsrer geheimsten Sehnsucht; das allein erlöst von aller Schwere, aller Ferne, nur weil es antigotisch ist. So streng ist der Gegensatz apollinischen und faustischen Seelentums ausgeprägt.
[S. 326]
Aber man täusche sich nicht über den Umfang dieser Illusion. Man pflegte in Florenz Fresko und Relief, im Widerspruch zum gotischen Glasgemälde und zum arabischen Goldgrundmosaik. Es war die einzige Zeit des Abendlandes, wo die Skulptur den Rang einer freien Kunst einnahm. Im Bilde dominieren die Gruppen, die Körper, die tektonischen Elemente der Architektur. Die Hintergründe haben keinen eignen Wert und dienen nur als Folie für die greifbare Gegenwart der Vordergrundgestalten. Hier stand die Malerei eine Zeitlang unter der Herrschaft der Plastik. Verrocchio, Pollaiuolo und Botticelli waren Goldschmiede. Aber diese Fresken haben trotzdem nichts vom Geiste Polygnots. Hier wiederholt sich, was ich oben für die Architektur bemerkt hatte. Die große Tat Giottos und Masaccios, die Schöpfung einer Freskomalerei, scheint nur eine Erneuerung der alten Fühlweise zu sein. Das Tiefenerlebnis, das Ideal der Ausdehnung, welches ihr zugrunde liegt, ist nicht der apollinische raumlose, in sich beschlossene Körper, sondern der gotische Bildraum. So sehr die Hintergründe zurücktreten, sie sind doch da. Aber wieder ist es die Lichtfülle, die Durchsichtigkeit, die mittägige große Ruhe des Südens, die in Toskana und nur hier den dynamischen Raum zum statischen macht. Waren es auch Bildräume, die man malte, so erlebte man sie doch nicht als ein unbegrenztes, musikalisch-webendes Sein, sondern hinsichtlich ihrer sinnlichen Begrenztheit. Man gab ihnen gewissermaßen Körper. Man pflegte, mit einer wirklichen Nähe zum hellenischen Ideal, die Zeichnung, die scharfen Konturen, die körperlichen Grenzflächen — nur daß sie hier den einen perspektivischen Raum gegen die Dinge, in Athen die einzelnen Dinge gegen das Nichts abgrenzten —; und in demselben Grade, als die Woge der Renaissance sich wieder glättete, läßt die Härte dieser Tendenz nach und das sfumato Lionardos, das Verschwimmen der Ränder mit dem Hintergrund führt das Ideal einer musikalischen an Stelle einer reliefmäßigen Malerei herauf. Ebensowenig ist die latente Dynamik der toskanischen Skulptur zu verkennen. Zur Reiterstatue des Verrocchio würde man vergebens ein attisches Seitenstück suchen. Diese Kunst war eine Maske, eine Geste, zuweilen eine Komödie, aber nie ist eine Komödie besser zu Ende gespielt worden. Der unsagbar innigen[S. 327] Reinheit der Form gegenüber vergißt man, was die Gotik an Urgewalt und Tiefe voraus hat. Aber es muß noch einmal gesagt werden: die Gotik ist die einzige Grundlage der Renaissance. Die Renaissance hat die wirkliche Antike nicht einmal berührt, geschweige denn verstanden und „wiederbelebt“. Das unter literarischen Eindrücken stehende Bewußtsein einer sehr kleinen, erlesenen Klasse von Menschen hat den verführerischen Namen — Wiedergeburt der Antike — geprägt, um dem Negativen der Bewegung eine Wendung ins Positive zu geben. Er beweist, wie wenig solche Strömungen von sich selbst wissen. Man wird hier nicht ein großes Werk finden, das die Zeitgenossen des Perikles oder selbst die Cäsars nicht als völlig fremd abgelehnt hätten. Diese Palasthöfe sind maurische Höfe; die Rundbögen auf den schlanken Säulen sind syrischen Ursprungs. Cimabue lehrte sein Jahrhundert, die Kunst der byzantinischen Mosaiken mit dem Pinsel nachzubilden. Von den beiden berühmten Kuppelbauten der Renaissance ist die florentiner Domkuppel Brunellescos ein Meisterwerk der späten Gotik, die von St. Peter eines des strengen Barock. Und als Michelangelo sich vermaß, hier „das Pantheon auf die Maxentiusbasilika zu türmen“, wählte er zwei Bauwerke vom reinsten früharabischen Typus. Und das Ornament — ja, gibt es denn überhaupt ein echtes Renaissanceornament? Ich sehe in den frühflorentinischen Motiven der Majano, Ghiberti, Pisano etwas sehr Nordisches. Man unterscheide doch an all diesen Kanzeln, Grabmälern, Nischen, Portalen die äußerliche, übertragbare Form — als solche ist die ionische Säule ja selbst ägyptischer Herkunft — vom Geist der Formensprache, der sie als Mittel und Zeichen einverleibt wird. Alle antiken Details sind gleichgültig, solange sie etwas Unantikes durch die Art ihrer Verwendung ausdrücken. Aber bei Donatello kommen sie auch kaum vor. Bei allen Meistern einer Zeit sind sie weit seltener als im hohen Barock. Ein streng antikes Kapitäl wird man überhaupt nicht finden.
Und trotzdem ist für Augenblicke etwas Wunderbares erreicht worden, das durch Musik nicht wiederzugeben ist, ein Gefühl für das Glück der vollkommenen Nähe, für reine, ruhende, erlösende Raumwirkungen in einfachen Verhältnissen lichter[S. 328] Gliederung, frei von der leidenschaftlichen Bewegtheit von Gotik und Barock. Das ist nicht antik; denn die Antike kennt den Raum nicht, aber es ist ein Traum von antikem Dasein, der einzige, den die faustische Seele träumen, in dem sie sich vergessen konnte.
Und nun erst, mit dem 16. Jahrhundert, beginnt in der abendländischen Malerei die entscheidende Phase. Die Vormundschaft der Architektur im Norden, der Skulptur im Süden erlischt. Die Malerei wird polyphon, ins Unendliche schweifend. Die Farben werden Töne. Die Kunst des Pinsels wird dem Stil der Fuge unterworfen. Die Ölfarbentechnik wird zur Basis einer Kunst, die den Raum imaginieren will, an den die Dinge sich verlieren. Mit Lionardo beginnt der Impressionismus.
Im Gemälde vollzieht sich damit eine Umwertung aller Elemente. Der bis dahin gleichgültig entworfene, als Füllung angesehene, man möchte sagen als Raum verheimlichte Hintergrund gewinnt Bedeutung. Eine Entwicklung setzt ein, die in keiner andern Kultur, auch nicht in der sonst vielfach nahe verwandten chinesischen ihresgleichen hat: Der Hintergrund als das Zeichen des Unendlichen überwindet den sinnlich-greifbaren Vordergrund. Es gelingt endlich — das ist der malerische im Gegensatz zum zeichnerischen Stil —, das Tiefenerlebnis der faustischen Seele im Bilderlebnis restlos zu bannen. Der Horizont taucht im Bilde auf als großes Symbol des ewigen grenzenlosen Weltraumes, der die sichtbaren Einzeldinge als Zufälle in sich begreift. Man hat seine Darstellung im Landschaftsgemälde als so selbstverständlich empfunden, daß man nie die entscheidende Frage gestellt hat, wo überall er fehlt und was dieses Fehlen bedeutet. Man wird aber weder im ägyptischen Relief noch im byzantinischen Mosaik noch auf antiken Vasenbildern und Fresken, nicht einmal denen des Hellenismus mit ihrer Vordergrundräumlichkeit eine Andeutung des Horizontes finden. Der Begriff des Hintergrundes ist demnach auf all diese Künste gar nicht anwendbar. Diese Linie, in deren unwirklichem Duft Himmel und Erde verschwimmen, der Inbegriff und die stärkste[S. 329] Potenz des Fernen, enthält das Infinitesimalprinzip. Man denke auch an die Konvergenz unendlicher Reihen. Die perspektivischen Fernen sind das spezifisch musikalische Element im Bilde und die Landschaften Van de Capelles, Van de Veldes, Cuyps, Rembrandts sind deshalb ganz eigentlich nur Hintergründe, nur Atmosphären, wie umgekehrt „antimusikalische“ Meister wie Signorelli und vor allem Mantegna nur Vordergründe — „Reliefs“ — malten. In diesem Element siegt die Musik über die Plastik, die Kapazität der Ausdehnung über ihre Substanzialität. Man darf sagen, daß es in keinem Gemälde Rembrandts ein „vorn“ gibt. Im Norden, in der Heimat des Kontrapunkts, ist ein tiefes Verständnis für den Sinn des Horizontes und hell belichteter Fernen schon früh zu finden, während im Süden der flach abschließende Goldgrund arabisch-byzantinischer Bilder noch lange herrschend bleibt. In Miniaturen und Stundenbüchern (wie dem des Herzogs von Berry), bei frührheinischen Meistern taucht das reine Raumgefühl zuerst auf und erobert sich langsam das Tafelbild.
Denselben symbolischen Sinn haben die Wolken, deren künstlerische Behandlung der Antike gleichfalls völlig versagt war und die von den Malern der Renaissance mit einer gewissen spielerischen Oberflächlichkeit behandelt wurden, während der gotische Norden sehr früh wundervoll mystische Fernblicke auf und durch Wolkenmassen schafft und die Venezianer, vor allem Giorgione und Paul Veronese, den vollen Zauber der Wolkenwelt, der von schwebenden, ziehenden, geballten, tausendfarbig belichteten Wesen erfüllten Himmelsräume erschlossen und die Niederländer ihn bis zum Tragischen steigerten. Greco hat die große Kunst der Wolkensymbolik nach Spanien gebracht.
In der ebenfalls damals, zugleich mit der Ölmalerei und dem Kontrapunkt herangereiften Gartenkunst erscheinen dementsprechend die langgestreckten Teiche, Buchengänge, Alleen, Durchblicke, Galerien, um auch im Bilde der freien Natur dieselbe Tendenz zum Ausdruck zu bringen, welche die von den frühen Niederländern als Grundaufgabe ihrer Kunst empfundene und von Brunellesco theoretisch behandelte Linearperspektive im Gemälde repräsentiert. Man wird finden, daß sie, ich möchte[S. 330] sagen als die mathematische Weihe des durch den Rahmen seitlich abgegrenzten und in die Tiefe mächtig gesteigerten Bildraumes — Landschaft oder Interieur — gerade damals mit einer gewissen Absichtlichkeit zum Vortrag gebracht wurde. Das Ursymbol kündigt sich an. Im Unendlichen liegt der Punkt, in dem alle perspektivischen Linien zusammentreffen. Weil sie ihn vermied, weil sie die Ferne nicht anerkannte, besaß die antike Malerei keine Perspektive. Ihre Vasengemälde sind, als Einheit, weder Landschaft noch Innenraum, sondern Nichts, τὸ μὴ ὄν. Nur das einzelne gilt. Die Menschen sind, jeder für sich, als σώματα, ohne Beziehung auf etwas außer ihnen dargestellt. Sie bilden eine Summe, keine atmosphärisch zusammengefaßte Totalität. Folglich ist auch der Park, die bewußte Gestaltung der Natur im Sinne räumlicher Fernwirkung, innerhalb der antiken Künste unmöglich. Es gab in Athen und Rom keine perspektivische Gartenkunst. Erst die Kaiserzeit fand an orientalischen Anlagen Geschmack.
Das bedeutsamste Element im abendländischen Gartenbilde ist mithin der point de vue der großen Rokokoparks, auf den sich ihre Alleen und beschnittenen Laubgänge öffnen und durch den sich der Blick in weite schwindende Fernen verliert. Er fehlt selbst der chinesischen Gartenkunst. Aber er hat ein vollkommenes Gegenstück in gewissen hellen, silbernen „Fernfarben“ der pastoralen Musik des 18. Jahrhunderts, bei Couperin z. B. Erst der point de vue gibt den Schlüssel zum Verständnis dieser seltsamen menschlichen Art, die Natur der symbolischen Formensprache einer Kunst zu unterwerfen. Die Auflösung endlicher Zahlengebilde in unendliche Reihen ist das verwandte Prinzip. Wie hier die Formel des Restgliedes den letzten Sinn der Reihe, so ist es dort der Blick ins Grenzenlose, der dem Auge des faustischen Menschen den Sinn der Natur erschließt. Wir waren es und nicht die Hellenen, nicht die Menschen der Hochrenaissance, welche die unbegrenzten Fernsichten vom Hochgebirge aus schätzten und suchten. Das ist eine faustische Sehnsucht. Man will allein mit dem unendlichen Raume sein. Dies Symbol bis zum äußersten zu steigern war die große Tat der nordfranzösischen Gartenbaumeister, vor allem Lenôtres. Man vergleiche den Renaissancepark der mediceischen Zeit mit[S. 331] seiner Übersichtlichkeit, seiner heitren Nähe und Rundung, dem Kommensurablen seiner Linien, Umrisse und Baumgruppen mit diesem geheimen Zug in die Ferne, der alle Wasserkünste, Statuenreihen, Gebüsche, Labyrinthe bewegt, und man findet in diesem Stück Gartengeschichte das Schicksal der abendländischen Ölmalerei wieder.
Aber Ferne — das ist zugleich eine historische Empfindung. Der Barockpark ist der Park der späten Jahreszeit, des nahen Endes, der fallenden Blätter. Ein Renaissancepark ist für den Sommer und den Mittag gedacht. Er ist zeitlos. Nichts in seiner Formensprache erinnert an Vergänglichkeit. Erst die Perspektive ruft die Ahnung von etwas Vergehendem, Flüchtigem, Letztem wach.
Schon das bloße Wort „Ferne“ hat in der abendländischen Lyrik aller Sprachen einen wehmütig herbstlichen Akzent, den man in der griechischen vergebens sucht. Die moderne Poesie der welkenden Alleen, der endlosen Straßenzüge unserer Weltstädte, der Pfeilerreihen eines Domes, der Gipfel einer fernen Gebirgskette, verrät noch einmal, daß das Tiefenerlebnis, das uns den Weltraum schafft, im letzten Grunde die innere Gewißheit eines Schicksals, einer vorbestimmten Richtung, der Zeit, des Unwiderruflichen ist. Hier, im Erlebnis des Horizontes als der Zukunft, tritt die Identität der Zeit mit der „dritten Dimension“ des erlebten Raumes unmittelbar zutage. Es ist ein eminent historisches Gefühl, eine Richtung der ganzen Seele auf Ferne und Zukunft, das den großen Parks ihre Gestalt gab. Baudelaire, Verlaine und Droem haben es in Verse gebracht. Die Ägypter, darin uns nahe verwandt, legten es ihrer Architektur durch das Prinzip der zyklischen Wiederholung zugrunde; sie schufen Alleen von Lotossäulen, Statuen und Sphinxen. Wir haben zuletzt auch das Straßenbild der großen Städte dieser Grundidee des Versailler Parkes unterworfen und mächtige geradlinige, in der Ferne schwindende Straßenfluchten angelegt, selbst unter Aufopferung althistorischer Viertel — deren Symbolik jetzt die geringere geworden war —, während antike Weltstädte mit ängstlicher Sorgfalt das Gewirr krummer Gäßchen vorschoben, damit der apollinische Mensch sich in ihnen als Körper unter Körpern fühle. Das „praktische[S. 332] Bedürfnis“ war hier wie immer die Maske eines tiefinnerlichen Zwanges.
Der Horizont sammelt von nun an die tiefere Form, die metaphysische Bedeutung des Bildes in sich. Der greifbare und mit Worten wiederzugebende Inhalt — nicht Gehalt —, womit die körperliche Realität gemeint ist, die von der Renaissancemalerei allein betont und anerkannt worden war, wird nun zum Mittel, zum Träger des Ausdrucks. Bei Mantegna und Signorelli hätte der gezeichnete Entwurf, auch ohne die koloristische Ausführung, als Bild bestehen können. In einzelnen Fällen möchte man wünschen, es wäre bei den Kartons geblieben. In statuenhaften Kompositionen ist die Farbe lediglich etwas Akzidentielles. Tizian aber mußte von Michelangelo den Vorwurf hören, daß er nicht zu zeichnen verstünde. Der „Gegenstand“, eben das, was sich durch Umrißzeichnung festhalten läßt, das Nahe, Stoffliche, hat, künstlerisch betrachtet, seine Wirklichkeit verloren und von nun an herrscht in der Ästhetik, die unter den theoretischen Eindrücken der Renaissance stehen blieb, jener seltsame nie endende Streit um „Form“ und „Inhalt“ im Kunstwerk. Die Formulierung beruht auf einem Mißverständnis und hat den sehr bedeutenden Sinn der Frage verdeckt. Ob die Malerei plastisch oder musikalisch aufgefaßt werden solle, als Statik von Dingen oder als Dynamik des Raumes — denn darin liegt der Gegensatz von Fresko- und Öltechnik —, ist das erste, der Gegensatz apollinischen und faustischen Formgefühls das zweite, was zu erwägen war. Umrisse begrenzen Stoffliches, Licht und Schatten interpretieren den Raum. Aber das eine ist von unmittelbar sinnlicher Natur. Es erzählt. Der Raum ist seinem Wesen nach transzendent. Er spricht zur Einbildungskraft. Er repräsentiert eine Idee. Für eine Kunst, die unter seiner Symbolik steht, ist das erzählende Moment eine Herabsetzung und Verdunkelung der tieferen Tendenz, und ein Theoretiker, der hier ein Mißverhältnis zwischen Sollen und Wollen fühlt, aber nicht begreift, klammert sich an den nächstliegenden und trivialen Gegensatz von Inhalt und Form. Das Problem ist ein rein abendländisches und es enthüllt in einer selten lehrreichen Weise die vollkommene Umkehrung, die sich in der Bedeutung der Bildelemente mit dem Abschluß der Renaissance und der Heraufkunft[S. 333] einer Musik großen Stils vollzogen hat. Mit „Inhalt“ wird immer wieder der optisch-körperliche Eigenwert der dargestellten Objekte gemeint (worüber sich die Gegner des Impressionismus zu täuschen pflegen). Dies ist die euklidische Form der Malerei, welche die Antike und also auch, im Rahmen der gotischen Formensprache, Florenz gepflegt hatten. Die Antike konnte mithin ein Problem wie das von Form und Inhalt gar nicht besitzen. Für eine attische Statue ist beides vollkommen identisch: der menschliche Leib. Der Fall der Barockmalerei wird noch verwickelter durch den Widerstreit des volkstümlichen und des höheren Empfindens. Alles Euklidisch-greifbare ist auch populär und das „Altertum“ mithin die populäre Kunst par excellence. Dies ist nicht zum wenigsten der unnennbare Reiz, den alles Antike auf faustische Geister ausübt, die ihren Ausdruck erkämpfen, der Welt abringen müssen. Hier braucht nichts erobert zu werden. Es gibt sich von selbst. Und etwas Verwandtes hat der antigotische Zug in Florenz hervorgerufen. Raffael ist populär, Rembrandt kann es nicht sein. Seit Tizian ist die Malerei immer esoterischer geworden, auch die Poesie, auch die Musik. Die Gotik — Dante, Wolfram — war es von Anfang an gewesen. Die große Menge der Kirchenbesucher ist gar nicht imstande, Motetten von Bach und Palestrina zu verstehen. Sie langweilt sich bei Mozart und Beethoven. Sie läßt Musik lediglich auf die Stimmung wirken. In Konzerten und Galerien redet man sich nur Interesse an diesen Dingen ein, seit die Aufklärung die Phrase von der Kunst für alle geprägt hat. Aber eine faustische Kunst ist nicht für alle. Das gehört zu ihrem innersten Wesen. Wenn die neuere Malerei sich nur noch an einen kleinen Kreis von Kennern wendet, der immer enger wird, so entspricht das der Abwendung vom gemeinverständlichen novellistischen Gegenstande. Damit ist dem sinnlichen Detail der Eigenwert aberkannt und die eigentliche Wirklichkeit dem Raume zugesprochen, durch den — nach Kant — erst die Dinge sind. Es ist seitdem ein schwer zugängliches metaphysisches Element in die Malerei gekommen, das sich dem Laien nicht preisgibt. Aber bei Phidias würde das Wort Laie keinen Sinn haben. Seine Plastik wendet sich ganz an das leibliche, nicht das geistige Auge. Eine raumlose Kunst ist a priori unphilosophisch.
[S. 334]
Hiermit hängt ein wichtiges Prinzip der Komposition zusammen. Man kann im Gemälde die einzelnen Dinge unorganisch über-, neben-, hintereinander stellen, ohne Perspektive und Distanz, d. h. ohne die Abhängigkeit ihrer Wirklichkeit von der Struktur des Raumes zu betonen, womit nicht gesagt ist, daß man sie leugnet. So zeichnen Naturmenschen und Kinder, bevor das Tiefenerlebnis als Ausdruck eines höheren inneren Seins die sinnlichen Welteindrücke einem ordnenden Prinzip unterwirft. Aber dies Prinzip ist dem Ursymbol gemäß in jeder Kultur ein anderes. Die uns selbstverständliche Art perspektivischer Ordnung ist ein Einzelfall und von keiner anderen Malerei weder anerkannt noch gewollt. Die ägyptische Kunst wählte grundsätzlich die Darstellung mehrerer gleichzeitiger Vorgänge in Reihen übereinander. So wurde die dritte Dimension aus dem Bildeindruck ausgeschaltet. Die apollinische Kunst legte mehr und mehr Gewicht auf den einzelnen Körper und stellte isolierte Figuren und Gruppen unter absichtlicher Vermeidung räumlicher und zeitlicher Beziehungen in die Bildfläche. Polygnots Fresken in der Lesche von Delphi waren ein berühmtes Beispiel. Ein Hintergrund, der die einzelnen Szenen verbunden hätte, fehlt. Er würde die Bedeutung der Dinge als des allein Wirklichen — gegenüber dem Raum als dem Nichtseienden — in Frage gestellt haben. Die Giebel des Tempels von Ägina und des Parthenon enthalten eine Mehrzahl von Einzelfiguren, keinen Organismus. Hierin empfand die Renaissance mit Notwendigkeit gotisch, d. h. räumlich. Erst der Hellenismus — der Telephosfries des Altars von Pergamon ist das früheste erhaltene Beispiel — bringt das unantike Motiv der fortlaufenden Reihe, das in den Triumphsäulen der Kaiserzeit seltsame Blüten getrieben hat. Aber das ist bereits Verismus, die spezifisch weltstädtische Art, Kunst zu machen, rein virtuosenhaft, ohne ein in der Tiefe wirkendes Symbol. Das ist außerdem Ägyptizismus, der in dieser Zivilisation seit 300 eine ähnliche Rolle spielt wie der Japanismus für das 19. Jahrhundert. Man entlehnt exotische Formen, um einen Stil und damit die Illusion einer großen Kunst hervorzubringen.
[S. 335]
Die Barockmalerei ist demgegenüber an der einen Aufgabe zur Höhe emporgewachsen, den unendlichen Raum mittels der Farbe zu schaffen. Sie spricht den Dingen nur insofern Wirklichkeit zu, als sie Träger der Farbe und Zeugen atmosphärischer Lichtwirkungen sind und dadurch die reine, nichtstoffliche Ausdehnung zum Ausdruck bringen. Der Gegenstand wird zum Mittel, das im Raum symbolisierte Weltgefühl zum eigentlichen Inhalt des Gemäldes. Deshalb verschwindet mit dem Ende der Renaissance zugleich mit der Plastik — als einer weiterer Entwicklung nicht mehr fähigen Kunst — auch das Fresko und das Relief und an die Stelle der figurenreichen Vordergrundszenen, über die man den Raum vergißt, treten die „heroische Landschaft“ und das Interieur,[74] die beide dem spezifischen Problem des Raumes den reinsten Ausdruck gestatten. Die Darstellung von Luft und Licht nimmt die Darstellung von Szenen lediglich zum Vorwand.
Und nun folgt vom Ende der Renaissance an, von Orlando Lasso und Palestrina bis auf Wagner eine ununterbrochene Reihe großer Musiker und von Tizian bis auf Manet, Marées und Leibl eine Reihe großer Maler aufeinander, während die Plastik zur völligen Bedeutungslosigkeit herabsinkt. Ölmalerei und polyphone Musik durchlaufen eine organische Entwicklung, deren Ziel in der Gotik begriffen und im Barock erreicht wurde. Beide Künste — faustisch im höchsten Sinne — sind innerhalb dieser Grenzen Urphänomene. Sie haben eine Seele, eine Physiognomie und also eine Geschichte, und zwar sie allein. Die Bildhauerei beschränkt sich auf ein paar schöne Zufälle im Schatten der Malerei, Gartenkunst oder Architektur. Aber sie sind im Bilde der abendländischen Kunst entbehrlich. Es gibt keinen plastischen Stil mehr, wie es einen malerischen und musikalischen Stil gibt. Es gibt so wenig eine geschlossene Tradition wie einen notwendigen Zusammenhang der Werke untereinander. Schon in Lionardo entsteht allmählich eine starke Verachtung der Bildhauerei. Er läßt höchstens den Bronzeguß seiner malerischen[S. 336] Qualitäten wegen gelten, im Gegensatz zu Michelangelo, dessen Element damals der weiße Marmor war. Aber auch ihm will im hohen Alter keine plastische Arbeit mehr gelingen. Keiner der späteren Bildhauer ist groß in dem Sinne, wie Rembrandt und Bach groß sind und man wird zugeben, daß sich wohl eine tüchtige und geschmackvolle Leistung, aber kein Werk denken läßt, das im Range neben der Nachtwache oder der Matthäuspassion steht und in gleicher Weise die Tiefe eines ganzen Menschentums erschöpft. Diese Kunst hat aufgehört, das Schicksal ihrer Kultur zu sein. Ihre Sprache bedeutet nichts mehr. Es ist völlig unmöglich, das, was in einem Bildnis Rembrandts liegt, in einer Büste wiederzugeben. Wenn einmal ein Bildhauer von einiger Bedeutung auftaucht wie Bernini, Puget oder Schlüter — es ist naturgemäß keiner unter ihnen, der über das Dekorative hinaus zu einer großen Symbolik gelangte —, so erscheint er als verspäteter Schüler der Renaissance (Thorwaldsen), als verkappter Maler (Houdon), Architekt (Bernini, Schlüter) oder Dekorateur (Pigalle) und er beweist durch sein Erscheinen nur noch deutlicher, daß diese eines faustischen Gehaltes nicht fähige Kunst keine Bedeutung, mithin keine Seele und keine Geschichte im Sinne einer eigentlichen Stilentwicklung mehr hat. Dasselbe gilt dementsprechend von der antiken Musik, die in den reifen Jahrhunderten der Ionik (650–350) den beiden apollinischen Künsten, Plastik und Freskomalerei, das Feld räumen und mit dem Verzicht auf Harmonie und Polyphonie auch auf den Rang einer organisch sich entwickelnden höheren Kunst verzichten mußte.
Die antike Malerei beschränkte ihre Palette auf gelb, rot, schwarz und weiß. Diese merkwürdige Tatsache ist früh bemerkt worden und hat, da man andere als oberflächliche und ausgesprochen materialistische Gründe gar nicht in Betracht zog, zu törichten Hypothesen wie der von einer angeblichen Farbenblindheit der Griechen geführt. Auch Nietzsche hat davon geredet (Morgenröte 426).
Aber aus welchem Grunde vermied diese Malerei in ihrer besten Zeit das Blau und sogar noch das Blaugrün und ließ[S. 337] erst bei den grüngelben und bläulichroten Tönen die Skala der erlaubten Nuancen beginnen? Ohne Zweifel kommt das Ursymbol der euklidischen Seele in dieser Beschränkung zum Ausdruck.
Blau und Grün sind die Farben des Himmels, des Meeres, der fruchtbaren Ebene, der Schatten an südlichen Mittagen, des Abends und der entfernten Gebirge. Sie sind wesentlich atmosphärische, nicht gegenständliche Farben. Sie sind kalt; sie entkörpern und rufen die Eindrücke des Weiten, Fernen und Grenzenlosen hervor.
Deshalb geht, während das Fresko Polygnots sie streng vermeidet, ein „infinitesimales“ Blau und Grün von den Venezianern an bis ins 19. Jahrhundert als raumschaffendes Element durch die ganze Geschichte der perspektivischen Ölmalerei. Und zwar als Grundton von ganz überwiegendem Range, der den Gesamtsinn der Farbengebung trägt, als Generalbaß, während die warmen gelben und roten Töne erst danach gestimmt sind. Es ist nicht das satte, freudige, nahe Grün gemeint, das Raffael oder Dürer bei Gewändern gelegentlich — und selten genug — verwenden, sondern ein unbestimmbares, in tausend Schattierungen ins Weiße, Graue, Braune spielendes Blaugrün, etwas spezifisch Musikalisches, in das die ganze Atmosphäre vor allem auch auf guten Gobelins getaucht ist. Was man im Gegensatz zur Linearperspektive Luftperspektive genannt hat und im Gegensatz zur Renaissanceperspektive Barockperspektive hätte nennen können, beruht fast ausschließlich auf ihm. Man findet es in Italien mit steigender Kraft der Tiefenwirkung bei Lionardo, Guercino, Albani, in Holland bei Ruysdael und Hobbema, vor allem aber bei den großen Franzosen, von Poussin, Lorrain und Watteau an bis zu Corot. Das Blau, ebenfalls eine perspektivische Farbe, steht immer in Beziehung zum Dunklen, Lichtlosen, Unwirklichen. Es dringt nicht ein, sondern zieht in die Ferne. „Ein reizendes Nichts“ hat es Goethe in seiner Farbenlehre genannt.
Blau und Grün sind transzendente, unsinnliche Farben. Sie fehlen im strengen Freskogemälde attischen Stils und also herrschen sie in der Ölmalerei. Gelb und Rot, die antiken Farben, sind die der Materie, der Nähe und der animalischen Gefühle. Rot ist die eigentliche Farbe der Sinnlichkeit; deshalb[S. 338] ist es die einzige, die auf Tiere wirkt. Sie steht dem Symbol des Phallus — und also der Statue und der dorischen Säule — am nächsten, wie andrerseits ein reines Blau den Mantel der Madonna verklärt. Diese Beziehung hat sich mit tiefgefühlter Notwendigkeit in allen großen Schulen von selbst eingestellt. Violett — ein Rot, das vom Blau überwunden wird — ist die Farbe der Frauen, die nicht mehr fruchtbar sind und der im Zölibat lebenden Priester.
Gelb und Rot sind die populären Farben, die der Menge, der Kinder und der Wilden. Bei den Spaniern und Venezianern wählt der Vornehme — aus dem unbewußten Gefühl einer abweisenden Distanz — ein prächtiges Schwarz oder Blau. Gelb und Rot sind endlich— als die euklidischen, apollinischen Farben — die des Vordergrundes, auch im geistigen Sinne, die einer lärmenden Geselligkeit, des Marktes, der Volksfeste, die des naiven Vorsichhinlebens, des antiken Fatums und des blinden Zufalls, des punktförmigen Daseins. Blau und Grün — faustische Farben — sind die der Einsamkeit, der Sorge, der Beziehung des Augenblicks auf Vergangenheit und Zukunft, des Schicksals als der dem Weltall immanenten Fügung.
Die Beziehung des shakespeareschen Schicksals zum Raume, des sophokleischen (des sinnlosen) zur Materie war oben festgestellt worden. Alle Kulturen von tiefer Transzendenz, alle, deren Ursymbol eine Überwindung des Augenscheins, ein Leben als Kampf, nicht als Hinnahme von Gegebenem fordert, haben zum Raume wie zum Blau und Schwarz denselben metaphysischen Hang. Blau ist die Farbe der Trauer bei den Chinesen; auch die Farbe Werthers war blau. Es besteht für mich kein Zweifel, daß die attische Bühne gerade diese Farbe vermieden hat. Sie widerspricht dem Geiste ihrer Tragik.
Die Symbolik der Farben kann hier nicht weiter entwickelt werden. Tiefe Beobachtungen über das Verhältnis zwischen der Idee des Raumes und dem Sinn der Farben finden sich in Goethes Studien über die entoptischen Farben in der Atmosphäre. Mit der von ihm in der Farbenlehre gegebenen Symbolik stimmt die hier aus den Ideen von Raum und Schicksal abgeleitete vollkommen überein.
Die bedeutendste Verwendung eines düsteren Grün als der Farbe des Schicksals findet sich bei Grünewald, dessen Nächte von einer unbeschreiblichen Mächtigkeit des Raumes nur von[S. 339] Rembrandt wieder erreicht werden. Hier gewinnt man auch den Eindruck, als ob man dies bläuliche Grün, dieselbe Farbe, in welche das Innere der großen Dome so oft gehüllt ist, als die spezifisch katholische Farbe bezeichnen dürfe, vorausgesetzt, daß man allein das durch das lateranische Konzil von 1215 begründete und im Tridentinum endgültig fixierte nordische Christentum mit der Eucharistie als Mittelpunkt katholisch nennt. Diese Farbe steht in ihrer schweigsamen Größe sicherlich dem prunkvollen Goldgrunde altchristlich-byzantinischer Bildwerke ebenso fern wie den geschwätzig-heitren, „heidnischen“ Farben bemalter hellenischer Tempel und Statuen. Man beachte, daß die Wirksamkeit dieser Farbe Innenräume voraussetzt im Gegensatz zum Gelb und Rot; die antike Malerei ist eine ebenso entschieden öffentliche wie die abendländische eine Atelierkunst. Die gesamte große Ölmalerei von Lionardo bis zum Ende des 18. Jahrhunderts ist nicht für das grelle Tageslicht gedacht. Hier kehrt der Gegensatz von Kammermusik und freistehender Statue wieder. Die oberflächliche Begründung dieses Phänomens durch das Klima wird, wenn es überhaupt nötig wäre, durch das Beispiel der ägyptischen Malerei widerlegt.
Die zunächst bizarre Tatsache der hellenischen Vierfarbenmalerei ist nun erklärt. Da der unendliche Raum für das antike Lebensgefühl ein vollkommenes Nichts ist, so würden Blau und Grün mit ihrer entwirklichenden und Fernen schaffenden Kraft die Alleinherrschaft des Vordergrundes, der vereinzelten Körper und damit den eigentlichen Sinn apollinischer Kunstwerke in Frage gestellt haben. Dem Auge eines Atheners wäre ein Gemälde in den Farben Watteaus wesenlos und von einer schwer in Worte zu fassenden innern Leere und Unwahrheit erschienen. Durch diese irrealen Farben wird die sinnlich empfundene, das Licht reflektierende Fläche nicht als Grenze eines Dinges, sondern als die des umgebenden Raumes gewertet. Deshalb fehlen sie dort und herrschen sie hier.
Die arabische Kunst hat das magische Weltgefühl durch den Goldgrund ihrer Mosaiken und Tafelbilder zum Ausdruck[S. 340] gebracht. Man lernt seine verwirrend märchenhafte Wirkung und mithin seine symbolische Absicht aus den Mosaiken von Ravenna und den von lombardisch-byzantinischen Vorbildern noch stark abhängigen frührheinischen und vor allem norditalienischen Meistern kennen, nicht zum wenigsten auch durch gotische Buchillustrationen, deren Vorbilder die byzantinischen Purpurcodices waren. Die Seele dreier Kulturen ist hier an einer nahe verwandten Aufgabe zu prüfen. Die apollinische erkannte nur das in Ort und Zeit unmittelbar Gegenwärtige als wirklich an — und sie verleugnete den Hintergrund in ihren Bildwerken; die faustische strebte über alle sinnlichen Schranken ins Unendliche — und sie verlegte den Schwerpunkt des Bildgedankens mittels der Perspektive in die Ferne; die magische empfand alles Gewordene und Ausgedehnte als die Inkarnation rätselhafter Mächte — und sie schloß die Szene durch einen Goldgrund ab, das heißt durch ein Mittel, das jenseits alles Farbig-Natürlichen steht. Gold ist überhaupt keine Farbe. Dem Gelb gegenüber entsteht der komplizierte sinnliche Eindruck durch die metallische diffuse Reflexion eines an der Oberfläche durchscheinenden Mittels. Farben — sei es die farbige Substanz der geglätteten Wandfläche (Fresko) oder das mit dem Pinsel aufgetragene Pigment — sind natürlich; der in der Natur so gut wie nie vorkommende Metallglanz[75] ist übernatürlich. Erinnern wir uns, daß als magische Naturforschung die Alchymie neben der apollinischen Statik und der faustischen Dynamik steht. Der Goldgrund ist das Symbol eines nicht in Regeln zu bannenden Geheimnisses. Man denke an den „Stein der Weisen“. Die arabische Kultur ist die der Offenbarungsreligionen — des Judentums, des Christentums, des Islam. Dies wunderbare Element repräsentiert an dieser Stelle im Bilde, inmitten eines farbigen Ganzen, eine fremde Welt. Vor allem ist der Eindruck[S. 341] ein völlig abstrakter und unorganischer. Alle wirklichen Körper sind farbig, die wirkliche Atmosphäre ist es auch. Das leuchtende Gold nimmt also der Szene, dem Leben, den Körpern ihre ontologische Wirklichkeit. Alles, was im Kreise Plotins und der Gnostiker über das Wesen der Dinge, ihre Unabhängigkeit vom Raume, ihre zufälligen Ursachen gelehrt wurde — für unser Weltgefühl höchst paradoxe und unverständliche Ansichten —, liegt in der Symbolik dieses rätselhaften hieratischen Hintergrundes. Das Wesen der Körper war ein wichtiger Streitpunkt der Schulen von Bagdad und Basra. Suhrawardi unterschied Ausdehnung als das primäre Wesen des Körpers von seiner Breite, Höhe und Tiefe als den Akzidentien. Von Nazzâm werden den Atomen körperliche Substanz und das Merkmal der Raumerfüllung abgesprochen. Das alles waren metaphysische Probleme, die von Philo und Paulus an bis auf die letzten Größen der islamischen Philosophie das arabische Weltgefühl offenbarten. Sie spielen in den Streitigkeiten der Konzile über das Wesen Gottes und die Person Christi eine große Rolle. Der Goldgrund jener Gemälde hat also eine ausgesprochen dogmatische Bedeutung. Er drückt das Wesen und Walten der Gottheit aus. Er repräsentiert die arabische Gestalt des christlichen Weltbewußtseins, und es hängt tief damit zusammen, daß diese Behandlung des Hintergrundes für Darstellungen aus der christlichen Legende tausend Jahre lang als die einzige metaphysisch, selbst ethisch mögliche und würdige erscheint. Als die ersten „wirklichen“ Hintergründe in der frühen Gotik auftauchen, mit blaugrünem Himmel, weitem Horizont und Tiefenperspektive, wirken sie zunächst „profan“, weltlich, und man hat den dogmatischen Wandel, der sich hier verriet, wohl gefühlt, wenn auch nicht erkannt. Wir sahen, wie gerade damals, als im lateranischen Konzil das faustische — germanisch-katholische — Christentum zum Bewußtsein seiner selbst gelangt war, eine neue Religion im alten Gewande, in der Kunst der Franziskaner die perspektivische und farbige, den Luftraum erobernde Tendenz den ganzen Sinn der Malerei umgestaltete. Das abendländische Christentum verhält sich zum morgenländischen wie das Symbol der Perspektive zu dem des Goldgrundes, und das endgültige Schisma tritt in der Kirche und Kunst gleichzeitig[S. 342] ein. Man begreift den landschaftlichen Hintergrund der Bildszene zugleich mit der dynamischen Unendlichkeit Gottes; und zugleich mit den Goldgründen der kirchlichen Gemälde verschwinden aus den abendländischen Konzilien jene magischen, ontologischen Gottheitsprobleme, welche alle orientalischen wie das von Nicäa leidenschaftlich bewegt hatten.
Die Venezianer haben die Handschrift des sichtbaren Pinselstrichs entdeckt und als eminent raumschaffendes Motiv in die Ölmalerei eingeführt. Von den florentiner Meistern war die antikisierende und doch dem gotischen Formgefühl dienende Manier, durch Glättung aller Übergänge reine, scharf umrissene, ruhende Farbflächen zu schaffen, nie angegriffen worden. Ihre Bilder haben etwas Seiendes. Erst in der sichtbar bleibenden, gleichsam nie erstarrenden Arbeit des Pinsels kommt ein historisches Empfinden zum Vorschein. Man will im Werk des Malers nicht nur etwas sehen, das geworden ist, sondern auch etwas, das wird. Das hatte die Renaissance vermeiden wollen. Ein Gewandstück des Perugino erzählt nichts von seiner künstlerischen Entstehung. Es ist fertig, gegeben, schlechthin gegenwärtig. Die einzelnen Pinselstriche, die man als eine vollkommen neue Formensprache zuerst in den Alterswerken Tizians trifft, Akzente eines Temperaments, die unvermittelt nebeneinander stehen, sich kreuzen, decken, verwirren, bringen eine unendliche Bewegtheit in das farbige Element. Auch die gleichzeitige geometrische Analysis läßt ihre Objekte werden, nicht sein. Jedes Gemälde hat eine Geschichte und verschweigt sie nicht. Vor ihm fühlt der faustische Mensch, daß er eine seelische Entwicklung hat. Vor jeder großen Landschaft eines Barockmeisters darf man das Wort „historisch“ aussprechen, um einen Sinn in ihr zu fühlen, der einer attischen Statue gänzlich fremd ist. Das ewige Werden, die gerichtete Zeit, das dynamische Weltenschicksal ruht auch in der Melodik dieser ruhelosen und grenzenlosen Striche. Malerischer und zeichnerischer Stil: das bedeutet, von dieser Seite gesehen, den Gegensatz von historischer und ahistorischer Form, von Betonung oder Verleugnung des genetischen[S. 343] Moments, von Ewigkeit und Augenblick. Ein antikes Kunstwerk ist ein Ereignis, ein abendländisches eine Tat. Das eine symbolisiert ein punktförmiges Jetzt, das andere eine organische Entwicklung. Die Physiognomik der Pinselführung, eine völlig neue, unendlich reiche und persönliche, keiner andern Kultur bekannte Art von Ornamentik, ist spezifisch musikalisch. Man kann etwa das allegro feroce des Franz Hals dem andante con moto Van Dycks gegenüberstellen. Von nun an gehört der Begriff des Tempo zum malerischen Vortrag und er erinnert daran, daß diese Kunst die eines Seelentums ist, das im Gegensatz zum antiken nichts vergißt und vergessen sehen will, was einmal war.
Das luftige Gewebe der Pinselstriche löst aber zugleich die sinnliche Oberfläche der Dinge auf. Die Konturen verschwinden im Helldunkel. Der Betrachter muß weit zurücktreten, um aus farbigen Raumwerten körperhafte Eindrücke zu gewinnen. Es ist dies buchstäblich die malerische Fassung der Kantschen Theorie vom Raume als der apriorischen Anschauungsform, durch welche die Dinge in Erscheinung treten.
Zugleich erscheint von nun an ein Symbol höchsten Ranges im abendländischen Gemälde, das „Atelierbraun“, und beginnt die Wirklichkeit aller Farben mehr und mehr zu dämpfen. Die älteren Florentiner kannten es noch nicht, so wenig wie die alten niederländischen und rheinischen Meister. Pacher, Dürer, Holbein sind, so leidenschaftlich ihre Tendenz zur räumlichen Tiefe erscheint, frei davon. Erst das 16. Jahrhundert gehört ihm. Dies Braun verleugnet seine Herkunft aus dem „infinitesimalen“ Grün der Hintergründe Lionardos, Schongauers und Grünewalds nicht, aber es besitzt die größere Macht über die Dinge. Es führt den Kampf des Raumes gegen das Stoffliche zu Ende. Es überwindet auch das primitivere Mittel der Linearperspektive mit ihrem an architektonische Bildmotive gebundenen Renaissancecharakter. Es steht mit der impressionistischen Technik der sichtbaren Pinselstriche dauernd in einer geheimnisvollen Verbindung. Beide lösen das greifbare Dasein der sinnlichen Welt — der Welt des Augenblicks und der Vordergründe — endgültig in atmosphärischen Schein auf. Die Linie verschwindet aus dem Bilde. Der magische Goldgrund hatte nur von einem rätselhaften[S. 344] Jenseits geträumt, das die Gesetzlichkeit der Körperwelt beherrscht und durchbricht; das Braun dieser Gemälde öffnet den Blick in eine reine formvolle Unendlichkeit. Im Werden des abendländischen Stils bezeichnet seine Entdeckung einen Höhepunkt. Diese Farbe hat im Gegensatz zu dem vorhergehenden Grün etwas Protestantisches. Der nordische abstrakte Pantheismus des 18. Jahrhunderts, wie ihn die Verse der Erzengel im Prolog von Goethes Faust ausdrücken, ist in ihm vorweggenommen. Die Atmosphäre des König Lear und Macbeth ist ihm verwandt. Das gleichzeitige Streben der instrumentalen Musik nach immer reicheren Dissonanzen, die Einführung der Sexte, Septime, Undezime, entspricht durchaus der neuen Tendenz in der Ölmalerei, von den reinen Farben aus durch die Unzahl bräunlicher Schattierungen und die Kontrastwirkung unvermittelt nebeneinander gesetzter Farbenstriche eine malerische Chromatik zu schaffen. Beide Künste breiten nun durch ihre Ton- und Farbenwelten — Farbentöne und Tonfarben — eine Atmosphäre reinster Räumlichkeit aus, die nicht mehr den Menschen als Gestalt, als Leib, sondern die hüllenlose Seele selbst umgibt und bedeutet. Eine Innerlichkeit wird erreicht, der in den tiefsten Werken Rembrandts und Beethovens kein Geheimnis sich mehr verschließt — eine Innerlichkeit allerdings, welche der apollinische Mensch durch seine streng somatische Kunst abgewehrt hatte.
Die alten Vordergrundfarben, Gelb und Rot — die antiken Töne — werden von nun an seltener und immer als bewußte Kontraste zu Fernen und Tiefen gebraucht, die sie steigern und betonen sollen (außer bei Rembrandt vor allem bei Vermeer). Dies der Renaissance vollkommen fremde atmosphärische Braun ist die unwirklichste Farbe, die es gibt. Es ist die einzige „Grundfarbe“, die dem Regenbogen fehlt. Es gibt weißes, gelbes, grünes, rotes, blaues Licht von vollkommenster Reinheit. Ein reines braunes Licht liegt außerhalb der Möglichkeiten unsrer Natur. Alle die grünlichbraunen, silbrigen, feuchtbraunen, tiefgoldigen Töne, die bei Giorgione in prachtvollen Nuancen erscheinen, bei den großen Niederländern immer kühner werden und sich gegen Ende des 18. Jahrhunderts verlieren, entkleiden die Natur ihrer Realität. Darin liegt beinahe ein religiöses Bekenntnis.[S. 345] Bei Constable, dem Begründer einer zivilisierten Malweise, ist es ein andres Wollen, das nach Ausdruck sucht, und dasselbe Braun, das er bei den Holländern studiert hatte und das damals Schicksal, Gott, den Sinn des Lebens bedeutete, bedeutet ihm etwas andres, nämlich bloße Romantik, Empfindsamkeit, Sehnsucht nach etwas Entschwundenem, Erinnerung an die große Vergangenheit der sterbenden Ölmalerei. Auch den letzten deutschen Meistern, Lessing, Marées, Spitzweg, Leibl,[76] deren verspätete Kunst ein Stück Romantik, ein Rückblick und Ausklang ist, erschien das Braun als das kostbare Erbe der Vergangenheit, und sie setzten sich in Widerspruch zu den bewußten Tendenzen ihrer Generation — dem seelenlosen Freilichtprinzip —, weil sie innerlich sich von diesem Moment eines großen Stils noch nicht trennen konnten. In diesem noch heute nicht verstandenen Kampf zwischen dem Rembrandtbraun der alten und dem Freilicht der neuen Schule erscheint der hoffnungslose Widerstand der Seele gegen den Intellekt, der Kultur gegen die Zivilisation, der Gegensatz von symbolisch notwendiger und weltstädtisch virtuosenhafter Kunst. Von hier aus wird die tiefe Bedeutung dieses Braun, mit dem eine ganze Kunst stirbt, fühlbar.
Die innerlichsten unter den großen Malern haben diese Farbe am besten verstanden, Rembrandt vor allem. Es ist dieses rätselhafte Braun seiner entscheidenden Werke, das aus dem tiefen Leuchten mancher gotischen Kirchenfenster, aus der Dämmerung hochgewölbter Dome stammt. Der satte Goldton der großen Venezianer, Tizians, Veroneses, Palmas, Giorgiones ist der jener alten, verschollenen Kunst, der nordischen Glasmalerei, von der sie nichts wußten. Auch hier ist die Renaissance mit ihrer körperhaften Farbenwahl nur Episode, nur ein Ergebnis der Oberfläche, des Allzubewußten, nicht des Faustisch-Unbewußten der abendländischen Seele. In diesem leuchtenden Goldbraun reichen sich hier, in der venezianischen Malerei, Gotik und Barock, die Kunst jener frühen Glasgemälde und die dunkle Musik Beethovens die Hand, gerade damals, als durch Willaert[S. 346] und Gabrieli die Schule von Venedig, die Begründerin der weltlichen Instrumentalmusik, des Madrigals und Rondos, ins Leben trat.
Braun war nunmehr die eigentliche Farbe der Seele, einer historisch gestimmten Seele geworden. Ich glaube, Nietzsche hat einmal von der braunen Musik Bizets gesprochen. Aber das Wort gilt eher von der Musik, die Beethoven für Streichinstrumente[77] geschrieben hat und noch zuletzt von dem Orchesterklang Bruckners, der so oft den Raum mit einem bräunlichen Golde füllt. Alle andern Farben sind in eine dienende Rolle verwiesen, so das helle Gelb und der Zinnober Vermeers, die mit wahrhaft metaphysischem Nachdruck wie aus einer andern Welt ins Räumliche hereinragen, und die gelbgrünen und blutroten Lichter, die bei Rembrandt mit der Symbolik des Raumes beinahe zu spielen scheinen. Bei Rubens, der ein glänzender Künstler, aber kein Denker war, ist das Braun fast ideenlos, eine Schattenfarbe. (Das „katholische“ Blaugrün macht bei ihm und Watteau dem Braun den Rang streitig.) Man sieht, wie dasselbe Mittel, das in den Händen tiefer Menschen Symbol wird und dann die ungeheure Transzendenz der Landschaften Rembrandts, in denen die Entrücktheit reiner Kammermusik beinahe erreicht wird, hervorrufen kann, daneben großen Meistern als bloße technische Handhabe zu Gebote steht, daß also, wie wir eben sahen, die künstlerisch-technische „Form“, als Gegensatz zu einem „Inhalt“ gedacht, nichts mit der wahren Form großer Werke zu tun hat.
Ich hatte das Braun eine historische Farbe genannt. Es macht die Atmosphäre des Bildraumes zu einem Zeichen des endlosen Werdens. Es übertönt die Sprache des Gewordnen in der Darstellung. Dieser Sinn erstreckt sich auch auf die andern[S. 347] Farben der Ferne und führt zu einer weiteren höchst bizarren Bereicherung der abendländischen Symbolik. Die Hellenen hatten die oft noch vergoldete Bronze als Material ihrer Statuen vorgezogen, um durch das Strahlende der Erscheinung unter tiefblauem Himmel die Idee der Einzigkeit alles Körperhaften zum Ausdruck zu bringen.[78] Die Renaissance grub diese Statuen aus, von einer vielhundertjährigen Patina überzogen, schwarz und grün; sie genoß das Historische des Eindrucks voller Ehrfurcht und Sehnsucht — und unser Formgefühl hat seitdem dieses „ferne“ Schwarz und Grün heilig gesprochen. Es ist heute für den Eindruck der Bronze auf unser Auge unentbehrlich, wie um die Tatsache schalkhaft zu illustrieren, daß diese ganze Kunstgattung uns nichts mehr angeht. Was bedeutet uns eine Domkuppel, eine Bronzefigur ohne Patina? Sind wir nicht endlich dahin gekommen, diese Patina sogar künstlich zu erzeugen?
Aber in der Erhebung des Edelrostes zu einem Kunstmittel von selbständiger Bedeutung liegt viel mehr. Man frage sich, ob ein Grieche die Bildung der Patina nicht als Zerstörung des Kunstwerkes empfunden hätte. Es ist nicht die Farbe allein, das raumferne Grün, das er aus seelischen Gründen vermied; die Patina ist Symbol der Zeit und sie erhält damit eine merkwürdige Beziehung zu den Symbolen der Uhr und der Bestattungsform. Es war an einer früheren Stelle die Rede von der Sehnsucht der faustischen Seele nach Ruinen und den Zeugnissen einer fernen Vergangenheit, einem Hange, wie er im Sammeln von Altertümern, Handschriften, Münzen, den Pilgerfahrten nach dem Kolosseum, dem Forum Romanum und Pompeji, in Ausgrabungen und philologischen Studien schon zur Zeit Petrarkas zutage tritt. Wann wäre es je einem Griechen eingefallen, sich um die Ruinen von Mykene und Tiryns zu kümmern? Jeder kannte seine Ilias, aber nicht einem von ihnen kam der Gedanke, den Hügel von Troja aufzugraben. Die Ruinen des Heidelberger Schlosses und tausend andre Reste, Burgen, Klöster, Tore, Mauern werden inmitten unsrer Städte[S. 348] sorgfältig erhalten — als Ruinen, denn man hat ein dunkles Gefühl davon, daß bei einem Wiederaufbau etwas schwer in Worte zu Fassendes verloren gehen würde. Als die Perser Athen zerstört hatten, warf man alles, Säulen, Statuen, Reliefs, ob zertrümmert oder nicht, von der Akropolis herunter, um von vorn anzufangen, und diese Schutthalde ist unsre reichste Fundgrube für die Kunst des 6. Jahrhunderts geworden. Das war ahistorisch empfunden. Das entsprach dem Stil einer Kultur, welche die Leichenverbrennung zum Kult erhob und eine Zeitrechnung nach ägyptischem Muster verschmähte. Wir haben auch hier das Gegenteil gewählt. Die heroische Landschaft im Stile Lorrains ist ohne Ruinen nicht denkbar und der englische Park mit seinen atmosphärischen Stimmungen, der den französischen um 1750 verdrängte und dessen durchgeistigte Perspektive zugunsten einer Rousseauschen „Natur“ aufgab, führte noch das Motiv der künstlichen Ruine ein, die das Landschaftsbild historisch vertieft.[79] Etwas Bizarreres ist kaum je ersonnen worden. Die ägyptische Kultur restaurierte die Bauten der Frühzeit, aber sie würde niemals den Bau von Ruinen als Symbole der Vergangenheit gewagt haben. Uns erscheinen die Gestalten der mexikanischen Kunst fratzenhaft genug, aber dieser Gedanke würde einem Inder oder Griechen weit fragwürdiger erschienen sein. Nur die aufs äußerste gesteigerte historische Leidenschaft konnte zu solchen Konzeptionen führen.
Es ist die Symbolik der Vergänglichkeit, welche die Patina uns teuer macht. Sie hebt an der Statue, dem an sich völlig zeitlosen und rein gegenwärtigen Kunstwerk, diese Beschränkung auf. Durch die Patina kommt eine gewisse Ferne, ein Anflug geschichtlicher Bewegtheit, etwas also vom Gehalte der Ölmalerei und Instrumentalmusik in diejenige Kunst, die deren strengsten Gegensatz bildet. Erstaunlicher konnte die Energie und Erfindungskraft der Seele, welche die technischen Bedingungen der Künste ihrem Willen zum Ausdruck unterwirft,[S. 349] sich gar nicht äußern. Das Barock liebte, ohne es zu wissen, die Bronzeplastik der Patina wegen. Ich wage zu behaupten, daß die Reste der antiken Skulptur erst durch diese Transposition ins Musikalische, in die Sprache der Ferne, uns näher treten konnte. Die grüne Bronze, der geschwärzte Marmor, die zertrümmerten Glieder einer Figur, allgemein gesprochen das schwer zu beschreibende Gefühlsmoment im Eindruck des Torso, heben für unser inneres Auge die Schranken der reinen Gegenwart von Ort und Zeit auf. Man hat das malerisch genannt — „fertige“ Statuen, Bauten, nicht verwilderte Parks sind unmalerisch — und in der Tat entspricht es der tieferen Bedeutung des Atelierbraun,[80] aber man meinte im letzten Grunde den Geist der instrumentalen Musik. Man frage sich, ob der Doryphoros Polyklets, in funkelnder Bronze vor uns stehend, mit Emailaugen und vergoldetem Haar, dieselbe Wirkung tun könnte wie der vom Alter geschwärzte, ob mancher Torso — etwa der vatikanische des Herakles — nicht durch eine noch so gute Ergänzung seinen Zauber einbüßte, ob die Türme und Kuppeln unsrer alten Städte nicht ihren tiefen metaphysischen Reiz verlören, wenn man sie mit neuem Kupfer beschlüge. Das Alter adelt für uns wie für die Ägypter alle Dinge. Für den antiken Menschen entwertet es sie.
Hiermit hängt endlich die Tatsache zusammen, daß die abendländische Tragödie „historische“, nicht etwa nachweisbar wirkliche oder mögliche — das ist nicht der eigentliche Sinn des Wortes —, sondern entfernte, patinierte Stoffe aus demselben Gefühl vorzog: daß nämlich ein Ereignis von reinem Augenblicksgehalt, ohne Raum- und Zeitferne, ein antikes tragisches Faktum, ein zeitloser Mythus, nicht das ausdrücken könne, was die faustische Seele ausdrücken wollte und mußte. Wir haben also Tragödien der Vergangenheit und Tragödien der Zukunft — zu letzteren, in denen der kommende Mensch Träger der Idee ist, gehören in einem gewissen Sinne Faust, Peer Gynt, die Götterdämmerung —, aber Tragödien der Gegenwart[S. 350] sind, wenn man von der künstlerisch belanglosen Sozialdramatik des 19. Jahrhunderts absieht, äußerst selten. Shakespeare wählte, wenn er einmal in Gegenwärtigem Bedeutendes ausdrücken wollte, immer fremde Länder, in denen er nie gewesen war, am liebsten Italien, deutsche Dichter gern England und Frankreich — alles das aus einer Abweisung der örtlichen und zeitlichen Nähe, welche das attische Drama selbst im Mythus noch betonte.
[67] Vielleicht sollte das Wort Form, weil es Extensives bezeichnet, hier vermieden werden. Aber man erinnere sich, daß Worte überhaupt, Worte als etwas Gewordnes und Starres, ein unzulängliches Mittel sind, etwas aus der Sphäre des Werdens anzudeuten.
[68] Der eigentliche Bilderstreit dauerte dort von 725–824.
[69] Donatello ist der Gotik noch nicht entwachsen, Michelangelo empfindet schon barock, d. h. musikalisch.
[70] Gerade die entschiedene Vorliebe für den weißen Stein ist für den Gegensatz von antikem und Renaissanceempfinden bezeichnend.
[71] Folgerichtig beginnt im 10. Jahrhundert die Verskunst des Reimes, die ebenfalls rein abendländisch und dem fugierten Stil aufs engste verwandt ist.
[72] Ich möchte doch zur Erwägung anheimgeben, ob nicht die Basilika, deren Ableitung aus irgendeinem antiken Bautypus trotz aller Kombinationen nicht gelingen will, überhaupt statt aus einem Hause aus einem säulenumgebenen Innenhof der Idee nach hervorgegangen ist. Es würde sich um den geschlossenen Vorhof des Tempels handeln, in dem die Gläubigen während der sakralen Handlung sich aufhalten. Das neue magische Raumgefühl hätte ihn als „Mittelschiff“ überdeckt, worauf dann erst die äußerliche Ähnlichkeit mit großstädtischen Zweckgebäuden die Bezeichnung Basilika in der griechischen Literatur zur Folge hatte. Der metaphysische Instinkt der Landschaft, in der die Kultbauten aller Religionen damals etwas innerlich höchst Verwandtes hatten, spricht sicherlich dafür. Die Anordnung von Atrium, Schiff und Altarraum wäre demnach als die allgemein semitische von Vorhalle, Vorhof und Tempel zu denken. Manche Einzelheiten wie die strenge Trennung von Schiff und Apsis, die Höhenlage der letzteren, zu der Stufen hinauffuhren, ferner die Orientierung allein des Mittelschiffs auf die Apsis, während die Seitenschiffe auch jetzt noch als „Umgebung“, als Nebenhallen wirken und blind endigen, finden nur so ihre natürliche Erklärung. Man bedenke doch, daß die Schöpfung eines solchen Typus von höchster Symbolik ganz unbewußt erfolgt. Es ist psychologisch falsch, hier, in Syrien, so rationalistische Wege anzunehmen, wie sie die Herleitung aus großstädtischen Markthallen und stadtrömischen Privatbasiliken voraussetzt. Ein religiöses Weltgefühl kombiniert nicht so sachlich.
[73] Paris gehört zu ihr. Man sprach dort noch im 15. Jahrhundert ebenso viel flämisch als französisch und mit den alten Teilen seines architektonischen Bildes zählt Paris zu Brügge und Gent, nicht zu Troyes und Poitiers.
[74] Eine Halle, wie sie Masaccio, Fra Filippo Lippi oder Raffael malen, weil sie nur an Bauten ihre Linearperspektive zur Anwendung bringen können, ist ein architektonischer Körper, kein „Innen“. Ebensowenig sind ihre Kulissen wirkliche Landschaften.
[75] Eine tiefsymbolische Bedeutung verwandter Art hat auch die glänzende Politur des Steines in der ägyptischen Kunst. Sie hält den Blick in einer über die Außenseite der Statue gleitenden Bewegung und wirkt damit entkörpernd. Umgekehrt ist der hellenische Weg vom Poros über den naxischen zum durchscheinenden parischen und pentelischen Marmor ein Zeugnis für die Absicht, den Blick in die stoffliche Wesenheit des Körpers eindringen zu lassen.
[76] Sein Bildnis der Frau Gedon, ganz in Braun getaucht, ist das letzte altmeisterliche Porträt des Abendlandes, vollkommen im Stile der Vergangenheit gemalt.
[77] Der Streichkörper repräsentiert im Orchesterklang die Farben der Ferne. Das bläuliche Grün Watteaus findet sich bei Mozart und Haydn, das Bräunliche der Holländer bei Beethoven. Auch die Holzbläser rufen helle Fernen herauf. Gelb und Rot dagegen, die Farben der Nähe, die populären Nuancen, gehören zum Klang der Blechinstrumente, der körperhaft bis zum Ordinären wirkt. Der Ton einer alten Geige ist vollkommen körperlos: Es verdient bemerkt zu werden, daß die hellenische Musik, so unbedeutend sie ist, von der dorischen Lyra zur ionischen Flöte überging und daß die strengen Dorer diese Tendenz zum Weichlichen und Niedrigen noch zur Zeit des Perikles tadelten.
[78] Man verwechsle die Tendenz, welche dem Goldglanz eines auf freiem Platze stehenden Körpers zugrunde liegt, nicht mit der des flimmernden arabischen Goldgrundes, der in dämmernden Innenräumen hinter den Figuren abschließt.
[79] Home, ein englischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, erklärt in einer Betrachtung über englische Parkanlagen, daß gotische Ruinen den Triumph der Zeit über die Kraft, griechische den der Barbarei über den Geschmack darstellten. Damals erst wurde die Schönheit des Rheins mit seinen Ruinen entdeckt. Er war von nun an der historische Strom der Deutschen.
[80] Das Nachdunkeln alter Gemälde erhöht für unser Gefühl deren Gehalt, mag der Kunstverstand tausendmal dagegen sprechen. Hätten die verwendeten Öle die Bilder zufällig blasser werden lassen, so wäre das als Zerstörung empfunden worden.
[S. 351]
Man hat die Antike eine Kultur des Leibes, die nordische eine des Geistes genannt, nicht ohne den Hintergedanken, damit die eine zugunsten der andern zu entwerten. So trivial der im Renaissancegeschmack gehaltene Gegensatz von antik und modern, heidnisch und christlich zumeist gemeint ist, so hätte er doch zu entscheidenden Aufschlüssen führen können, vorausgesetzt, daß man hinter der Formel ihren Ursprung zu finden verstand.
Eine Kultur ist im historischen Gesamtbilde der Welt, wie wir sahen, das Phänomen eines Seelentums, dessen Sein in der rastlosen Verwirklichung seiner inneren Möglichkeiten, seiner Idee, sich erschöpft. Die Vollendung der Aufgabe ist mit Vollendung des Lebens identisch. Unser waches und lebendiges Bewußtsein — das gereifter Kulturmenschen — erscheint als Polarität von Seele und Welt, der Summe des Möglichen und der des Wirklichen, und zwar in wechselseitiger Bedingtheit. Nur eine höhere Seele besitzt eine sinnvoll geordnete Welt als ihr eigenstes Eigentum, und es gibt eine Welt nur in bezug auf eine Seele. Wirklichkeit — das ist also der Gesamtausdruck lebendigen und bewegten Daseins, seine Offenbarung und Spiegelung im Gewordnen und Ausgedehnten. Insofern hat die Welt die Bedeutung eines Makrokosmos.
Ist die Welt aber, gleichviel was sie sonst noch ist, der ungeheure Inbegriff von Symbolen, so mußte auch der Mensch, soweit er dem Gewebe des Wirklichen angehört, soweit er wirklich ist, von dieser Deutung ergriffen werden. Was war es aber, das an der menschlichen Erscheinung den Rang eines Symbols beanspruchen, sein Wesen und den Sinn seines Daseins in sich sammeln und greifbar vor Augen stellen durfte? Die Antwort gibt die Kunst.
[S. 352]
Aber die Antwort mußte in jeder Kultur eine andre sein. Jede hat einen andern Begriff vom Leben, weil jede anders lebt. Die eine hatte dem Wirklichen das Prinzip des Körperhaften, die andre das des reinen, unendlichen Raumes a priori, wieder andre das des Weges, der magischen Ausdehnung zugrunde gelegt. Das war ein Weltgefühl, aber das Lebensideal stimmte mit ihm überein. Aus dem einen, dem antiken Ideal, folgte die rückhaltlose Hinnahme des sinnlichen Augenscheins, aus dem abendländischen dessen ebenso leidenschaftliche Überwindung. Das eine bedeutete Hingabe, das andre Kampf. Die apollinische Seele, euklidisch, punktförmig, empfand den empirischen, sichtbaren Leib als den vollkommenen Ausdruck ihrer Art zu sein; die faustische, in allen Fernen schweifend, fand ihn nicht in der Person, sondern der Persönlichkeit, dem empirischen Ich, dem Charakter oder wie man es nennen will. „Seele“ — das war für den echten Hellenen zuletzt die Form seines leiblichen Daseins. So hat Aristoteles sie definiert. „Leib“ — das war für den Menschen des Barock die sinnliche Form, die Inkarnation der Seele. So empfand Goethe. So hat die Philosophie Kants, unter zopfigen Formeln versteckt, die Dinge als die Inkarnation des einen, ewigen Raumes empfunden, der sie in ihrer Erscheinung „bedingt“.
Wir sahen, wie das eine Lebensgefühl zur Wahl der Plastik, das andre zur Musik als der repräsentativen Kunst führte. Neben der Plastik stand die Pflege des Tanzes als einer Kunst von hoher Ausdruckskraft, die des agonalen Wettkampfes und ein in dieser Form nie wiederkehrender Kultus der körperlichen Schönheit — alles das ist in den Idealen der σωφροσύνη und εὑρυθμία enthalten.
Man hat diese Ideale von jeher viel zu weit gefaßt. Es ist nicht die Weihe des Blutes — das der Mensch der σωφροσύνη nicht zu verschwenden hatte[81] —, nicht, wie Nietzsche meinte, die orgiastische Freude an Kraft und Mut und überschäumender Leidenschaft. Das alles würde eher zu den Idealen des germanisch-katholischen und indischen Rittertums gehören. Was der apollinische Mensch und seine Kunst für sich allein in Anspruch[S. 353] nehmen dürfen, ist lediglich die Apotheose der leiblichen Erscheinung im buchstäblichen Sinne, das rhythmische Ebenmaß des Gliederbaus und die harmonische Ausbildung der Muskulatur. Das ist nicht heidnisch im Gegensatz zum Christentum. Das ist jonisch im Gegensatz zum Barock. Erst der Mensch des Barock, mochte er Christ oder Heide, Rationalist oder Mönch sein, stand diesem Kultus des σῶμα fern bis zur äußersten körperlichen Unreinlichkeit, wie sie in der Umgebung Ludwigs XIV. herrschte.[82] Man warf in Athen den Dorern Unsauberkeit vor; dagegen hatte das Badewesen der gotischen Städte noch im 15. Jahrhundert in hoher Blüte gestanden, trotz allen „Jenseitsglaubens“.
Und so entwickelte sich die antike Plastik, nachdem sie ihr Thema auf die allseitig freistehende (beziehungslose) menschliche Gestalt beschränkt hatte, folgerichtig weiter bis zur ausschließlichen Darstellung des nackten Leibes. Und zwar, im Gegensatz zu jeder andern Art von Plastik der gesamten Menschheitsgeschichte, durch die anatomisch wahre Behandlung seiner Grenzflächen. Damit ist das euklidische Weltprinzip bis zum äußersten getrieben. Jede Hülle hätte noch einen leisen Widerspruch gegen die apollinische Erscheinung, eine wenn auch noch so zaghafte Andeutung des umgebenden Raumes enthalten.
Es ist ein streng metaphysisches Motiv, das Bedürfnis nach einem Lebenssymbol ersten Ranges, das die Hellenen zu dieser Kunst führte, deren Enge allein durch die Meisterschaft ihrer Leistungen verdeckt worden ist. Denn es ist nicht wahr, daß diese Aufgabe der Skulptur, der menschliche Akt, die vollkommenste, natürlichste oder auch nur nächstliegende sei. Das Gegenteil ist der Fall. Hätte nicht die Renaissance mit ihrem vollen ästhetischen Pathos und einer gewaltigen Täuschung über ihre eignen Tendenzen unser Urteil beherrscht, während uns die Plastik selbst innerlich fremd geworden war, so hätten wir das Exzeptionelle des attischen Stils längst bemerkt. Der ägyptische Bildhauer dachte gar nicht daran, die anatomische Wirklichkeit zur Grundlage des von ihm gewollten Ausdrucks zu[S. 354] machen. Für gotische Skulpturen kommt die Muskelbildung nirgends in Frage. Die hellenische Behandlung des Nackten ist der große Ausnahmefall, und sie hat nur dies eine Mal zu einer Kunst von hohem Range geführt. In andern Landschaften, wie der ägyptischen und japanischen — um eine besonders törichte und flache Begründung vorweg zu nehmen — war der Anblick nackter Menschen viel alltäglicher als gerade in Athen, wo die Damen in Hut und Mieder über die nackten Mädchen bei den Spielen der Spartaner sich höchst entrüstet äußerten, aber das gab nicht im mindesten Anlaß zur Entwicklung einer Aktplastik. Der heutige japanische Kunstkenner empfindet die Darstellung nackter Menschen als lächerlich und banal. Für seine Malerei ist der Akt ein Gegenstand ohne irgendwelche bedeutende Möglichkeiten.
Was dem antiken Menschen die vollkommene Durchbildung der körperlichen Oberfläche bedeutete — denn das ist der letzte Sinn alles anatomischen Ehrgeizes der griechischen Künstler: das Wesen der lebendigen Erscheinung durch die Gestaltung ihrer Grenzflächen zu erschöpfen —, das wurde für die abendländische Seele folgerichtig das Porträt, der eigentlichste und einzig erschöpfende Ausdruck einer transzendenten, einer faustischen Existenz.
Man hat beides, Akt und Porträt, noch nie als Gegensatz empfunden und deshalb beide nicht in der ganzen Tiefe ihrer kunsthistorischen Erscheinung auffassen können. Und trotzdem offenbart sich der volle Gegensatz zweier Welten im Widerstreit dieser großen Formideale.
Es war gezeigt worden, daß das Erlebnis des Ausgedehnten seinen Ursprung im Merkmal der Richtung hat, die allem Werden innewohnt. Die Richtung — durch die Worte Zeit, Leben, Schicksal, Ziel angedeutet — verschmilzt als Tiefe oder Ferne mit der Fläche oder Breite des Sinnlichen. Die Empfindung als solche dehnt sich im Akt des Bewußtwerdens zur Welt. So trägt alles Gewordene das Merkmal der Ausdehnung, und es gehört zum Geheimnisvollsten im Wesen aller Kulturen, daß in ihnen — wie im Kinde — das Erwachen des Ich, des Innenlebens mit der spontanen Deutung des Tiefenerlebnisses im Sinne eines Ursymbols identisch ist. Wir sahen, wie jede Kultur hier[S. 355] anders fühlt. Der antike Mensch empfand die Welt, wie seine Mathematik beweist, stereometrisch, mehr noch, planimetrisch. Die Zahl als Größe oder Maß: das bedeutet die Welt als Summe von Stoffen oder deren Grenzflächen. Der Hellene kannte nur Dinge, keinen Raum. Deshalb die reine Flächenwirkung seiner Plastik, das Vermeiden von Licht und Schatten, die strenge Beschränkung auf den einzelnen beziehungslosen Fall. War demgegenüber das Unendliche Prinzip und Zeichen des abendländischen Daseins, so hatte die Ferne einen seelischen Doppelsinn, je nachdem sie wird oder geworden ist.
Das Tiefenerlebnis ist ein Werden und bewirkt ein Gewordnes; es bedeutet Zeit und ruft den Raum hervor; es ist kosmisch und historisch zugleich. Die lebendige Richtung geht zum Horizont wie zur Zukunft. Unendlichkeit und Ewigkeit fließen vor der Seele zusammen, und wer die eine nicht besitzt, kennt auch die andre nicht. Die reine Gegenwärtigkeit des antiken Daseins, symbolisiert in der nackten Statue, war die des Ortes und der Zeit. Auch das Wort Gegenwart hat einen doppelten Sinn, je nachdem der Bereich des Werdens oder des Gewordnen gemeint ist. Die attische Plastik ist eine Kunst der körperhaften Nähe und also auch des Augenblicks (auf dieser Tatsache beruhen die verfehlten Ausführungen von Lessings Laokoon). Das Porträt des 16. und 17. Jahrhunderts aber ist unendlich in jedem Sinne. Es faßt nicht nur den Menschen als Mittelpunkt des Weltalls, dessen Erscheinung von seinem Sein Gestalt und Bedeutung empfängt; es faßt ihn vor allem historisch, d. h. biographisch. Die Statue ist ein Stück Natur und nichts außerdem. Parzeval, Hamlet, Faust sind stets werdende, Odysseus, Klytämnestra, Antigone sind gewordne Menschen. Die antike Dichtung gibt Statuen in Worten, die abendländische psychologische Analysen. Hier liegt die Wurzel für unser Gefühl, das dem Griechen eine reine Hingabe an die Natur zuschreibt. Wir werden uns nie ganz von dem Empfinden befreien, daß der gotische Stil neben dem griechischen Unnatur ist, nämlich mehr als „Natur“. Nur verhehlen wir uns, daß darin das Gefühl eines Mangels bei den Griechen zu Worte kommt. Die abendländische Formensprache ist reicher. Das Porträt gehört der Natur und der Geschichte an. Ein Porträt Tizians und Rembrandts ist eine[S. 356] Biographie, die Quintessenz eines Lebens; ein Selbstporträt ist eine Beichte. Vergessen wir nicht, daß die Beichte, von der sich in den Evangelien nicht die geringste Andeutung findet, erst im 9. Jahrhundert und nur in Westeuropa Laienpflicht wird — es war die Zeit der ersten Regungen des romanischen Stils —, und daß sie erst 1215, zur Zeit der blühenden Gotik, den Rang eines Sakraments erhielt. Es war gesagt worden, daß die faustische Kultur — im Gegensatz zur antiken — die der Seelenforschung, der Selbstprüfung, der Historik großen Stils ist. Wenn der Protestant und der Freigeist sich gegen die Ohrenbeichte auflehnen, so kommt es ihnen nicht zum Bewußtsein, daß sie nicht die rein abendländische Idee, sondern nur ihre äußere Fassung ablehnen. Sie weigern sich, dem Priester zu beichten, aber sie beichten sich selbst, dem Freunde oder der Menge. Die gesamte nordische Poesie ist Bekenntniskunst. Das Porträt Rembrandts und die Musik Beethovens sind es auch. Der abendländische Mensch lebt mit dem Bewußtsein des Werdens, mit dem ständigen Blick auf Vergangenheit und Zukunft. Der Grieche lebt punktförmig, ahistorisch, somatisch. Kein Grieche hat Memoiren hinterlassen. Keiner wäre einer echten Selbstkritik fähig gewesen. Auch das liegt in der Erscheinung der nackten Statue, dem eminent unhistorischen Abbilde eines Menschen. Ein Selbstporträt ist das genaue Seitenstück der Selbstbiographie in der Art des Werther und Tasso, und das eine der Antike so fremd wie das andre. Es gibt nichts Unpersönlicheres als die griechische Kunst. Daß Skopas oder Lysippos ein Bildnis von sich selbst gemacht hätten, kann man sich gar nicht vorstellen.
Im antiken Akte, der ganz Oberfläche, ganz Vordergrund und Materie, steingewordnes σῶμα war, ist das Innenleben künstlerisch verneint, dem Raume als dem Nichtseienden gleichgesetzt. Wenn Plato drei Seelenvermögen — εἴδη — und als deren höchstes das λογιστικόν unterschied, so war dies Prinzip jedenfalls nur als Logik der körperlichen Erscheinung in die Plastik gedrungen. Aristoteles hat die Vollendung des Menschen nach Stoff und Form („Leib“ und „Seele“ in antik gefühltem Gegensatz) sogar ausdrücklich nach Analogie der künstlerischen Arbeit beschrieben.
[S. 357]
Man betrachte bei Phidias, bei Polyklet, bei irgendeinem andern Meister nach den Perserkriegen die Wölbung der Stirn, die Lippen, den Ansatz der Nase, das blind gehaltene Auge — wie das alles der Ausdruck einer ganz unpersönlichen, pflanzenhaften, seelenlosen Vitalität ist. Man frage sich, ob diese Formensprache imstande wäre, ein inneres Erlebnis auch nur anzudeuten. Es gab nie eine Kunst, für welche so ausschließlich nur die optische Oberfläche von Körpern in Betracht kam. Bei Michelangelo, der sich mit seiner ganzen Leidenschaft dem Anatomischen ergab, ist trotzdem die leibliche Erscheinung stets der Ausdruck der Arbeit aller Knochen, Sehnen, Organe des Innern; das Lebendige unter der Haut tritt in Erscheinung, ohne daß es gewollt war. Es ist eine Physiognomik, keine Systematik der Muskulatur, die Michelangelo ins Leben rief. Aber damit war bereits das persönliche Schicksal, nicht der stoffliche Leib der eigentliche Ausgangspunkt des Formgefühls geworden. Es liegt mehr Psychologie (und weniger „Natur“) im Arme eines seiner Sklaven als im Kopfe des praxitelischen Hermes. Beim Diskobolos des Myron ist die äußere Form ganz für sich da ohne alle Beziehung auf den vitalen Organismus geschweige denn die „Seele“. Man vergleiche mit den besten Arbeiten dieser Zeit die altägyptischen Statuen etwa des Dorfschulzen oder des Königs Phiops oder andrerseits den David des Donatello und man wird verstehen, was es heißt, einen Körper nur seiner stofflichen Grenze nach anerkennen. Alles, was bei den Griechen den Kopf als den Ausdruck von etwas Innerlichem und Geistigem erscheinen lassen könnte, ist peinlich vermieden. Gerade bei Myron tritt das hervor. Ist man einmal darauf aufmerksam geworden, so erscheinen die besten Köpfe der Blütezeit, aus der Perspektive unsres gerade entgegengesetzten Weltgefühls betrachtet, nach einer Weile dumm und stumpf. Das Biographische fehlt ihnen. Nicht umsonst waren ikonische Statuen in dieser Zeit streng verpönt. Es gibt bis auf Lysippos herab nicht einen echten Charakterkopf. Es gibt nur Masken. Oder man betrachtet die Gestalt im ganzen: mit welcher Meisterschaft ist da der Eindruck vermieden, als ob der Kopf der bevorzugte Teil des Leibes sei. Deshalb sind diese Köpfe so klein, so unbedeutend in der Haltung, so wenig durchmodelliert.[S. 358] Überall sind sie durchaus als Teil des Körpers, wie Arm und Schenkel, niemals als Sitz und Symbol eines Ich geformt. Die sich beständig, bis zu staatlichen Verboten steigernde Abneigung der Griechen dem Porträt gegenüber besitzt in der zunehmenden Entwertung des Motivs nackter Körperlichkeit in der Ölmalerei von den Florentinern bis zu Velasquez und Rembrandt ein vollkommenes Gegenstück.
Man wird endlich sogar finden, daß der weibliche, selbst weibische Eindruck vieler dieser Köpfe des 5. und mehr noch des 4. Jahrhunderts[83] das allerdings ungewollte Resultat der Bestrebung ist, jede geistige Charakteristik gänzlich auszuschließen. Man ist vielleicht zu dem Schlusse berechtigt, daß der ideale Gesichtstypus dieser Kunst, der sicherlich nicht der des Volkes war, wie die spätere naturalistische Bildnisplastik sofort beweist, als Summe von lauter Negationen, des Individuellen und Psychischen nämlich, also aus der Beschränkung der Gesichtsbildung auf das rein Euklidische und Stereometrische entstanden ist. Dies würde das Geschlechtslose und Unmännliche der Erscheinung zum großen Teil erklären.
Das Porträt der großen Barockzeit behandelt dagegen durch alle Mittel des malerischen Kontrapunkts, die wir als Träger räumlicher und historischer Fernen kennen gelernt haben, durch die in Braun getauchte Atmosphäre, die Perspektive, den bewegten Pinselstrich, die zitternden Farbentöne und Lichter, den Leib als etwas an sich Unwirkliches, als ausdrucksvolle Hülle eines raumbeherrschenden Ich. (Die Freskotechnik, euklidisch wie sie ist, schließt die Lösung einer solchen Aufgabe vollkommen aus.) Das ganze Gemälde hat nur das eine Thema: Seele. Man achte darauf, wie bei Rembrandt (etwa der Radierung des Bürgermeisters Six oder dem Architektenbildnis in Kassel) und zuletzt noch einmal bei Marées und Leibl (auf dem Bildnis der Frau Gedon) die Hände und die Stirn gemalt sind, durchgeistigt bis zur Auflösung der Materie, visionär,[S. 359] voller Lyrik — und vergleiche damit die Hand und die Stirn eines Apollo oder Poseidon aus der Zeit des Perikles.
Die ägyptische Plastik als der Ausdruck einer dem Unendlichen gleichfalls hingegebenen Seele — man erinnere sich der Symbolik des Weges zur Grabkammer in den Pyramidentempeln — war ebenso physiognomisch, ebenso historisch und sub specie aeternitatis gedacht, mithin ebenfalls eine Kunst des Porträts. Die Königsstatue bannt das Ka, das transzendente Prinzip der Persönlichkeit, in die Welt des Gewordnen, und zwar durch ihren Porträtcharakter. Es folgt daraus, daß sie wie die Statuen gotischer Grabdenkmäler den Leib als Eigenwert verneint: das Abendland durch die ganz ornamental behandelte Kleidung, deren Physiognomik die Sprache des Antlitzes und der Hände verstärkt, Ägypten, indem es den Körper — wie die Pyramide, den Obelisken — in einem mathematischen Schema hält und das Persönliche auf den Kopf, mit einer wenigstens in der Skulptur nie wieder erreichten Größe der Auffassung beschränkt. Der Faltenwurf soll in Athen den Sinn des Leibes offenbaren, im Norden ihn auflösen. Das Gewand wird dort zum Körper, hier zur Musik — dies ist der tiefe Gegensatz, der in Werken der Hochrenaissance zu einem schweigenden Kampf zwischen dem traditionell gewollten und dem unbewußt hervordringenden Ideal des Künstlers führt, in welchem das erste, antigotische, oft genug auf der Oberfläche, das zweite, von der Gotik zum Barock leitende, immer in der Tiefe siegt.
Ich fasse jetzt den Gegensatz von apollinischem und faustischem Menschheitsideal zusammen. Akt und Porträt verhalten sich wie Körper und Raum, wie Augenblick und Ewigkeit, Vordergrund und Tiefe, wie die euklidische zur analytischen Zahl, wie Maß und Beziehung. Die antike Plastik, für welche die nackte Oberfläche des menschlichen Körpers beinahe das einzige Ausdrucksmittel geworden war, arbeitete an einer Inkarnation des vollkommen Gegenwärtigen nach Ort und Zeit. Die Statue wurzelt im Boden, die Musik — und das abendländische Porträt ist Musik, aus Farbentönen gewebte Seele —[S. 360] durchdringt den grenzenlosen Raum. Das Freskogemälde ist mit der Wand verbunden, verwachsen; das Ölgemälde, als Tafelbild, ist frei von den Schranken eines Ortes. Die apollinische Formensprache offenbart nur Gewordnes, die faustische vor allem auch ein Werden.
Deshalb zählt die abendländische Kunst Kinderporträts und Familienbildnisse zu ihren besten und innerlichsten Leistungen. Der attischen Plastik waren diese Motive völlig versagt. Das Kind verknüpft Vergangenheit und Zukunft. Es bezeichnet in jeder menschenbildenden Kunst, die überhaupt Anspruch auf symbolische Bedeutung erhebt, die Dauer im Wechselnden der Erscheinung, die Unendlichkeit des Lebens. Aber das antike Leben erschöpfte sich in der Fülle des Augenblicks und man verschloß das Auge vor zeitlichen Fernen. Man dachte an die Menschen gleichen Blutes, die man neben sich sah, aber nicht an die kommenden Geschlechter. Und deshalb hat es niemals eine Kunst gegeben, die der Darstellung von Kindern so entschieden aus dem Wege gegangen ist wie die griechische. Man überdenke die Fülle von Kindergestalten, welche von der frühen Gotik bis zum sterbenden Rokoko und vor allem auch in der Renaissance entstanden sind, und suche demgegenüber auch nur ein antikes Werk von einigem Range bis auf Alexander herab, das mit Absicht dem ausgebildeten Körper des Mannes oder Weibes den kindlichen zur Seite stellt, dessen Dasein noch der Zukunft angehört.
In der Idee des Muttertums ist das unendliche Werden begriffen. Wie der mystische Akt des Tiefenerlebnisses — der Zeit, des Schicksals — aus dem Sinnlichen das Ausgedehnte und also die Welt schafft, so entsteht durch die Mutterschaft der leibliche Mensch als einzelnes Glied dieser Welt. Alle Symbole der Zeit und Ferne sind auch Symbole des Muttertums. In der Erscheinung der Mutter sammelt sich der Sinn der Geschlechterfolgen als gewollt und vorbedacht. Die Sorge ist das Urgefühl der Zukunft und alle Sorge ist mütterlich. Sie spricht sich in den Bildungen und Ideen von Familie und Staat und dem Prinzip der Erblichkeit, das beiden zugrunde liegt, nicht weniger aus als in den Reliefreihen und Sphinxalleen der ägyptischen und den unendlichen Fernsichten und[S. 361] Perspektiven der abendländischen Kunst. In der Dynastie (dem Adel) verkörpert sich die Sorge, die Zukunft, der Wille zur Dauer, und einen wahren Staat — wie den ägyptischen oder preußischen — kann es nur geben, wo es ein dynastisches Gefühl im Menschen gibt.
Auf dem „Carpe diem“ des antiken Daseins läßt sich weder ein Adel noch ein Staat aufbauen. Die Polis ist der Ausdruck der Negation von beidem. Es fehlt an mütterlicher Sorge der Stadt für die Nachkommen der Lebenden; es fehlt die Ehrfurcht vor dem Erblichen und somit der Sinn für Dynastien wie für die Familie als Kette von Generationen und nicht nur als Gruppe von Lebenden. Wie das öffentliche Dasein ausschließlich auf der Wahrnehmung der augenblicklichen und greifbaren Vordergrundinteressen beruhte, so stellte sich das apollinische Lebensgefühl nicht im Prinzip des Muttertums, sondern in dem der Fruchtbarkeit dar. Dies ist der Gegensatz von Raum und Körper, Porträt und Akt. Der Phallus wurde zum antiken Symbol. Er ist wie die Statue, die — zumal in Bronze gegossen oder grell bemalt und frei aufgestellt — etwas Phallisches hatte, der Inbegriff des Beziehungslosen. Die Mutter verweist in die Zukunft, auf Geschlechter; der Phallus bezeichnet den augenblicklich-geschlechtlichen Akt. Man wird in der großen griechischen Statuenkunst nicht eine säugende Mutter finden. Man möchte sie nicht einmal im Stil des Phidias gebildet sehen. Man fühlt, daß diese Kunstgattung innerlich dem Motiv widerspricht.[84] In der religiösen Kunst des Abendlandes dagegen gab es keine erhabnere Aufgabe. Mit der anbrechenden Gotik wurde die orientalische Maria der Mosaiken zur Mutter Gottes, zur Mutter überhaupt. Im germanischen Mythus erscheint sie als Frigga und Frau Holle. Wir finden das gleiche Gefühl in schönen Wendungen der Minnesänger wie Frau Welt, Frau Sonne, Frau Eve, Frau Minne ausgedrückt. Die mütterliche Geliebte, Ophelia und Gretchen, steht neben den Madonnen Raffaels.
Ihr stellte der hellenische Olymp Göttinnen gegenüber, die Amazonen — wie Athene — oder Hetären — wie Aphrodite —[S. 362] waren. Das ist der antike Typus des Weibes, aus der Idee der pflanzenhaften Fruchtbarkeit erwachsen. Auch hier erschöpft das Wort σῶμα den ganzen Sinn der Erscheinung. Man denke an das Meisterwerk dieser Art, die drei mächtigen Frauenkörper im Ostgiebel des Parthenon, und vergleiche damit die erhabenste Konzeption einer Mutter, die sixtinische Madonna Raffaels. In ihr ist nichts Körperhaftes mehr. Sie ist ganz Ferne, ganz Raum. Die Helena der Ilias, an Kriemhild gemessen, ist Hetäre; Antigone und Klytämnestra sind Amazonen. Es ist auffallend, wie selbst Äschylus in der Tragödie der Klytämnestra die Tragik der Mutter vermeidet. Die Gestalt der Medea ist geradezu die mythische Umkehrung des faustischen Typus der Mater dolorosa. In der Plastik verschwimmen Aphrodite und Athene (für diese Kunst ist Athene nur eine ältere Aphrodite) endlich zu einer weiblichen Idealgestalt, die — wie die knidische Aphrodite — lediglich ein schöner Gegenstand ist, kein Charakter, kein Ich, sondern ein Stück Natur. Praxiteles, der bekanntlich den weiblichen Ganzakt in die attische Bildhauerei einführte, hat daraus die letzten künstlerischen Konsequenzen gezogen.
Diese Neuerung fand strengen Tadel, aus dem Gefühl heraus, daß hier ein Symptom des niedergehenden antiken Weltgefühls vorliege. So sehr sie der geschlechtlichen Symbolik entsprach, so sehr widersprach sie der Würde der älteren griechischen Religion. Aber sie bewies zugleich, daß allenthalben die Strenge und Sicherheit der Formensprache im Sinken war. Damals entstand die Niobidengruppe, die erste, wenn auch wenig tiefe Darstellung einer Mutter. Damals entstanden aber auch im schärfsten Widerspruch zur antiken Staatsform der Polis die Dynastien der Nachfolger Alexanders, schwächlich zwar im Vergleich mit den ägyptischen und abendländischen, aber doch gewisse Zeichen einer innern Würde. Die Kraft der antiken Symbolik erlischt. Die antike Kultur wird Zivilisation. Jetzt erst wagt sich eine Bildniskunst hervor, die wie der hellenistische Staat und die jetzt in Mode kommende korinthische Pflanzensäule deutlich an Ägypten erinnert (man denke daran, wie dementsprechend das 19. Jahrhundert an griechische und, seit 1860, an japanische Vorbilder anknüpft). Der Perikleskopf des Kresilas[S. 363] (etwa 430) ist in keinem Sinne Porträt. Die bekannte Sophoklesstatue (um 340) ist es eher. Erst der Demosthenes des Polyeukt (um 280) darf als Porträt gelten. Wie wenig er es im Sinne der Kunst Rembrandts oder überhaupt in dem einer transzendenten Kunst ist, hätte aber nie verkannt werden sollen. Man hat den virtuosenhaften Verismus namentlich jener spätgriechischen Künstler, welche die Römerbüsten der Kaiserzeit schufen, mit physiognomischer Tiefe verwechselt. Wer aber glaubt, der Hellenismus habe je persönliche Seelenbildnisse gewollt oder erreicht — beides ist dasselbe —, der vergleiche ein „arabisches“ Porträt wie die Theodosiusstatue in Barletta, die Köpfe der Helena und Theodora oder die altägyptischen Bildnisse des Chephren und Sesostris III. mit irgendeinem griechischen. Sie alle haben eine schwer in Worte zu fassende Verwandtschaft mit den Bildnissen Tizians, Holbeins und Rembrandts, die Idealfiguren des Hellenismus haben sie nicht.
In der Ölmalerei vom Ende der Renaissance an kann man die Tiefe eines Künstlers mit Sicherheit an dem Gehalt seiner Porträts messen. Diese Regel erleidet kaum eine Ausnahme. Alle Gestalten im Bilde, ob einzeln, ob in Szenen, Gruppen, Massen, sind dem physiognomischen Grundgefühl nach Porträts, ob sie es sein sollen oder nicht. Das stand nicht in der Wahl des einzelnen Künstlers. Nichts ist lehrreicher als zu sehen, wie sich unter den Händen eines wirklich faustischen Menschen selbst der Akt in eine Porträtstudie verwandelt (man könnte die hellenistische Bildniskunst als den entgegengesetzten Prozeß bezeichnen). Man nehme zwei deutsche Meister wie Lukas Kranach und Tilmann Riemenschneider, die von aller Theorie unberührt blieben und, im Gegensatz zu Dürer und dessen Hange zu ästhetischen Meditationen und also zur Nachgiebigkeit fremden Tendenzen gegenüber, mit vollkommener Naivität arbeiteten. In ihren — höchst seltenen — Akten zeigen sie sich gänzlich außerstande, den Ausdruck ihrer Schöpfung in die unmittelbar gegenwärtige flächenbegrenzte Körperlichkeit zu legen. Der Sinn der menschlichen Erscheinung und mithin[S. 364] des ganzen Werkes bleibt regelmäßig im Kopfe gesammelt, bleibt physiognomisch, nicht anatomisch, und das gilt trotz des entgegengerichteten Wollens und trotz aller italischen Studien auch von Dürers Lukrezia. Ein faustischer Akt — das ist ein Widerspruch in sich selbst. Daher das peinlich Gezwungene, das Schwankende und Befremdende solcher Versuche, die sich allzu deutlich als Opfer vor dem hellenisch-römischen Ideal verraten, Opfer, die der Kunstverstand, nicht die Seele bringt. Es gibt in der gesamten Malerei nach Lionardo kein bedeutendes oder bezeichnendes Werk mehr, dessen Sinn von dem euklidischen Dasein eines nackten Körpers getragen wird. Wer hier Rubens nennen und dessen unbändige Dynamik schwellender Leiber in irgendeine Beziehung zur Kunst des Praxiteles und selbst des Skopas setzen wollte, der versteht ihn nicht. Gerade die prachtvolle Sinnlichkeit hielt ihn von der toten Statik der Körper Signorellis fern. Wenn irgendein Künstler in die Schönheit nackter Leiber ein Maximum von Werden, von unhellenischer Ausstrahlung einer innern Unendlichkeit gelegt hat, so war es Rubens. Man vergleiche den Pferdekopf aus dem Parthenongiebel mit denen in seiner Amazonenschlacht und man wird den tiefen metaphysischen Gegensatz in der Fassung des gleichen Erscheinungselements fühlen. Bei Rubens — um wieder an den Gegensatz von faustischer und apollinischer Mathematik zu erinnern — ist der Körper nicht Größe, sondern Beziehung; nicht die sinnvolle Regel seiner äußeren Gliederung, sondern die Fülle des strömenden Lebens in ihm ist das Motiv, das sich im Jüngsten Gericht, wo die Leiber zu Flammen werden, mit der Bewegtheit des Weltraumes verbindet, eine gänzlich unantike Synthese, die auch den Nymphenbildern Corots nicht fremd ist, deren Gestalten im Begriffe sind, sich in Farbenflecke, Reflexe des unendlichen Raumes aufzulösen. So ist der antike Akt nicht gemeint. Man verwechsle das griechische Formideal — das eines in sich abgeschlossenen plastischen Daseins — auch nicht mit der bloßen virtuosen Darstellung schöner Leiber, wie sie sich von Giorgione bis auf Boucher immer wieder finden, fleischliche Stilleben, Genrearbeiten, die lediglich, wie Rubens’ Frau mit dem Pelz, eine heitre populäre Sinnlichkeit zum Ausdruck bringen und in Hinsicht auf das symbolische Gewicht der[S. 365] Leistung — sehr im Gegensatz zu dem hohen Ethos antiker Akte — weit zurücktreten.[85]
Diese — ausgezeichneten — Maler haben dementsprechend weder im Porträt noch in der Darstellung tiefer Welträume vermittelst der Landschaft das Höchste erreicht. Ihrem Braun und Grün, ihrer Perspektive fehlt die „Religion“, das Schicksal. Sie sind Meister allein im Bereiche der elementaren Form, in deren Repräsentation ihre Kunst sich erschöpft. Sie sind es, deren Schar die eigentliche Substanz der Entwicklungsgeschichte einer großen Kunst bildet. Wenn aber ein großer Künstler darüber hinaus zu jener andern, die ganze Seele und den ganzen Sinn der Welt umfassenden Form vordringt, so mußte er innerhalb der antiken Kunst zur Durchbildung eines nackten Körpers schreiten, in der nordischen durfte er es nicht. Rembrandt hat in jenem Vordergrundssinne nie einen Akt gemalt; Lionardo, Tizian, Velasquez und unter den letzten Menzel, Leibl, Marées, Manet jedenfalls selten (und dann immer, ich möchte sagen Leiber als Landschaften). Das Porträt bleibt der untrügliche Prüfstein.[86]
Aber man würde Meister wie Signorelli, Mantegna, Botticelli niemals an dem Range ihrer Porträts messen. Raffaels Bildnisse, deren beste wie das des Papstes Julius II. unter dem Einflüsse des Venezianers Sebastian del Piombo entstanden, könnte man bei der Würdigung seines Schaffens gänzlich außer acht lassen. Erst bei Lionardo sind sie von höchstem Gewicht. Es besteht ein feiner Widerspruch zwischen Freskotechnik und Bildnismalerei. In der Tat ist Giovanni Bellinis Doge Loredan das erste große Ölporträt. Auch hier offenbart sich der Charakter der Renaissance als einer Auflehnung gegen den faustischen Geist des Abendlandes. Die Episode von Florenz bedeutet den Versuch, das Porträt gotischen Stils — also nicht[S. 366] das spätantike Idealbildnis, das man vornehmlich durch die Cäsarenbüsten kannte — als Symbol des Menschlichen durch den Akt zu ersetzen. Folgerichtig hätten die physiognomischen Züge der gesamten Renaissancekunst fehlen müssen. Allein die starke Unterströmung faustischen Kunstwollens, nicht nur in kleineren Städten und Schulen Mittelitaliens, sondern selbst im Unbewußten der großen Maler bewahrte eine nie unterbrochene Tradition. Die Physiognomik gotischer Art unterwarf sich sogar das ihr so fremde Element des südlich-nackten Körpers. Was man entstehen sah, sind nicht Körper, die durch die Statik ihrer Grenzflächen zu uns reden; wir bemerken ein Mienenspiel, das sich vom Antlitz über alle Teile des Körpers verbreitet und für das feinere Auge gerade in die toskanische Nacktheit eine tiefe Identität mit dem gotischen Gewande legt. Sie ist eine Hülle, keine Grenze. Vor allem aber wurde jeder gemalte oder modellierte Kopf von selbst zum Porträt. Alles was A. Rossellino, Donatello, Benedetto da Majano, Mino da Fiesole im Porträt geleistet haben, steht dem Geiste der Van Eyck, Memlings und der frührheinischen Meister oft bis zum Verwechseln nahe. Ich behaupte, daß es überhaupt kein eigentliches Renaissanceporträt gibt und geben kann, wenn man darunter die in einem Antlitz gesammelte künstlerische Gesinnung versteht, welche den Hof des Palazzo Strozzi von der Loggia dei Lanzi und Perugino von Cimabue trennt. Im Architektonischen war eine antigotische Konzeption möglich, so wenig von apollinischem Geiste sie auch besaß; im Bildnis, das schon als Gattung ein faustisches Phänomen war, nicht. Michelangelo ging der Aufgabe aus dem Wege. In seiner leidenschaftlichen Verfolgung eines plastischen Ideals hätte er die Beschäftigung mit ihr als ein Herabsteigen empfunden. Seine Brutusbüste ist so wenig ein Porträt wie sein Giuliano de Medici, dessen Porträt von Botticelli ein wirkliches, mithin eine ausgesprochen gotische Schöpfung ist. Michelangelos Köpfe sind Allegorien im Geschmack des anbrechenden Barock und selbst mit gewissen hellenistischen Arbeiten nur oberflächlich vergleichbar. Man mag den Wert der Uzzanobüste des Donatello, vielleicht der bedeutendsten Leistung dieser Epoche, noch so hoch bemessen; man wird zugeben, daß sie neben den Bildnissen der Venezianer kaum in Betracht kommt.
[S. 367]
Es verdient bemerkt zu werden, daß diese wenigstens ersehnte Überwindung des gotischen Porträts durch den vermeintlich antiken Akt — einer rein historischen und biographischen Form durch eine vollkommen ahistorische eines punktförmigen Daseins — mit einem gleichzeitigen Niedergang der Fähigkeit zur innern Selbstprüfung und zur künstlerischen Konfession im Goetheschen Sinne verschwistert erscheint. Kein echter Renaissancemensch kennt eine seelische Entwicklung. Er vermochte ganz nach außen zu leben. Darin lag das hohe Glück des Quattrocento. Zwischen Dantes Vita nuova und Michelangelos Sonetten ist keine poetische Beichte, kein Selbstporträt von einigem Range entstanden. Der Renaissancekünstler ist im Abendlande der einzige, für den Einsamkeit ein leeres Wort bleibt. Darf man hinzufügen, daß also auch jenes andre Symbol der historischen Ferne, der Sorge, Dauer und Nachdenklichkeit, der Staat, von Dante bis auf Michelangelo aus der Sphäre der Renaissance verschwindet? Im „wankelmütigen Florenz“, das all seine großen Bürger bitter gescholten haben und dessen Unfähigkeit zu tüchtigen politischen Bildungen am gewöhnlichen Niveau abendländischer Staatsformen gemessen ans Bizarre streift, und überall dort, wo der antigotische — nach dieser Seite hin betrachtet also antidynastische — Geist eine lebendige Wirksamkeit in Kunst und Öffentlichkeit entfaltet, machte der Staat in Gestalt der Medici, Sforza, Borgia, Malatesta und lächerlicher Republiken einer wahrhaft hellenischen Jämmerlichkeit im Stile des peloponnesischen Krieges Platz. Nur dort, wo die Plastik keine Stätte fand, wo die südliche Musik zu Hause war, wo Gotik und Barock in der Ölmalerei des Giovanni Bellini sich berührten und die Renaissance ein Gegenstand gelegentlicher Liebhaberei blieb, gab es neben dem Porträt — der Seelengeschichte in nuce — eine feine Diplomatie und den Willen zur politischen Dauer: in Venedig.
Die Renaissance war aus dem Trotz geboren. Es fehlt ihr darum an Tiefe, Umfang und Sicherheit der formbildenden Instinkte. Sie ist die einzige Epoche, die einer theoretischen Unterstützung[S. 368] bedurfte. Sie war auch, sehr im Gegensatz zu Gotik und Barock, die einzige, wo das theoretisch formulierte Wollen dem Können voranging und es oft genug überragte. Aber die erzwungene Gruppierung der einzelnen Künste um eine antikisierende Plastik konnte diese Künste in den letzten Wurzeln ihres Wesens nicht umwandeln. Sie bewirkte nur eine Verarmung der innern Möglichkeiten. Für Naturen von mittlerem Umfang war das geistig-künstlerische Medium der Renaissance zureichend. Es kommt ihnen infolge der Simplizität der oberflächlicheren Konvention sogar entgegen und man vermißt deshalb das gotische Ringen mit dem Element, das die rheinischen und niederländischen Schulen auszeichnet. Die wundervolle und verführerische Leichtigkeit und Klarheit beruht nicht zum wenigsten auf dem Umgehen des tieferen Widerstandes vermittelst einer allzu schlichten Regel. Die Renaissancekunst kennt keine Probleme. Für Menschen von der Innerlichkeit Memlings und der Gewalt Grünewalds, die im Bereich dieser toskanischen Formenwelt geboren wurden, mußte sie zum Verhängnis werden. Sie konnten nicht in ihr und durch sie, nur gegen sie zur Entfaltung ihrer Seele kommen. Wir sind geneigt, das Menschliche der Renaissancemaler zu überschätzen, nur weil wir keine Schwäche in der Form entdecken. Aber im Gotischen und im Barock erfüllt ein ganz großer Künstler seine Mission, indem er ihre Sprache vertieft und vollendet; in der Renaissance mußte er sie zerstören.
Dies ist der Fall Lionardos, Raffaels und Michelangelos, der einzigen großen Menschen Italiens, seit den Tagen der Gotik. Ist es nicht seltsam, daß zwischen den Meistern der Gotik, die nichts als Arbeiter in ihrer Kunst waren und doch das Größte im Dienste dieser Konvention und innerhalb ihrer Schranken leisteten, und den Venezianern und Holländern, die wieder nichts als Maler, Arbeiter waren, diese drei stehen, nicht nur Maler, nicht Bildhauer, sondern Denker, und zwar Denker aus Not, die sich außer mit allen möglichen Arten künstlerischen Ausdrucks auch noch mit tausend andern Dingen beschäftigten, ewig unruhig und unbefriedigt, um dem Wesen und dem Ziel ihrer Existenz auf den Grund zu kommen — die sie in den seelischen Bedingungen der Renaissance also nicht fanden?[S. 369] Diese drei Großen haben, jeder in seiner Weise, jeder in einem eignen tragischen Irrgang, versucht, antik im Sinne der mediceischen Theorie zu sein und jeder hat nach einer andern Seite hin diese Illusion zerstört. Raffael die große Linie, Lionardo die Fläche, Michelangelo den Körper. In ihnen kehrt die verirrte Seele zu ihrem faustischen Ausgang zurück. Sie wollten das Maß statt der Beziehung, die Zeichnung statt der Wirkung von Licht und Schatten, den euklidischen Leib statt des reinen Raumes. Aber eine euklidisch-statische Plastik hat es damals überhaupt nicht gegeben. Sie war nur einmal möglich: in Athen. Eine latente Musik ist immer und überall fühlbar. All ihre Gestalten haben Bewegtheit und eine Tendenz in die Ferne und Tiefe. Sie sind alle auf dem Wege zu Palestrina statt zu Phidias, wie sie alle von der schweigenden Musik der Kathedralen statt von den römischen Ruinen kommen. Raffael löste das florentinische Fresko auf, Michelangelo die Statue, Lionardo träumte schon von der Kunst Rembrandts und Bachs. Je ernster man die Aufgabe nimmt, das Ideal der Zeit zu verwirklichen, desto ungreifbarer wird es. Es gibt keinen Palast in dieser Epoche, von dem Kenner nicht geurteilt haben, daß er noch gotische oder schon barocke Elemente aufweise.
Mithin sind Gotik und Barock etwas, das da ist. Renaissance ist ein ideales Postulat, das über dem Wollen einer Zeit schwebt, unerfüllbar wie alle Postulate. Giotto ist ein gotischer und Tizian ein Barockkünstler. Michelangelo wollte ein Renaissancekünstler sein, aber es gelang ihm nicht. Schon daß — trotz aller plastischen Ambitionen und aller Literatur — die Malerei unbestritten überwog, und zwar mit den räumlich-perspektivischen Voraussetzungen des Nordens, beweist den Widerspruch zwischen Verstand und Seele, zwischen Sehnsucht und Erfüllung. Das schöne Maß, die abgeklärte Regel, das gewollt Antike also, wurde schon um 1520 als trocken und formelhaft empfunden. Michelangelo und andre mit ihm waren der Meinung, daß sein Kranzgesims am Palazzo Farnese, durch das er die Fassade Sangallos vom Renaissancestandpunkt aus verdarb, die Leistungen der Griechen und Römer weit übertraf. Das Antigotische fand keine Liebhaber mehr. Man hatte es satt. Erst von jetzt an werden römische Ruinen, wie das[S. 370] Kolosseum und Septizonium, als Steinbrüche für Barockbauten benutzt.
Wie Petrarca der erste, so war Michelangelo der letzte leidenschaftlich für die Antike empfindende Mensch von Florenz, aber er war es nicht mehr ganz. Das franziskanische Christentum Fra Angelicos, von feiner Milde, versonnen, still ergeben, dem die südliche Abgeklärtheit reifer Renaissancewerke weit mehr zu verdanken hat als man glaubt,[87] ging zu Ende. Der majestätische Geist der Gegenreformation, schwer, bewegt und prächtig, lebt schon in Michelangelos Werken. Es gibt etwas, das man damals antik nannte und das nur eine edle Form des christlichen Weltgefühls war; der syrischen Herkunft des florentinischen Lieblingsmotivs, der Verbindung von Rundbogen und Säule, war schon gedacht. Aber man vergleiche auch die pseudo-korinthischen Kapitäle des 15. Jahrhunderts mit denen römischer Ruinen, die man doch kannte. Michelangelo war der einzige, der hier kein äußeres Abkommen ertrug. Er wollte Klarheit. Für ihn war die Frage der Form eine religiöse Frage. Es handelt sich bei ihm und ihm allein um alles oder nichts. So erklärt sich das einsame, furchtbare Ringen dieses wohl unglücklichsten Menschen innerhalb unsrer Kunst, das Fragmentarische, Gequälte, Unersättliche, das terribile seiner Formen, das die Zeitgenossen ängstigte. Der eine Teil seines Wesens zog ihn zum Altertum und also zur Plastik. Man weiß, wie die eben gefundene Laokoongruppe auf ihn wirkte. Ehrlicher als er hat niemand versucht, durch die Kunst des Meißels den Weg zu einer verschütteten Welt zu finden. Alles was er geschaffen hat, war plastisch in diesem, von ihm allein vertretenen Sinne gemeint. „Die Welt, vorgestellt im großen Pan“,[S. 371] das, was Goethe im zweiten Teil des Faust hatte geben wollen, als er die Helena einführte, die apollinische Welt in ihrer mächtigen, sinnlichen und körperlichen Gegenwart — das hat kein andrer so mit allen Kräften in ein künstlerisches Dasein bannen wollen, als er, damals als er die Decke der Sixtinischen Kapelle malte. Alle Mittel des Fresko, die großen Konturen, die mächtigen Flächen, die drängende Nähe nackter Gestalten, das Stoffliche der Farbe sind hier zum letzten Male bis zum äußersten angespannt, um das Heidentum in ihm — im höchsten Renaissancesinne — zu befreien. Aber seine zweite Seele, die gotisch-christliche Dantes und der Musik weiter Räume, die deutlich genug aus der metaphysischen Anordnung des Entwurfs redet, leistete Widerstand.
Er hat zum letzten Male versucht, immer und immer wieder, die ganze Fülle seiner Persönlichkeit in die Sprache des Marmors, des euklidischen Materials zu legen, das ihm den Dienst versagte. Denn er stand dem Stein anders gegenüber als ein Grieche. Die gemeißelte Statue widerspricht schon durch die Art ihres Daseins einem Weltgefühl, das in Kunstwerken etwas sucht, nicht in ihnen etwas besitzen will. Für Phidias ist der Marmor der kosmische Stoff, der sich nach Form sehnt. Die Pygmalionsage erschließt das ganze Wesen dieser apollinischen Kunst. Für Michelangelo war er der Feind, den er unterwarf, der Kerker, aus dem er seine Idee erlösen mußte, wie Siegfried Brunhilde befreit. Man kennt seine leidenschaftliche Art, den rohen Block anzugreifen. Er näherte ihn nicht Schritt für Schritt der gewollten Gestalt an. Er meißelte in den Stein wie in einen Raum hinein und brachte eine Figur zustande, indem er zum Beispiel von dem Block, an der Stirnseite beginnend, schichtweise das Material fortnahm und in die Tiefe drang, während die Gliedmaßen sich langsam aus der Masse entwickelten. Die Weltangst von dem Gewordnen, dem Element, dem Tode, den man durch eine bewegte Form zu bannen sucht, kann nicht deutlicher ausgedrückt werden. Kein Künstler des Abendlandes besitzt ein so innerliches und zugleich gewaltsames Verhältnis zum Stein als dem Symbol des Todes, zu dem feindlichen Prinzip in ihm, das seine dämonische Natur immer wieder bezwingen wollte, ob er nun seine Statuen heraushieb[S. 372] oder seine mächtigen Bauten aus ihm auftürmte.[88] Er ist der einzige Bildhauer seiner Zeit, für den nur der Marmor in Frage kam. Der Bronzeguß, der einen Ausgleich mit malerischen Tendenzen gestattete und dem er deshalb fern stand, lag den andern Renaissancekünstlern und den weicheren Griechen viel näher.
Aber der antike Bildhauer fesselte einen augenblicklichen leiblichen Zustand in Stein. Dessen ist der faustische Mensch gar nicht fähig. Wie er in der Liebe nicht zuerst den Naturtrieb, den sinnlichen Akt der Vereinigung von Mann und Weib findet, sondern die große Liebe Dantes und darüber hinaus die Idee der sorgenden Mutter, so hier. Michelangelos Erotik — die Beethovens — war so unantik als möglich; sie stand unter dem Aspekt der Ewigkeit und Ferne, nicht der Sinne und des flüchtigen Augenblicks. In Michelangelos Akten — einem Opfer an sein hellenisches Idol — verneint und übertönt die Seele die sichtbare Form. Die eine will Unendlichkeit, die andre Maß und Regel, die eine will Vergangenheit und Zukunft verknüpfen, die andre in der Gegenwart beschlossen sein. Das antike Auge saugt die plastische Form in sich auf. Michelangelo aber sah mit dem geistigen Auge und durchbrach die Vordergrundsprache der unmittelbaren Sinnlichkeit. Und endlich vernichtete er die Bedingungen dieser Kunst. Der Marmor wurde seinem Formwollen zu gering. Michelangelo hört auf Bildhauer zu sein und geht zur Architektur über. Im hohen Alter, als er nur noch wilde Fragmente wie die Madonna Rondanini zustande brachte[S. 373] und seine Gestalten kaum mehr aus dem Rohen herausmeißelte, brach die musikalische Tendenz seines Künstlertums durch. Endlich ließ sich der Wille zu einer kontrapunktischen Form nicht mehr bändigen und aus tiefstem Ungenügen an der Kunst, an welche er sein Leben verschwendet hatte, zerbrach sein ewig ungestilltes Ausdrucksbedürfnis die architektonische Regel der Renaissance und schuf das römische Barock. An die Stelle des Verhältnisses von Stoff und Form setzt er den Kampf von Kraft und Masse. Er faßt die Säulen in Bündel zusammen oder drängt sie in Nischen; er durchbricht die Geschosse mit mächtigen Pilastern; die Fassade erhält etwas Wogendes und Drängendes; das Maß weicht der Melodie, die Statik der Dynamik. Die faustische Musik hatte sich die erste unter den andern Künsten dienstbar gemacht.
Mit Michelangelo ist die Geschichte der abendländischen Plastik zu Ende. Was nach ihm kommt, sind Mißverständnisse und Reminiszenzen. Sein legitimer Erbe ist Palestrina.
Lionardo redet eine andre Sprache als seine Zeitgenossen. In wesentlichen Dingen reichte sein Geist in das nächste Jahrhundert und nichts band ihn wie Michelangelo mit allen Fasern seines Herzens an das toskanische Formideal. Er allein hatte weder den Ehrgeiz, Bildhauer, noch den, Architekt zu sein. Er trieb seine anatomischen Studien — ein seltsamer Irrweg der Renaissance, dem hellenischen Lebensgefühl und dessen Kultus der körperlichen Außenfläche nahe zu kommen! — nicht mehr wie Michelangelo der Plastik wegen; er trieb nicht mehr topographische Vordergrund- und Oberflächenanatomie, sondern Physiologie, um der innern Geheimnisse willen. Michelangelo wollte den ganzen Sinn der menschlichen Existenz in die Sprache des sichtbaren Leibes zwingen, Lionardos Skizzen und Entwürfe zeigen das Gegenteil. Sein vielbewundertes sfumato ist das erste Zeichen einer Verleugnung der Körpergrenzen um des Raumes willen. Von hier geht der Impressionismus aus. Lionardo beginnt mit dem Innern, dem Räumlich-Seelenhaften, nicht mit abgewognen Umrißlinien und legt zuletzt — wenn er es überhaupt tut und das Bild nicht unvollendet läßt — die farbige Substanz wie einen Hauch über die eigentliche, körperlose, ganz unbeschreibliche Fassung des Bildes. Raffaels Gemälde zerfallen[S. 374] in „Pläne“, in denen wohlgeordnet Gruppen verteilt sind, und ein Hintergrund schließt das Ganze maßvoll ab. Lionardo kennt nur den einen, weiten, ewigen Raum, in dem seine Gestalten gleichsam schweben. Der eine gibt innerhalb des Bildrahmens eine Summe einzelner und naher Dinge, der andre einen Ausschnitt aus dem Unendlichen.
Lionardo hat den Blutkreislauf entdeckt. Was ihn dahin führte, war kein Renaissancegefühl. Seine Gedankengänge heben ihn aus der ganzen Sphäre seiner Zeitgenossen heraus. Weder Michelangelo noch Raffael wären dahingekommen, denn die Maleranatomie sah nur auf Form und Lage, nicht auf die Funktion der Teile. Sie war, mathematisch gesprochen, stereometrisch, nicht analytisch. Hat man nicht das Studium von Leichen zureichend befunden, um die großen Gemäldeszenen figürlich auszuführen? Aber das hieß das Werden zugunsten des Gewordenen unterdrücken. Man rief die Toten zu Hilfe, um die antike ἀταραξία der nordischen Gestaltungskraft zugänglich zu machen. Aber Lionardo sucht das Leben wie Rubens, nicht den Körper an sich wie Signorelli. Es liegt in seiner Entdeckung eine tiefe Verwandtschaft mit der fast gleichzeitigen des Kolumbus; es ist der Sieg des Unendlichen als des faustischen Symbols über die stoffliche Begrenztheit des Gegenwärtigen und Greifbaren. Wann hätte je ein Grieche an solchen Dingen Geschmack gefunden? Er fragte nach dem Innern seines Organismus so wenig als nach den Quellen des Nils. Beides hätte die euklidische Fassung seines Daseins in Frage gestellt. Das Barock ist demgegenüber die eigentliche Zeit der großen Entdeckungen. Schon das Wort kündigt etwas schroff Unantikes an. Der antike Mensch hütete sich, von irgend etwas Kosmischem die Decke, die körperliche Bindung fortzunehmen oder fortzudenken. Aber gerade das ist der eigentliche Trieb einer faustischen Natur. Beinahe gleichzeitig und in der Tiefe völlig gleichbedeutend erfolgte die Entdeckung der neuen Welt, des Blutkreislaufs und des kopernikanischen Weltsystems, etwas früher die des Schießpulvers, also der Fernwaffe, und des Buchdrucks, der im Gegensatz zur antiken Rhetorik und der ihr dienenden Schriftrolle die Verbreitung der Gedanken ins Unendliche sichert.
[S. 375]
Lionardo war ganz und gar Entdecker. Darin erschöpft sich seine Natur. Pinsel, Meißel, Seziermesser, Rechenstift, Zirkel hatten für ihn ein und dieselbe Bedeutung — die, welche der Kompaß für Kolumbus hatte. Wenn Raffael einen in scharfen Umrissen gezeichneten Entwurf farbig ausführte, so bejahte jeder Pinselstrich die körperliche Erscheinung. Man betrachte aber Lionardos Rötelskizzen und Hintergründe: hier entdeckt er mit jedem Zuge atmosphärische Geheimnisse. Er war der erste, der über Flugversuche angestrengt nachdachte. Fliegen, sich von der Erde befreien, sich in die Weite des Weltraumes verlieren: das ist faustisch im höchsten Grade. Das erfüllt selbst unsere Träume. Hat man nie bemerkt, wie die evangelische Legende in der Malerei des Abendlandes zu einer wunderbaren Verklärung dieses Motivs wurde? All diese gemalten Himmelfahrten und Höllenstürze, das Schweben über den Wolken, die selige Entrücktheit der Engel und Heiligen, die eindringlich gestaltete Freiheit von aller Erdenschwere sind Sinnbilder des faustischen Seelenfluges und dem byzantinischen Stil gänzlich fremd. Dem Griechen, wie die Ikarussage beweist, erscheint dies als der Gipfel allen Frevels. Der bloße Gedanke daran stellt ihr euklidisches Weltgefühl in Frage. Ent-decken, die Decke aufheben, das heißt die Dinge durchschauen, ihre Bedingtheit bemerken, ihre Grenzen auflösen. Lionardos Malerei löst das Stoffliche auf. Antike Menschen kennen eine tiefe Furcht vor dem Geheimnis, das unter der sinnlichen Fläche der Welt schläft. Ihr Fresko verleugnet den Hintergrund, und zwar mit dem Pathos eines großen Symbols. Renaissancemenschen allerdings fühlen hier keine Tiefe. Ihre Hintergründe sind bloße Abschlüsse. Aber den Menschen des Barock erfüllt die unersättliche Leidenschaft für die Wikingerfahrten der Seele. Er braucht Geheimnisse, um sie zu überwinden. Er braucht Weiten für die innere Musik seiner Seele. Hier, im Schaffen Lionardos, reift, was die Gotik geahnt hatte.
Die Verwandlung des Freskogemäldes der Renaissance in das Ölbild ist ein Stück Seelengeschichte, die noch niemand beschrieben hat. Hier hängen alle Einblicke von den zartesten[S. 376] und verborgensten Zügen ab. Fast in jedem Bilde ringt das Freskenhafte mit der andringenden neuen Form. Raffaels malerische Entwicklung während seiner Arbeit in den Stanzen des Vatikan ist fast das einzige übersichtliche Beispiel. Das florentinische Fresko sucht die Wirklichkeit in einzelnen Dingen und gibt innerhalb der architektonischen Umrahmung eine Summe von ihnen. Das Ölbild erkennt mit steigender Sicherheit des Ausdrucks nur die Ausgedehntheit als Ganzes an und jeden Gegenstand nur als ihren Repräsentanten. Das faustische Weltgefühl schuf die neue Technik für sich. Es verwarf den zeichnerischen Stil, wie es die Koordinatengeometrie aus der Zeit des Oresme verwarf. Es verwandelte die an Architekturmotive gebundene Linearperspektive in eine rein atmosphärische Perspektive, die mit unwägbaren Tondifferenzen arbeitet. Das entspricht der reinen Analysis seit Descartes. Aber die ganze künstliche Lage der Renaissancekunst, ihr Nichtverstehen der eignen Tendenz, die Unmöglichkeit, das antigotische Prinzip völlig zu realisieren, erschwerte und verdunkelte den Übergang. Jeder Künstler hat ihn auf andre Weise versucht. Der eine malt mit Ölfarben auf die nasse Wand. Lionardos Abendmahl ist bekanntlich deshalb der Zerstörung anheimgefallen. Andre malen Tafelbilder, als ob sie Fresken wären. Das ist der Fall Michelangelos. Kühne Schritte, Ahnungen, Niederlagen, Verzichte finden sich. Der Kampf zwischen der Hand und der Seele, zwischen Auge und Werkzeug, der vom Künstler und der von der Zeit gewollten Form ist immer derselbe — der zwischen Plastik und Musik.
Hier verstehen wir endlich Lionardos riesenhaft gedachten Entwurf zur Anbetung der heiligen drei Könige in den Uffizien, das größte malerische Wagnis der Renaissance. Bis auf Rembrandt ist ähnliches nie auch nur geahnt worden. Über alles optische Maß hinaus, über alles, was man damals Zeichnung, Kontur, Komposition, Gruppe nannte, will er zur Anbetung des ewigen Raumes vordringen, in dem alles Körperliche schwebt wie die Planeten im kopernikanischen System, wie die Töne einer Bachschen Orgelfuge in der Dämmerung alter Kathedralen, ein Bild von einer solchen Dynamik der Ferne, daß es innerhalb der technischen Möglichkeiten dieser Zeit Torso bleiben mußte.
[S. 377]
In der sixtinischen Madonna resümiert Raffael die gesamte Renaissance durch die kolossale Linie des Umrisses, die den ganzen Gehalt des Werkes in sich saugt. Es ist die letzte große Linie der abendländischen Kunst. Ihre gewaltige Innerlichkeit, die den Widerspruch mit der Konvention bis zur äußersten Spannung treibt, macht Raffael zu dem am wenigsten verstandenen Künstler der Renaissance. Er kämpfte nicht mit Problemen. Er ahnte sie nicht einmal. Aber er führte die Kunst bis an deren Schwelle, wo der Entscheidung nicht mehr ausgewichen werden konnte. Er starb, als er innerhalb ihrer Formenwelt das letzte vollendet hatte. Der Menge erscheint er flach. Sie wird niemals empfinden, was in seinen Entwürfen vor sich geht. Aber hat man wohl die Morgenwölkchen bemerkt, die, sich in Kinderköpfe verwandelnd, die ragende Gestalt umgeben? Es sind die Scharen der Ungebornen, welche die Madonna ins Leben zieht. Diese lichten Wolken erscheinen im gleichen Sinne auch in der mystischen Schlußszene des zweiten Faust. Gerade das Abweisende, die Unpopularität im höchsten Sinne schließt hier die innere Überwindung des Renaissancegefühls in sich. Perugino versteht man beim ersten Blick; bei Raffael glaubt man es nur. Obwohl zunächst gerade die plastische Linie, das zeichnerische Moment eine antike Tendenz ankündigt, ist sie doch im Raum verschwebend, überirdisch, beethovenartig. Raffael ist in diesem Werke verschlossener als jeder andre, viel mehr selbst als Michelangelo, dessen Intentionen durch das Fragmentarische seiner Arbeiten deutlich werden. Seine innersten Geheimnisse scheint kein Zeitgenosse gekannt zu haben. Fra Bartolommeo hatte die stoffliche Umrißlinie noch ganz in seiner Gewalt; sie ist ganz Vordergrund, sie redet allein, ihr Sinn erschöpft sich in der Abgrenzung von Körpern. Bei Raffael schweigt sie, wartet sie, verhüllt sie sich. Sie steht, bei äußerster Spannung, unmittelbar vor ihrer Auflösung im Unendlichen, in Raum und Musik.
Lionardo steht jenseits der Grenze. Der Entwurf zur Anbetung der drei Könige ist schon Musik. Es liegt ein tiefer Sinn in dem Umstande, daß er hier wie bei seinem Hieronymus bei der braunen Untermalung stehen blieb, dem „Rembrandtstadium“, dem atmosphärischen Braun des nächsten Jahrhunderts. Für ihn war in diesem Zustande die äußerste Vollkommenheit[S. 378] und Deutlichkeit der Intention erreicht. Jeder Schritt weiter in eine Farbenbehandlung, deren Geist damals noch in den metaphysischen Bedingungen des Freskostils befangen war, hätte die Seele des Entwurfs zerstört. Gerade weil er die Symbolik der Ölmalerei in ihrer ganzen Tiefe vorfühlte, fürchtete er das Freskenhafte der „Fertigmaler“, das seine Idee verflachen mußte. Die Studien zu dem Gemälde beweisen, wie sehr ihm die Radierung in der Art Rembrandts gelegen hätte, eine Kunst aus der Heimat des Kontrapunkts, die man in Florenz nicht kannte. Erst die Venezianer, außerhalb der florentinischen Konvention stehend, haben erreicht, was er hier suchte; eine Farbenwelt, die dem Raume, nicht den Dingen dient.
Aus demselben Grunde hat Lionardo — nach unendlichen Versuchen — den Christuskopf des Abendmahls unvollendet gelassen. Auch für ein Porträt in der großen Auffassung Rembrandts für eine aus bewegten Pinselstrichen, Lichtern und Tönen aufgebaute Seelengeschichte war der Mensch dieser Zeit nicht reif. Aber nur Lionardo war groß genug, um diese Schranke als tragisches Geschick zu erleben. Die andern hatten nur den Kopf geben wollen, wie ihn die Schule vorschrieb. Lionardo, der hier zum ersten Male auch die Hände sprechen ließ, und zwar mit einer physiognomischen Meisterschaft, die später zuweilen erreicht, aber nie übertroffen worden ist, wollte unendlich viel mehr. Seine Seele war weit in die Zukunft verloren, aber sein Menschliches, sein Auge, seine Hand gehorchten dem Geiste seiner Zeit. Sicherlich war er in einer verhängnisvollen Weise der Freieste von den drei Großen. Vieles von dem, womit Michelangelos mächtige Natur vergebens rang, hat ihn gar nicht mehr berührt. Probleme der Chemie, der geometrischen Analysis, der Physiologie — Goethes „lebendige Natur“ war auch die seine — der Fernwaffentechnik sind ihm vertraut. Er hat die Maschinentechnik antizipiert. Seine Intuitionen machen ihn zum Ahnherrn von Leibniz und Goethe; er empfand den Raum wie der erste und den Organismus wie der zweite. Tiefer als Dürer, kühner als Tizian, umfassender als irgendein Mensch der Zeit, ist er der fragmentarische Künstler par excellence geblieben,[89] aber aus[S. 379] einem andern Grunde als Michelangelo, der verspätete Plastiker, und im Gegensatz zu Goethe, für den alles schon zurücklag, was dem Schöpfer des Abendmahls unerreichbar blieb. Michelangelo wollte eine erstorbene Formenwelt noch einmal zum Leben zwingen, Lionardo fühlte eine neue in der Zukunft, Goethe ahnte, daß es keine mehr gab. Zwischen ihnen liegen die drei reifen Jahrhunderte faustischer Kunst.
Es ist noch übrig, das Sterben der abendländischen Kunst in seinen großen Zügen zu verfolgen. Die innerste Notwendigkeit alles historischen Werdens ist hier am Werke. Wir haben gelernt, Künste als Urphänomene zu begreifen. Wir suchen nicht mehr nach Ursachen und Wirkungen im physikalischen Sinne, um ihrer Geschichte Zusammenhang zu geben. Wir haben den Begriff des Schicksals einer Kunst in sein Recht eingesetzt. Wir haben endlich Künste als Organismen erkannt, die in dem größeren Organismus einer Kultur ihre bestimmte Stellung einnehmen, geboren werden, reifen, altern und für immer absterben. Das griechische Fresko, das byzantinische Mosaik, das gotische Glasgemälde, das perspektivische Ölbild sind nicht Phasen einer allgemein menschlichen Kunst. Es sind Formideale einzelner, wohlbegrenzter und voneinander innerlich unabhängiger Künste, von denen jede ihre eigne Biographie besitzt. Die Gotik war, wie die Dorik, wie der Stil des Alten Reiches von Memphis, ein Suchen der jungen Seele nach Formen, um die Welt zu erfassen, an sich zu ziehen, sich einzuverleiben. Ihre Sprache, zaghaft, voller Schauder vor dem Unbegriffenen, nach einem noch unbekannten Ziele tastend, kündigt eine große Entwicklung erst an. Hier finden wir die Fehlgriffe, die Ratlosigkeit, das Irren aller Jugend. Mit dem Abschluß der Renaissanceepisode — der letzten Verirrung — ist die abendländische Seele zum reifen Bewußtsein ihrer Kräfte und Möglichkeiten gelangt. Sie hat ihre Künste gewählt. Eine Spätzeit, das Barock wie die Ionik, weiß, was die Formensprache der Kunst zu bedeuten hat. Sie war bis dahin eine philosophische Religion, jetzt wird sie eine religiöse Philosophie. Die gewordne Außenwelt, oder was dasselbe ist,[S. 380] die Wirklichkeit, die erlebte Natur, und zwar die von jeder einzelnen Seele, der faustischen, apollinischen, magischen für sich erlebte, geschaffene, zu ihrem Abbilde gestaltete Natur wird in den Mikrokosmos eines Kunstwerkes zusammengezogen, auf ein Symbol räumlich-sinnlicher Art, eine Formel der innern Existenz gebracht. Es erscheint auf der Höhe einer jeden Kultur das Phänomen einer prachtvollen Gruppe großer Künste, wohlgeordnet und durch das zugrunde liegende Ursymbol zu einer Einheit verknüpft.
Wenn man die „bildenden“ Künste, zu denen auch die Musik gehört, überhaupt gruppieren will, so findet sich ein natürlicher Unterschied, je nachdem man das Tiefenerlebnis durch unmittelbare Behandlung des Ausgedehnten wiedergibt oder indem man auf einer Fläche den Eindruck des Ausgedehnten erweckt. Das letztere ist „Malerei“. Die unmittelbare Nachahmung könnte sich auf den reinen, unendlichen Raum beziehen — das war der polyphonen Instrumentalmusik möglich, oder auf das Ideal des einzelnen stofflichen Körpers — das geschah durch eine Skulptur, die ihr Werk allseitig frei und durchgebildet auf den Boden stellte. Dem entsprechen nun aber sehr verschiedene Arten von Malerei, vielmehr von Künsten, die außer dem Namen nichts gemein haben. Zur Kunst des Raumes gehört eine Behandlung der Fläche, welche den Eindruck reiner Tiefe wachruft und das selbständige Dasein der Körper zuletzt verneint. Das erste geschieht durch die Perspektive, das zweite heißt Impressionismus. Andererseits gehört zur Rundplastik eine Malerei, die nur Körper kennt, das heißt, die nur Konturen gibt und den Hintergrund verleugnet. Das hier wirksame Prinzip der Auswahl entscheidet mit der Notwendigkeit eines Schicksals über das Dasein, den Rang und das Ende einzelner Künste innerhalb einer Kultur. So entsteht, und ich setze dies der heute gültigen Anschauung über die Struktur der Kunstgeschichte entgegen, die historische Gruppe von Künsten.
Die apollinische Gruppe, zu der die Vasenmalerei, das Fresko, das Relief, die Architektur der Säulenordnungen, das attische Drama, der Tanz gehören, hat die Skulptur der nackten Statue zur Mitte. Die faustische Gruppe bildet sich um das[S. 381] Ideal reiner räumlicher Unendlichkeit. Ihren Mittelpunkt bildet die kontrapunktische Musik. Von ihr aus spinnen sich feine Fäden in alle geistigen Formenwelten hinüber und verweben die infinitesimale Mathematik, die dynamische Physik, den Katholizismus des Jesuitenordens und den Protestantismus der Aufklärung, die moderne Maschinentechnik, das Kreditsystem und die dynastisch-soziale Staatsorganisation zu einer ungeheuren Totalität seelischen Ausdrucks. Mit dem innern Rhythmus der Dome beginnend, mit Wagners Tristan und Parsival endend, erreicht die künstlerische Bewältigung des unendlichen Raums ihre vollkommene Ausbildung um 1550. Die Plastik erlischt mit Michelangelo, gerade damals, als die Planimetrie, die bis dahin die Mathematik beherrscht hatte, ihr unwesentlichster Teil wird. Mit der Musik fugierten Stils, die eben jetzt durch Orlando Lasso ein Kunstmittel von ungeheuren Möglichkeiten geworden war, beginnt ihre Schwester, die Infinitesimalrechnung hervorzutreten.
Ölmalerei und Instrumentalmusik, die Künste des Raumes, treten ihre Herrschaft an. In der Antike waren es folglich die Künste des stofflich-euklidischen Prinzips, das streng flächenhafte Fresko und die freistehende Statue, die gleichzeitig — um 600 — in den Vordergrund treten. Damit ist die faustische und die apollinische Gruppe reifer Künste — der auch zwei mächtige, in Shakespeare und Äschylus gipfelnde tragische Künste angehören — im Umriß bestimmt. Und zwar sind es die beiden Arten von Malerei, die, in ihrer Formensprache gemäßigter, zugänglicher, zuerst heranreifen. Dem Ölgemälde gehört die Zeit von 1550–1650 ebenso unbestritten wie das 6. Jahrhundert der Tonmalerei. Die Symbolik von Raum und Körper, ausgedrückt durch das Kunstmittel der Perspektive und der Proportion, erscheint in der mittelbaren Sprache des Gemäldes nur angedeutet. Diese Künste, welche Raum oder Körper, also Möglichkeiten des Ausgedehnten, in der Bildfläche nur vorzutäuschen vermögen, konnten das antike und abendländische Ideal wohl bezeichnen und heraufrufen, aber nicht vollenden. Auf dem Wege des großen Stils erscheinen sie als Vorstufen der letzten Höhe. Je mehr die Kulturen sich ihrer Vollendung näherten, desto entschiedener wurde der Drang nach einer Kunst von unerbittlicher[S. 382] Klarheit der Symbolik. Die Malerei genügte nicht mehr. Die Gruppe der Künste wurde weiterhin vereinfacht. Um 1670, gerade damals als Newton und Leibniz die Differentialrechnung entdeckten, war die Ölmalerei an der Grenze ihrer Möglichkeiten angelangt. Die letzten großen Meister starben, Velasquez 1660, Poussin 1665, Hals 1666, Rembrandt 1669, Vermeer 1675, Ruysdael und Lorrain 1682. Man braucht nur die wenigen Nachfolger von Bedeutung, Watteau, Hogarth, Tiepolo zu nennen, um den Abstieg, um das Ende einer Kunst fühlen zu lassen. Eben jetzt, um 1650, hatte sich nun die Instrumentalmusik in den großen Formen der Suite, des Concerto grosso und der Sonate für Soloinstrumente von dem Rest des Körperlichen im Klange der menschlichen Stimme befreit. Auch Heinrich Schütz (1672) und Carissimi (1674), die letzten Meister der Vokalmusik, starben damals. 1685 werden Bach und Händel geboren und mit ihnen wachsen Stamitz, Kuhnau, Corelli, Tartini, die beiden Scarlatti heran. Von nun an ist die Musik, und zwar die rein instrumentale, nicht die vokale, die faustische Kunst. Die entsprechende Krisis findet sich um 470 in der Antike, wo der letzte der großen Freskomaler, Polygnot, seinem Schüler Polyklet und damit der Statuenplastik endgültig den Vorrang abtritt.
Mit dieser Musik und dieser Plastik ist das Ziel erreicht. Eine reine Symbolik von mathematischer Strenge ist möglich geworden: das bedeutet der Kanon, jene Schrift Polyklets über die Proportionen des menschlichen Körpers, und als Gegenstück der kontrapunktische Kanon seines „Zeitgenossen“ Bach. Diese Künste leisten das Äußerste und Letzte an Deutlichkeit und Intensität der reinen Form. Man vergleiche doch den Tonkörper der faustischen Instrumentalmusik und in ihm wieder den Streichkörper und bei Bach auch noch den als Einheit wirkenden Körper der Blasinstrumente mit dem Körper attischer Statuen; man vergleiche, was Haydn und was Praxiteles eine Figur nannten, nämlich die eines Themas oder die eines Athleten, eine Bezeichnung, welche der Mathematik entnommen ist und verrät, daß dieses jetzt endlich erreichte Ziel das einer Vereinigung künstlerischen und mathematischen Geistes ist, denn zugleich mit Musik und Plastik haben die Analysis des Unendlichen und[S. 383] die euklidische Geometrie ihre Aufgabe, ihr spezifisches Zahlenproblem mit voller Deutlichkeit begriffen. Ihre größten Meister leben gleichzeitig mit denen jener durch und durch mathematischen Künste. Man erinnert sich, wie an einer frühern Stelle die Mathematik eine Kunst und der große Mathematiker ein Künstler und Visionär genannt worden war. Hier liegt die Erklärung. Die Mathematik des Schönen und die Schönheit des Mathematischen sind nicht mehr zu trennen. Der unendliche Raum der Töne und der reine Körper von Marmor oder Bronze sind eine unmittelbare Interpretation des Ausgedehnten und Gewordnen. Sie gehören zu der Zahl als Beziehung und der Zahl als Maß. Im Fresko wie im Ölbilde wird man, in den Gesetzen von Proportion und Perspektive, nur Andeutungen von Mathematischem finden. Diese beiden letzten und strengsten Künste sind Mathematik. Der Kontrapunkt wie der Statuenkanon sind absolute Zahlenwelten. Hier herrschen Gesetze und Formeln. Auf diesem Gipfel erscheint die faustische wie die apollinische Kunst vollkommen.
Mit dem Ende der Fresko- und Ölmalerei als herrschenden Künsten beginnt die dichte Reihe der großen Meister der Plastik und Musik. Auf Polyklet folgen Phidias, Skopas, Praxiteles, Lysippos, auf Bach und Händel Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven. Jetzt erscheint die Menge wunderbarer, heute längst verschollener Instrumente, eine ganze Zauberwelt abendländischen Entdecker- und Erfindergeistes, um immer neue Klänge und Tonfarben für den Dienst und die Steigerung des Ausdrucks heranzuziehen. Jetzt die Fülle großer, feierlicher, zierlicher, leichter, spöttischer, lachender, schluchzender Formen von strengstem Bau, auf die sich heute niemand mehr versteht; es gab damals, vor allem im Deutschland des 18. Jahrhunderts, eine wirkliche Kultur der Musik, die das ganze Leben durchdrang und erfüllte, deren Typus Hoffmanns Kapellmeister Kreisler wurde — der ebenbürtig neben Goethes Faust, dem deutschen Denker, als die tiefste poetische Konzeption des deutschen Musikers steht — und von der uns kaum die Erinnerung mehr geblieben ist.
Endlich, gegen 1800, stirbt auch die Architektur. Sie löst sich, sie ertrinkt in der Musik des Rokoko. Alles, was man an[S. 384] dieser letzten wundervollen, fragilen Blüte der abendländischen Baukunst getadelt hat — weil man ihre Entstehung aus dem Geiste des Kontrapunktes nicht verstand —, das Maßlose, Formlose, Verschwebende, Wogende, Funkelnde, die Zerstörung der Fläche und Gliederung für das Auge — alles das ist ja nur der Sieg der Töne und Melodien über Linien und Körper, der Triumph des reinen Raumes über den Stoff, des absoluten Werdens über das Gewordne. Es sind nicht mehr Baukörper, diese Abteien, Schlösser, Kirchen mit ihren geschwungenen Fassaden, Portalen, Höfen mit Muschelinkrustation, mächtigen Treppenhäusern, Galerien, Sälen, Kabinetten, sondern steingewordne Sonaten, Menuette, Madrigale, Präludien; Kammermusik in Stuck, Marmor, Elfenbein und edlen Hölzern, Kantilenen von Voluten und Kartuschen, Kadenzen von Freitreppen und Firsten. Der Dresdner Zwinger ist das vollkommenste Stück Musik in der gesamten Weltarchitektur, ein allegro fugitivo für kleines Orchester.
Deutschland hat die großen Musiker und also auch die großen Baumeister — Pöppelmann, Schlüter, Bähr, Neumann, Fischer von Erlach, Dinzenhofer — dieses Jahrhunderts hervorgebracht. In der Ölmalerei spielt es keine, in der Instrumentalmusik die entscheidende Rolle.
Ein Wort, das erst zur Zeit Manets in Aufnahme kam — zuerst ein Spottname wie Barock und Rokoko —, faßt die Eigenart des faustischen Kunstvortrags, wie er sich aus den Voraussetzungen der Ölmalerei allmählich entwickelt hat, sehr glücklich zusammen. Man spricht vom Impressionismus, ohne Umfang und tieferen Sinn des Begriffes, wie er hätte gefaßt werden sollen, zu ahnen. Man leitete ihn aus der letzten Nachblüte einer Kunst ab, die ganz und gar zu ihm gehört. Was ist Impressionismus? „Eindruckskunst?“ Etwas rein Abendländisches ohne Zweifel, etwas, das mit der Idee des Barock, selbst schon der der gotischen Architektur verwandt und den Absichten der Renaissance entgegengesetzt ist. Ist es nicht die geistige Kraft, den reinen unendlichen Raum als die unbedingte[S. 385] Wirklichkeit und alle sinnlichen Gebilde in ihm als sekundär und bedingt zu empfinden, und zwar mit innerster Notwendigkeit? Eine geistige Kraft, die in künstlerischen Schöpfungen hervortreten kann, die aber tausend andre Möglichkeiten kennt, um sich zu offenbaren? „Der Raum ist die apriorische Form der Anschauung“, die Formel Kants — ist das nicht ein Programm dieser Bewegung, die mit Lionardo anhebt? Der Impressionismus ist die Umkehrung des euklidischen Weltgefühls. Er sucht sich von der Sprache des Plastischen soweit als möglich zu entfernen und der des Musikalischen zu nähern. Man läßt die belichteten, das Licht zurückstrahlenden Dinge nicht auf sich wirken, weil sie da sind, sondern als ob sie „an sich“ nicht da wären. Man empfängt und gibt den Eindruck von Gegenständen, die man innerlich als bloße Funktion einer optisch nicht mehr erreichbaren Ausgedehntheit wertet. Man durchdringt die Körper mit dem innern Auge, man löst den Zauber ihrer stofflichen Grenzen, man opfert sie der Majestät des Raumes. Und man fühlt mit und unter diesem irrealen Eindruck eine unendliche Bewegtheit des sinnlichen Elementes, die zu der statuenhaften ἀταραξία des Fresko den stärksten Gegensatz bildet. Deshalb gibt es keinen hellenischen Impressionismus. Deshalb ist die antike Skulptur die Kunst, welche ihn a limine ausschließt.
Der Impressionismus ist der umfassende Ausdruck eines Weltgefühls und es versteht sich, daß er die gesamte Physiognomik unsrer späten Kultur durchdringt. Es gibt eine impressionistische, die optischen Grenzen mit Absicht und Nachdruck überschreitende Mathematik. Wir kennen sie. Es ist die Analysis seit Newton und Leibniz. Zu ihr gehören die visionären Gebilde der Zahlkörper, Mengen, Transformationsgruppen, mehrdimensionalen Geometrien. Ihr liegt das Prinzip der funktionalen Zahl mit ihrer unfixierbaren Bewegtheit zugrunde. Es gibt eine impressionistische Physik — wir werden sie noch kennen lernen —, die an Stelle von Körpern Systeme von Massenpunkten „sieht“, Einheiten, die lediglich als das konstante Verhältnis variabler Wirksamkeiten erscheinen, mit Grenzflächen, die als wohlgeordnete Mengen von Zahlenmannigfaltigkeiten bestimmter Art definiert werden. Es gibt eine impressionistische Ethik, Tragik, Logik.
[S. 386]
Malerisch genommen handelt es sich um die Kunst, mit drei Strichen und Flecken ein Bild, einen Mikrokosmos für das Auge eines faustischen Menschen zu schaffen, das heißt die Wirklichkeit des Weltraumes durch die flüchtigste, körperloseste Andeutung von etwas Sichtbarem, das ihn gleichsam in die Sphäre der Erscheinung bannt, zu imaginieren. Es ist eine nie wieder gewagte Kunst der Bewegung des Unbeweglichen. Von Tizian bis hinab auf Corot und Menzel zittert und fließt die duftige Materie unter der geheimen Wirkung des Pinselstriches und der gebrochenen Farben. Das hatte schon der Fassadenstil Michelangelos und Vignolas gewollt. Deshalb war seitdem eine Kunst nach der andern erloschen, weil sie vor diesem letzten Ziel die Grenze ihrer Möglichkeiten erreicht hatte. Der Impressionismus ist die Methode subtiler künstlerischer Entdeckungen. Er wiederholt die Taten des Kolumbus und Kopernikus. Es gibt keine zweite Formensprache, in der jeder Fleck und Strich so überraschende Reize aufzudecken, der Einbildungskraft so ganz neue Elemente von raumschaffender Energie zuzuführen vermag. Das Fresko bejaht die Sinnenwirkung als schlechthin gegeben. Die neue Technik ist skeptisch; sie seziert die Empfindung bis zu ihrer Auflösung, wie es die Physik derselben Zeit tat. Man verfolge das Schicksal der menschlichen Einzelgestalt in dieser Malerei. Zuerst jede streng für sich, klar begrenzt, mit allen Kenntnissen der Anatomie gezeichnet, gemeißelt, durchgearbeitet, klare, wohl abgewogene Gruppen, die sich scharf von einem Hintergrunde abheben — bei Raffael. Dann bei Lionardo die Entdeckung der Übergänge von Licht und Dunkel, weiche Ränder, mit der Tiefe verschwimmende Umrisse, Gruppen und Massen von Licht und Schatten, aus denen sich einzelne Gestalten nicht mehr lösen lassen. Die Linearperspektive wird zur Kunst der Atmosphäre — dem eigentlichen Thema des Bildes. Die verharrende Linie hatte Körper begrenzt, das atmosphärische Licht mit seinen Ungewissen Tönungen begrenzt den Raum. Endlich, bei Rembrandt, verfließen die Gestalten zu bloßen farbigen Eindrücken; sie verlieren das spezifisch Menschliche; sie wirken als Strich und Farbenfleck bei ihm wie bei Lorrain und Vermeer; es ist das Schicksal des einzelnen Tones in der Musik von Palestrina bis Wagner. In einem Minimum von Substanz — von[S. 387] Farbe oder Ton — ein Maximum von physiognomischer Bedeutung zu bannen, mit einem Hauch den prägnanten Eindruck eines ganz bestimmten, nie wiederkehrenden Welterlebnisses zu geben, ist die Fähigkeit, welche man jetzt malerisch nennt. Man kann demnach den Impressionismus als Porträtkunst im umfassendsten Sinne betrachten. Wie ein Selbstbildnis Rembrandts nicht die anatomische Wirklichkeit des Kopfes, sondern das zweite Gesicht in ihr anerkennt, wie es nicht das Auge, sondern den Blick, nicht die Stirn, sondern das Erlebnis, nicht die Lippen, sondern die Sinnlichkeit durch das Ornament der Pinselstriche bannt, so zeigt das impressionistische Gemälde überhaupt nicht die Natur des Vordergrundes, sondern auch da ein zweites Antlitz, die Seele der Landschaft. Mag es sich um die katholisch-heroische Landschaft Lorrains, den paysage intime Corots, um das Meer, die Flußränder und Dörfer Cuyps und Van Goyens handeln, es entsteht immer ein Porträt im physiognomischen Sinne, etwas Einmaliges, Unvorhergesehenes und zum ersten und letzten Male ans Licht Gezogenes. Gerade die Vorliebe für die Landschaft — die physiognomische, die Charakterlandschaft —, für das Motiv also, das im Freskostil gar nicht denkbar ist und der Antike vollkommen unzugänglich blieb, erweitert die Porträtkunst vom unmittelbar Menschlichen zum mittelbaren, zur Darstellung der Welt als eines Teils des Ich, der Welt, in der der Künstler sich gibt und der Betrachter sich wiederfindet. Denn in diesen Weiten der sich in die Ferne dehnenden Natur spiegelt sich die Seele, das Schicksal. Es gibt in dieser Kunst tragische, dämonische, lachende, klagende Landschaften, etwas, wovon der Mensch andrer Kulturen keine Vorstellung und wofür er kein Organ hat. Aus dieser Gesinnung ist der Park der Barockzeit, als Spiegel großen Menschentums, entstanden.
Aber es gibt eine Kultur, weit entfernt von der faustischen, die auch eine impressionistische Kunst besaß, die chinesische. Wir wissen wenig von ihr; wir wissen nicht einmal, wo ihre zeitlichen Grenzen im Geschichtsbilde liegen. Sicher ist, daß Konfuzius lange nach ihrer Vollendung lebte und bereits das zivilisierte Stadium repräsentiert. Aber nach allem, was hier bisher vom Sinn der Kulturen festgestellt wurde, erscheint das[S. 388] Eine klar: wenn überhaupt eine andre Kultur und ihre Kunst zu einem so verwandten Symbol gelangte, mußte ihre Seele in jedem Betracht der unseren ähnlich sein. Gewiß, von Identität ist nirgends die Rede; die unendlich feinen und bedeutsamen Differenzen beider Seelen aufzufinden müßte eine der reizvollsten Aufgaben einer künftigen Psychologie sein. Das Tiefenerlebnis, der Sinn der Zukunft, des Horizontes, des Raumes, des Todes ist hier und dort nicht derselbe. Das Ursymbol der chinesischen Seele, ihr Weltgefühl ist trotz aller Nähe nicht das faustische und deshalb vielleicht gerade für uns schwer bestimmbar. Die alte ostasiatische Malerei sucht nicht die flüchtigen Wunder, die petits faits der Atmosphäre, nicht das Einmalige eines Raumerlebnisses auf. Sie wendet sich vom Wirklichen ab und dem wachen Traume zu. Ihre Meisterschaft liegt im Hinzaubern von Dingen, die Erinnerungen wecken, ohne zu sein, was sie scheinen. Ohne Zweifel ist diese tiefe Form historischer Transzendenz nicht die Watteaus oder Haydns. Das zarte chinesische Gefühl für Zeit, Leben, Schicksal, Vergangenheit ist uns sehr fremd. Aber trotzdem, welche Leidenschaft der Seele zum Grenzenlosen und Ewigen! Wie nahe rücken sich beide Arten des Menschentums, sobald man sie mit der antiken vergleicht! Eine Landschaft über das Thema „Abendglocken eines fernen Tempels“, wo der Klang und die Welt ferner Erinnerungen, die er im Innern weckt, in wenige Striche und Farbflecke gebannt erscheinen — ist das nicht trotzdem im Geiste Mozarts? Wir wundern uns nicht, daß diese Kultur den abendländischen Hang zur Astronomie und Geschichtsforschung, zur Sorge und Selbstbetrachtung besaß. Beide Kulturen erfanden, jede für sich, das Pulver, den Buchdruck, den Holzschnitt, den Kompaß, das Porzellan. Beide waren im Besitz einer hochentwickelten Gartenkunst und Musik. Beiden fehlte deshalb — in dem hier vorausgesetzten strengen Sinne — eine Plastik, während das Porträt (die altchinesische Porträtkunst war eine Leistung allerhöchsten Ranges) und die damit innerlich verwandte Charakterlandschaft die Malerei beherrschen. So ist die Wahlverwandtschaft zu erklären, die das 18. Jahrhundert zu China, das 19. zu Japan zog. Wir kannten damals alle fremden Kulturen, die indische, ägyptische, arabische; sie lagen uns alle näher; aber nur von dieser[S. 389] übernahmen wir, über den halben Erdball hinweg, nicht etwa einzelne Motive und Ideen, sondern den Gehalt ihrer künstlerischen Formensprache. Das unterscheidet das Verhältnis des Rokoko zur chinesischen Kunst sehr wesentlich von dem der Renaissance zur griechisch-römischen. Die Resorption ägyptischer Details um 1800 durch den Empirestil war eine flache Spielerei; die Übernahme der japanischen Malerei um 1860 ist eine Metamorphose, die Tiefe besitzt.
Ich sagte, daß die Ölmalerei am Ende des 17. Jahrhunderts, wo alle großen Meister kurz nacheinander starben, erlosch. Aber der Impressionismus im engern Sinne ist ja eine Schöpfung des 19. Jahrhunderts? Die Malerei hat also 200 Jahre länger geblüht oder dauert heute noch fort? Man täusche sich nicht. Zwischen Rembrandt und Delacroix oder Constable liegt eine tote Strecke und was bei dem letzten beginnt, ist trotz aller Zusammenhänge in Hinsicht auf Technik und Vortrag sehr verschieden von dem, was mit dem ersten endete. Hier, wo von einer lebendigen Kunst von größter Symbolik die Rede ist, zählen die rein dekorativen Künstler des 18. Jahrhunderts nicht mit. Watteau möchte man in allem, wo er tief ist, der Musik seiner Zeit zurechnen. Täuschen wir uns auch nicht über den Charakter der neuen malerischen Episode, die jenseits von 1800, der Grenze von Kultur und Zivilisation, noch einmal vorübergehend die Illusion einer großen Kultur der Malerei erwecken konnte. Sie selbst hat ihr eigentliches Thema als Pleinairismus bezeichnet und damit den Sinn ihrer flüchtigen Erscheinung deutlich genug enthüllt. Freilicht — das ist die bewußte, intellektuelle und brutale Abwendung von dem, was man plötzlich „die braune Sauce“ nannte und was, wie wir sahen, in den Bildern der großen Meister das eigentlich metaphysische Fluidum war. Auf ihm baute sich die Malkultur der Schulen, vor allem der niederländischen auf, die im Rokoko rettungslos dahinschwand. Dies Braun, das Symbol räumlicher Unendlichkeit, das für den faustischen Menschen aus dem Gemälde ein seelenhaftes Etwas schuf, empfand man plötzlich als Unnatur. Was war geschehen? Beweist das Faktum nicht, daß eben die Seele sich fortgestohlen[S. 390] hatte, für welche diese verklärte Farbe etwas Religiöses, ein Zeichen der Sehnsucht, der ganze Sinn einer lebendigen Natur gewesen war? Der Materialismus der westeuropäischen Weltstädte blies in die Asche und rief diese seltsame und kurze Nachblüte von zwei Malergenerationen hervor — denn mit der Generation Manets war alles schon wieder zu Ende. Ich hatte das erhabene Grün Grünewalds, Lorrains, Giorgiones als die katholische Farbe des Raumes bezeichnet und das transzendente Braun Rembrandts als die Farbe des protestantischen Weltgefühls. Das Freilicht, das jetzt eine neue Farbenskala entfaltet, bezeichnet demgegenüber den Atheismus.[90] Der Impressionismus ist aus den Sphären Beethovenscher Musik und Kantischer Sternenräume auf die Erdoberfläche zurückgekehrt. Dieser Raum ist ein intellektuelles, kein seelisches Faktum; er ist erkannt, errechnet, nicht erlebt; es ist das mechanische Objekt der Physik und nicht die gefühlte Welt der pastoralen Musik, was Courbet und Manet in ihre Landschaften bringen. Was Rousseau mit tragisch treffendem Ausdruck als Rückkehr zur Natur prophezeit hatte, vollzieht sich in dieser sterbenden Kunst. So kehrt ein Greis von Tag zu Tag „zur Natur zurück“. Der neue Künstler ist Arbeiter, nicht Schöpfer. Man stellt ungebrochene Spektralfarben nebeneinander. Die feine Handschrift, der Tanz des Pinselstriches macht mechanischen Gewohnheiten Platz: Punkte, Quadrate, breite anorganische Massen werden aufgetragen, vermengt, verbreitet. Neben dem breiten, flachen Pinsel erscheint der Spachtel als Werkzeug. Der Ölgrund der Leinwand wird in die Wirkung einbezogen und bleibt stellenweise frei. Eine gefährliche Kunst, peinlich, kalt, krank, für überfeinerte Nerven, aber wissenschaftlich bis zum äußersten, energisch in allem, was die Bewältigung technischer Widerstände angeht, programmatisch zugespitzt; es ist das Satyrspiel zur großen Ölmalerei von Lionardo bis Rembrandt. Sie konnte nur in dem Paris Baudelaires zu Hause sein.[S. 391] Corots silberne Landschaften in ihren grüngrauen und braunen Tönen träumten noch von dem Seelischen der alten Meister. Courbet und Manet eroberten den kahlen physikalischen Raum, den Raum als „Tatsache“. Der versonnene Entdecker Lionardo macht dem malenden Experimentator Platz. Corot, das ewige Kind, Franzose, nicht Pariser, fand seine Landschaften überall. Er hat noch einmal, im romantischen Sinne, etwas von der kontrapunktischen Kunst altholländischer Gemälde verwirklicht, so wie Novalis in seinen Marienliedern noch einmal das altprotestantische Kirchenlied erweckte. Aber Th. Rousseau, Courbet, Manet, Cézanne porträtieren ein und dieselbe Landschaft immer wieder, peinlich, mühsam, arm an Seele, den Wald von Fontainebleau oder die Seineufer bei Argenteuil oder jenes merkwürdige Tal bei Arles. Rembrandts mächtige Landschaften liegen durchaus im Weltraume, die Manets in der Nähe einer Bahnstation. Die Freilichtmaler, echte Großstädter, nahmen von den kühlsten Spaniern und Holländern, Velasquez, Goya, Hobbema und Franz Hals, die Musik des Raumes, um sie — mit Hilfe der englischen Landschafter und später der Japaner, intellektueller und hochzivilisierter Köpfe, — ins Empirische und Naturwissenschaftliche zu übersetzen. Das ist eine planmäßige Synthese, die sich vollkommen auf der Ebene der elementaren Form hält und die innere Gestalt, die Form der Seele aus dem Spiele läßt. Constable hat auf die Schule von Barbizon ebenso gewirkt wie Locke auf Voltaire. Um jenes Wort Goethes noch einmal zu gebrauchen: Rembrandt schaute, Manet sah die Natur an. Es ist der Unterschied von Naturerlebnis und Naturwissenschaft, von Herz und Kopf, von Glauben und Wissen.
Anders in Deutschland. In Frankreich war eine große Malerei abzuschließen, hier war sie nachzuholen. Denn der malerische Stil um 1860 setzt, als Schlußakt, alle Glieder der Entwicklung voraus; sie liegen dem Technischen zugrunde und wo auch eine Schule diesen neuen Stil, den der großstädtischen Zivilisation, pflegen will, bedarf sie einer geschlossenen inneren Tradition. Hierin beruht die Schwäche und Stärke der letzten deutschen Malerei. Die Franzosen besaßen eine eigne Überlieferung vom frühen Barock bis auf Chardin und Corot herab. Zwischen Lorrain und Corot, Rubens und Delacroix besteht ein[S. 392] lebendiger Zusammenhang. Aber alle großen Deutschen waren, als Künstler, Musiker geworden. Wenn die deutschen Maler jetzt nach Paris gingen, so taten sie dasselbe wie alle Komponisten andrer Länder, wenn sie Bach, Haydn, Mozart und Beethoven studierten. Sie nahmen von außen, was ihnen an innerer Tradition fehlte. Aber indem sie, wie Manet und die Maler seines Kreises, auch die alten Meister von 1670 studierten und kopierten, empfingen sie ganz neue, ganz andre Wirkungen, während die Franzosen nur Erinnerungen an etwas fühlten, das längst in ihre Kunst eingegangen war. Und so ist die deutsche bildende Kunst außerhalb der Musik — seit 1800 — eine verspätete Erscheinung, hastig, ängstlich, verworren, um Mittel und Ziel verlegen. Es war keine Zeit zu verlieren. Was die deutsche Musik und die französische Malerei in Jahrhunderten geworden waren, sollte durch eine oder zwei Malergenerationen eingeholt werden. Die erlöschende Kunst drängte nach der letzten, weltstädtischen Fassung, die ein traumhaftes Durchfliegen der ganzen Vergangenheit notwendig machte. So erscheinen hier wunderlich faustische Naturen, wie Marées und Böcklin, von einer Ungewißheit in allem Formalen, die in unsrer Musik mit ihrer sicheren Tradition — man denke an Bruckner — ganz unmöglich war. Die programmatisch klare und innerlich um so ärmere Kunst der großen französischen Impressionisten — Manet, Monet, Degas, Pissarro, Renoir — kennt diese Tragik ebensowenig. Das gleiche gilt von der deutschen Literatur, die zur Goethezeit in jedem großen Werk etwas begründen wollte und etwas abschließen mußte. Wie die Maler nach Paris gingen, so die Dichter nach dem London der elisabethanischen Zeit. Wie Kleist Shakespeare und Stendhal zugleich in sich fühlte und mit verzweifeltem Bemühen, in ewigem Ungenügen ändernd und zerstörend zweihundert Jahre psychologischer Kunst zur Einheit schmieden wollte, wie Hebbel die Problematik von Hamlet bis Rosmersholm in einen dramatischen Typus preßte, so haben Menzel, Leibl, Marées die alten und neuen Vorbilder: Rembrandt, Lorrain, van Goyen, Watteau, Delacroix, Courbet und Manet in eine einzige Form zu drängen versucht. Während die kleinen frühen Interieurs von Menzel die besten Tatsachen des Manetkreises vorwegnehmen und Leibl[S. 393] manches ausführt, woran Courbet scheiterte, ist andrerseits in ihren Bildern das metaphysische Braun und Grün der alten Meister noch der volle Ausdruck eines inneren Erlebnisses. Menzel hat wirklich ein Stück preußisches Rokoko, Marées etwas von Rubens, Leibl in seinem Bild der Frau Gedon etwas von Rembrandts Porträtkunst nacherlebt und wiedergeweckt. Das Atelierbraun des 17. Jahrhunderts hatte eine Kunst von höchstem faustischem Gehalt zur Seite gehabt, die Radierung. Rembrandt ist in beidem der erste Meister aller Zeiten gewesen. Auch die Radierung hat etwas Protestantisches und sie liegt den südlicheren, katholischen Malern der grünblauen Atmosphäre und der Gobelins nicht. Leibl war, wie der letzte Braunmaler, so auch der letzte große Radierer, dessen Blätter von jener rembrandthaften Unendlichkeit sind, die den Betrachter immer wieder neue Geheimnisse entdecken läßt. Marées endlich besaß die mächtige Intuition des großen Barockstils, die Guéricault und Daumier noch eben in eine geschlossene Form bannen konnten, die sich aber in seinem Falle, eben ohne die Stärke der westlichen Tradition, nicht in die Welt der malerischen Erscheinung zwingen ließ.
Im Tristan stirbt die letzte der faustischen Künste. Dies Werk ist der riesenhafte Schlußstein der abendländischen Musik. Die Malerei hat es nicht zu einem so mächtigen Finale gebracht. Manet und Leibl, in deren Freiheitsstudien die Ölmalerei alten Stils noch einmal wie aus dem Grabe hervorkommt, wirken klein dagegen.
Die apollinische Kunst ging mit der pergamenischen Plastik zu Ende. Pergamon ist das Seitenstück von Bayreuth. In der Illusionsmalerei der asiatischen und sikyonischen Schule erscheint daneben ebenfalls eine malerische Episode, die der von Barbizon und dem Kreise Manets durchaus entspricht. Die strenge Vierfarbentechnik Polygnots mit ihrer Vermeidung von Licht und Schatten wurde damals aus demselben metaphysischen Grunde aufgelöst wie jetzt das Braun der niederländischen Malerei. Es gibt von Eupompos Aussprüche, die auch in Paris möglich gewesen wären. Dieselben Skandale, welche das 19. Jahrhundert[S. 394] im Leben Manets, Cézannes und manches andern verzeichnet, wurden auch von diesen revolutionären Malern in Athen erregt. Plato hat sie streng getadelt.
Die pergamenische Kunst entspricht der Musik von Berlioz, Liszt und Wagner. Der berühmte Altar von Pergamon selbst ist ein späteres und vielleicht nicht das bedeutendste Werk der Gattung. Man muß (etwa 330–220) eine lange, verschollene Entwicklung voraussetzen. Aber alles, was Nietzsche gegen Wagner und Bayreuth, den Ring und den Parsifal vorbrachte, läßt sich, unter Gebrauch ganz derselben Ausdrücke wie Decadence und Schauspielerei, auf diese Plastik anwenden, von der uns im Gigantenfries des großen Altars — auch einem „Ring“ — ein Meisterwerk erhalten ist. Dieselbe Theatralik, dieselbe Anlehnung an alte, mythische, nicht mehr geglaubte Motive, dieselbe rücksichtslose Massenwirkung auf die Nerven, aber auch dieselbe sehr bewußte Wucht, Größe, Erhabenheit, die dennoch einen Mangel an innerer Kraft nicht ganz zu verbergen weiß. Das ältere Vorbild des Laokoon stammte sicherlich aus diesem Kreise. Man könnte sich einen Philosophen, aus der Nähe Epikurs, denken, der in attischen Aphorismen gegen diese Kunst im Namen der alten, echten Plastik Polyklets loszog. Hier stand Nietzsche ganz nahe vor der Lösung des Problems, das seine eigentliche Bestimmung zu sein schien, des Problems der Zivilisation. Der „Fall Wagner“ war auch der Fall der damaligen antiken Plastik, der einer jeden Kunst, welche die vollendete Kultur repräsentiert und mit dem Übergang zur Zivilisation stirbt. Er gebrauchte das Wort Decadence. Dasselbe, nur umfassender, nur von dem heute vorliegenden Fall zu einem allgemein historischen Typus von Epoche erweitert und aus der Vogelperspektive einer Philosophie des Werdens betrachtet, bedeutet in diesem Buche das Wort Untergang des Abendlandes.
Was die sinkende Gestaltungskraft kennzeichnet, ist das Form- und Maßlose, dessen der Künstler bedarf, um noch etwas Rundes und Ganzes hervorzubringen. Maßlos, überschwellend, subjektiv, das heißt hier die Kultur, die strenge Konvention von Jahrhunderten zerbrechend. Es war die überpersönliche Regel, die absolute Mathematik der Form, das Schicksal einer[S. 395] Form, hier wie dort, was man nicht mehr ertrug. Lysipp steht darin hinter Polyklet und die Schöpfer der Galliergruppen hinter Lysipp zurück. Das entspricht dem Wege von Bach über Beethoven zu Wagner. Die frühen Künstler fühlen sich als Meister der großen Form, die späten als deren Sklaven. Was Praxiteles und Haydn innerhalb der strengsten Konvention in vollkommener Freiheit und Heiterkeit zu sagen vermochten, brachten Lysipp und Beethoven nur unter Vergewaltigungen zustande. Das Zeichen aller lebendigen Kunst, die reine Harmonie zwischen Wollen, Müssen und Können, das Selbstverständliche des Ziels, das Unbewußte in der Verwirklichung, die Einheit von Kunst und Kultur, alles das ist vorüber. Noch Corot und Tiepolo, noch Mozart und Cimarosa konnten, was sie wollten, was sie wollen mußten. Freiheit und Notwendigkeit waren identisch. In der Zeit Rembrandts und Bachs ist das uns allzubekannte Phänomen: „an seiner Aufgabe zu scheitern“, gar nicht denkbar. Das Schicksal der Form lag in der Rasse, in der Epoche, nicht in privaten Tendenzen des Einzelnen. In der Sphäre einer großen Tradition gelingt selbst dem kleinen Künstler das Vollkommene, weil die lebendige Kunst ihn und die Aufgabe zusammenführt. Heute müssen diese Künstler wollen, was sie nicht mehr können, und dort mit dem Kunstverstand arbeiten, rechnen, kombinieren, wo der Instinkt erloschen ist. Das haben sie alle erlebt. Marées ist mit keinem seiner großen Pläne fertig geworden. Leibl wagte es nicht, seine letzten Bilder aus der Hand zu geben, bis sie unter der endlosen Überarbeitung kalt und hart geworden waren. Cézanne und Renoir ließen vieles vom Besten unvollendet, weil sie bei aller Kraft und Mühe nicht weiter konnten. Manet war erschöpft, als er dreißig Bilder gemalt hatte, und trotz der ungeheuren Mühsal, die aus jedem Zuge des Gemäldes und der Skizzen spricht, hat er mit seiner „Erschießung des Kaisers Maximilian“ kaum erreicht, was Goya in dem Vorbilde, der Erschießung des Grafen Pio, mühelos zustande brachte. Bach, Haydn, Mozart und die tausend namenlosen Musiker des 18. Jahrhunderts konnten in schnell hingeworfenen Augenblickskompositionen Vollkommenstes leisten. Wagner wußte, daß er nur dort die Höhe erreichte, wo er seine ganze Energie zusammennahm und aufs[S. 396] peinlichste die besten Augenblicke seiner künstlerischen Begabung ausnützte.
Zwischen Wagner und Manet besteht eine tiefe Verwandtschaft, die wenigen fühlbar sein wird, die aber ein Kenner alles Dekadenten wie Baudelaire schon früh herausfand. Aus farbigen Strichen und Flecken eine Welt im Raume hervorzuzaubern, das war die letzte, sublimste Kunst der Impressionisten. Wagner leistet das mit drei Takten, in denen sich eine ganze Welt von Seele zusammendrängt. Die Farben der sternhellen Mitternacht, der ziehenden Wolken, des Herbstes, der schaurig-wehmütigen Morgenfrühe, überraschende Blicke auf sonnenbelichtete Fernen, die Weltangst, das nahe Verhängnis, das Verzagen, das verzweifelte Durchbrechen, die jähe Hoffnung, Momente, die vorher kein Musiker für erreichbar gehalten hätte, malt er in vollkommener Deutlichkeit mit ein paar Tönen eines Motivs. Hier ist der äußerste Gegensatz zur griechischen Plastik erreicht. Alles versinkt in körperlose Unendlichkeit; selbst eine linienhafte Melodie ringt sich nicht mehr aus den vagen Tonmassen los, die in seltsamem Wogen einen imaginären Raum heraufrufen. Das Motiv taucht aus dunkler und furchtbarer Tiefe auf, flüchtig von einem grellen Licht überstrahlt; plötzlich steht es in schrecklicher Nähe; es lächelt, es schmeichelt, es droht; bald ist es im Reiche der Streichinstrumente verschwunden, bald nähert es sich wieder aus endlosen Fernen, von einer einzelnen Oboe leise variiert, mit einer immer neuen Fülle seelischer Farben. Der Kenner der Funktionentheorie wird in diesen Tonräumen etwas Verwandtes mit seinen Zahlenmannigfaltigkeiten finden, in denen Gruppen transzendenter Gebilde Verwandlungen erleiden, welche die Invarianz gewisser Formelemente hervortreten lassen.
Wagner löst die Melodie auf wie Manet und sein Kreis die Grenzen der sichtbaren Gegenstände oder, um es von einer andern Seite, psychologisch, zu nehmen, sie wurden ohne das Talent dazu geboren, weil Zeichnung und Melodie, Reste des Körperhaften, von der Symbolik der Zeit nicht mehr ertragen wurden. Sie arbeiten beide mit Details, die für das Auge und Ohr von Décadents, um in Nietzsches Sprechweise zu bleiben, wundervoll sind, antieuklidisch bis zum äußersten, mit kleinen[S. 397] Motiven und Farbenspielen, deren Sättigung mit einem ganz subjektiven, eminent physiognomischen Gehalt vorher niemand für möglich gehalten hätte; sie sind beide, neben Beethoven und Delacroix, brutal, barbarisch, und verdienen den Namen des Malers und Musikers nicht, wenn man von ihnen ein Gemälde oder eine Komposition strengen Stils erwartet. Aber worin sie Meisterschaft besitzen und was für uns der letzte Genuß und der höchste Reiz innerhalb dieser Formenwelten bleibt, ist das Charakteristische in Ton, Klang und Farbe. Alles, was Nietzsche von Wagner gesagt hat, gilt auch von Manet. Man muß nur die Beziehung verstehen. Scheinbar eine Rückkehr zum Elementarischen, zur Natur gegenüber der Inhaltsmalerei und der absoluten Musik, bedeutet ihre Kunst ein Nachgeben vor der Barbarei der großen Städte, der beginnenden Auflösung, wie sie sich im Sinnlichen in einem Gemisch von Brutalität und Raffinement äußert, einen Schritt, der notwendig der letzte sein mußte. Eine künstliche Kunst ist keiner organischen Fortentwicklung fähig. Sie bezeichnet das Ende.
Daraus folgt — ein bitteres Eingeständnis —, daß es mit der abendländischen bildenden Kunst unwiderruflich zu Ende ist. Die Krisis des 19. Jahrhunderts war der Todeskampf. Die faustische Kunst stirbt, wie die antike, die ägyptische, wie jede andere an Altersschwäche, nachdem sie ihre innern Möglichkeiten verwirklicht, nachdem sie im Lebenslauf ihrer Kultur ihre Bestimmung erfüllt hat.
Was heute als Kunst betrieben wird, ist Ohnmacht und Lüge, die Musik nach Wagner so gut wie die Malerei nach Manet, Cézanne, Leibl und Menzel.
Man suche doch die großen Persönlichkeiten, welche die Behauptung, daß es noch eine Kunst von schicksalhafter Notwendigkeit gebe, rechtfertigen. Man suche nach der selbstverständlichen und notwendigen Aufgabe, die auf sie wartet. Man gehe durch alle Ausstellungen, Konzerte, Theater und man wird nur betriebsame Macher und lärmende Narren finden, die sich darin gefallen, etwas — innerlich längst als überflüssig Empfundenes — für den Markt herzurichten. Auf was für einem Niveau steht heute alles, was Kunst und Künstler heißt! In der Generalversammlung irgendeiner Aktiengesellschaft[S. 498] oder unter den Ingenieuren der erstbesten Maschinenfabrik wird man mehr Intelligenz, Geschmack, Charakter und Können bemerken als in der gesamten Malerei und Musik des gegenwärtigen Europa. Es hat immer auf einen großen Künstler hundert überflüssige gegeben, die Kunst machten. Aber solange es eine große Konvention und also eine echte Kunst gab, machten auch sie etwas Tüchtiges. Man konnte diesen Hundert ihre Existenz verzeihen, weil sie schließlich, im Ganzen der Tradition, der Boden waren, der den einen trug. Aber heute sind nur diese — Zehntausend am Werke, „um zu leben“ — wovon man die Notwendigkeit nicht einsieht — und so viel ist gewiß: man könnte heute alle Kunstanstalten schließen, ohne daß die Kunst davon irgendwie berührt würde. Wir dürfen uns nur in das Alexandria des Jahres 200 — als die Römer nach Mazedonien kamen — versetzen, um den Kunstlärm kennen zu lernen, mit dem eine weltstädtische Zivilisation sich über den Tod ihrer Kunst zu täuschen versteht. Dort, wie heute in den Weltstädten Westeuropas, eine Jagd nach den Illusionen der künstlerischen Fortentwicklung, der persönlichen Eigenart, des „neuen Stils“, der „ungeahnten Möglichkeiten“, ein theoretisches Geschwätz, eine anspruchsvolle Haltung tonangebender Künstler wie die von Akrobaten, die mit Zentnergewichten von Pappe hantieren („hodlern“), der Literat statt des Dichters, die Malerei als Kunstgewerbe. Auch Alexandria hatte seine Problemdramatiker, die man Sophokles vorzog, und seine Maler, die neue Richtungen erfanden und ihr Publikum verblüfften. Was besitzen wir heute unter dem Namen „Kunst“? Eine erlogene Musik voll von künstlichem Lärm massenhafter Instrumente, eine erlogene Malerei voller idiotischer, exotischer und Plakateffekte, eine erlogene Architektur, die auf dem Formenschatz vergangener Jahrtausende alle zehn Jahre einen neuen Stil „begründet“, in dessen Zeichen jeder tut, was er will, eine erlogene Plastik, die Assyrien, Ägypten und Mexiko bestiehlt. Und trotzdem kommt dies allein, der Geschmack von Weltleuten, als Ausdruck und Zeichen der Zeit in Betracht. Alles übrige, das demgegenüber an den alten Idealen „festhält“, ist eine bloße Angelegenheit von Provinzialen.
Die antike und ägyptische Zivilisation können uns über[S. 399] die letzten Phasen unterrichten. Die chronologischen Stufen sind folgende:
|
Abendland
|
Antike
|
Ägypten
|
|
I. Stadium der
Zivilisation.
|
||
|
1800–2000
|
350–150
|
1780–1580
|
|
„Europ. Zivilisation“
|
Hellenismus
|
Hyksoszeit
|
|
II. Stadium.
|
||
|
150 v.–1000 n. Chr.
|
1580–1350
|
|
|
Von den Gracchen bis Nerva
|
18. Dynastie
|
|
|
(Cäsar)
|
(Thutmosis III.)
|
|
|
III. Stadium.
|
||
|
100–300
|
1350–1205
|
|
|
Von Trajan bis Konstantin
|
19. Dynastie
|
|
|
(Trajan, Hadrian)
|
(Sethos I., Ramses II.)
|
|
Das überpersönliche Formgefühl, das Gefühl für den religiösen Sinn der absoluten Form ist längst zu Ende. Der heimliche Alexandrinismus der gesamten Kunst des 19. Jahrhunderts unterliegt keinem Zweifel. Statt der lebendigen Kunst wird ihre Mumie, ihre Hinterlassenschaft an fertigen Formen verwertet, gemengt, vollkommen anorganisch kombiniert. Jede Modernität hält Abwechslung für Entwicklung. Die Wiederbelebungen und Verschmelzungen alter Stile treten an die Stelle wirklichen Werdens. Auch Alexandria hatte seine präraffaelitischen Hanswurste mit Vasen, Stühlen, Bildern und Theorien, seine Symbolisten, Naturalisten und Expressionisten. In Rom gibt man sich bald gräkoasiatisch, bald gräkoägyptisch, bald archaisch, bald — nach Praxiteles — neuattisch. Das Relief der 19. Dynastie, der ägyptischen Modernität, das massenhaft, sinnlos, anorganisch Wände, Statue, Säulen überzieht, wirkt wie eine Parodie auf die tiefe Kunst des Alten Reiches. Man muß für diese Modernität in Luxor und Karnak nur Augen haben. Der ptolemäische Horustempel in Edfu endlich ist in der Leerheit willkürlich gehäufter Formen nicht mehr zu überbieten. Das ist der prahlerische und aufdringliche Stil[91] unsrer Straßen, monumentalen Plätze und Ausstellungen, obwohl wir uns erst am Anfang dieser Entwicklung befinden. Das Massenhafte muß die Tiefe, die riesenhaften[S. 400] Dimensionen die Innerlichkeit der Form ersetzen. Darin entspricht der Tempel Sethos I. in Abydos durchaus dem Forum Trajans. Die Ruinen von Luxor und Karnak, wo vor allem Ramses II. baute, bedeuten für das Ende des ägyptischen Formgefühls, das Ende der ägyptischen Seele genau das, was die Trümmer des Palatin und der Kaiserfora, das Kolosseum nicht zu vergessen, für das vollkommene Erlöschen der antiken Seele. Welche Roheit im Detail! Welche Verschwendung von unverstandenen Motiven! Was für Kapitäle! Was für sinnlose Verschmelzungen strenger alter, bedeutungsschwerer Ornamente, welche die Seele längst vergangener Zeiten symbolisieren und hier plump, negerhaft, „vornehm“, „geschmackvoll“ dekorativen Absichten geopfert werden!
Endlich erlischt selbst die Kraft, etwas anderes auch nur zu wollen. Schon der große Ramses eignete sich Bauten seiner Vorgänger an, indem er in Inschriften und Reliefszenen die Namen ausmeißeln und durch den eigenen ersetzen ließ. Es ist dasselbe Eingeständnis künstlerischer Ohnmacht, das Konstantin veranlaßte, seinen Triumphbogen in Rom mit Skulpturen zu schmücken, die von andern Bauwerken abgenommen waren. Viel früher, seit 150 v. Chr., beginnt im Bereich der antiken Kunst die Technik der Kopien nach hellenischen Meisterwerken, nicht, weil man diese noch irgend verstanden hätte, sondern weil man nicht einmal mehr unbedeutende Originale selbständig hervorzubringen verstand. Denn man bemerke wohl: diese Kopisten waren die Künstler der Zeit. Ihre Arbeiten bezeichnen das Maximum der damals vorhandenen Gestaltungskraft. In diesen Nachahmungen erschöpft sich die Ausdrucksfähigkeit spätrömischer Zeiten. Sämtliche römischen Bildnisstatuen, ob männlich oder weiblich, gehen nicht auf die Natur, sondern auf eine ganz kleine Zahl hellenischer Werke zurück, die für den Torso mehr oder weniger frei kopiert werden, während der Kopf eine virtuose, nichts weniger als tiefe Behandlung in naturalistischem, beinahe photographischem Sinne erfährt. Man gestattete sich, je nach der augenblicklichen Stilrichtung Haartracht, Kleidung und Stellung des Vorbildes zu ändern — soweit ging das „schöpferische Genie“. Die berühmte Panzerstatue des Augustus z. B. ist nach dem Doryphoros des Polyklet gearbeitet, während ihre[S. 401] Geste schon auf einer in Arkadien gefundenen Ehrensäule des Polybius vorhanden ist. So etwa verhält sich — um die ersten Vorzeichen des entsprechenden Stadiums im Abendlande zu nennen — Lenbach zu Rembrandt und Makart zu Rubens. 1500 Jahre lang, von Ahmose I. bis auf Kleopatra herab, hat der tote Ägyptizismus in derselben Weise Bildwerke auf Bildwerke gehäuft. Es war, wie wir heute endlich begreifen lernen, ein am Oberflächlichsten haftendes Nachahmen des Alten. An Stelle des Stils war der wechselnde Modegeschmack für die Wiederbelebung bald dieser, bald jener alten Stilphase getreten. Die erdrückende Masse des so Entstandenen, das man bisher vom Echten und Alten nicht zu unterscheiden wußte, ist die Ursache der monotonen Gesamtwirkung der ägyptischen Kunst. In beiden Fällen, die sich noch durch die Beispiele der indischen und chinesischen Kunst erweitern ließen, haben wir ein Bild der eigenen Zukunft, der wir unweigerlich entgegengehen.
[81] Man braucht da nur griechische Künstler neben Rubens und Rabelais zu stellen.
[82] Von dem eine seiner Geliebten klagte, qu’il puait comme une charogne. Übrigens haben gerade Musiker immer im Rufe der Unreinlichkeit gestanden.
[83] Der Apollo mit der Kithara in München wurde von Winckelmann und seiner Zeit als Muse bewundert und gepriesen. Ein Athenakopf nach Phidias in Bologna galt noch vor kurzem als der eines Feldherrn. In einer physiognomischen Kunst wie der des Barocks wären solche Irrungen völlig unmöglich.
[84] Und umgekehrt empfindet der höhere Mensch des Abendlandes eine gemalte Begattungsszene wie bei Correggio als flach und würdelos.
[85] Nichts kann das Absterben der abendländischen Kunst seit der Mitte des 19. Jahrhunderts deutlicher kennzeichnen als die alberne, massenhafte Aktmalerei; der tiefere Sinn des Aktstudiums und der Bedeutung des Motivs ist vollkommen verloren gegangen.
[86] Rubens und unter den Neueren vor allem Böcklin und Feuerbach verlieren, Goya, Daumier, in Deutschland vor allem Oldach, Wasmann, Rayski und viele andre fast vergessene Künstler aus dem Anfang des 19. Jahrhunderts gewinnen dabei. Marées tritt in die Reihe der allergrößten.
[87] Es ist dieselbe „edle Einfalt und stille Größe“, um mit deutschen Klassizisten zu reden, welche auch die romanischen Bauten von Hildesheim, Gernrode, Paulinzella, Hersfeld so antikisch wirken läßt. Gerade die Klosterruine von Paulinzella besitzt viel von dem, was Brunellesco in seinen Palasthöfen erst erreichen wollte. Aber das schöpferische Grundgefühl, das diese Bauten herausbildete, haben wir erst in unsre Vorstellung von antikem Sein übertragen und nicht etwa von dort erhalten. Ein unendlicher Friede, eine Weite des Gefühls der Ruhe in Gott, wie sie alles Florentinische auszeichnet, soweit es nicht den gotischen Trotz Verrocchios hervorkehrt, ist in keiner Weise mit der σωφροσύνη Athens verwandt.
[88] Man hat nie darauf geachtet, wie trivial das Verhältnis der wenigen Bildhauer nach ihm zum Marmor blieb. Man fühlt es erst, wenn man das tiefinnerliche Verhältnis großer Musiker zu ihren Lieblingsinstrumenten damit vergleicht. Ich erinnere an die Geschichte von Tartinis Geige, die beim Tode des Meisters zerspringt. Es gibt hundert ähnliche. Sie sind das faustische Gegenstück zum Pygmalionmythus. Es sei auch auf Hoffmanns geniale Gestalt des Kapellmeisters Kreisler aufmerksam gemacht, die ebenbürtig neben Faust, Werther und Don Juan steht. Um ihren symbolischen Rang und ihre innere Notwendigkeit zu fühlen, vergleiche man sie mit den theatralischen Malergestalten der gleichzeitigen Romantiker, die zur Idee der Malerei in keinerlei Beziehung stehen. Ein Maler kann gar nicht, und das spricht das Urteil über die Künstlerromane des 19. Jahrhunderts, das Schicksal der faustischen Kunst repräsentieren.
[89] In Renaissancewerken wirkt das Allzufertige oft genug peinlich. Wir fühlen da einen Mangel an „Unendlichkeit“. Es gibt in ihnen keine Geheimnisse und Entdeckungen.
[90] Es ist deshalb ganz unmöglich, vom Freilichtprinzip aus zu einer echt religiösen Malerei zu kommen. Das in dieser Malerei liegende Weltgefühl ist bis zu dem Grade irreligiös und nur für eine „Vernunftreligion“ gültig, daß jeder der zahlreichen, ehrlich gemeinten Versuche hohl und unwahr wirkt (Uhde, Puvis de Chavannes). Ein einziges Freilichtbild „verweltlicht“ sofort das Innere einer Kirche.
[91] Eine besonders aufdringliche Art ist das Prunken mit Schlichtheit im neuesten deutschen Stil.
[S. 403]
[S. 405]
Jeder Philosoph von Beruf ist gezwungen, ohne ernstliche Nachprüfung an das Dasein eines Objekts zu glauben, das sich in seinem Sinne verstandesmäßig behandeln läßt. Denn seine ganze geistige Existenz hängt von dieser Möglichkeit ab. Es gibt deshalb für jeden noch so skeptischen Logiker und Psychologen einen Punkt, wo die Kritik schweigt und der Glaube beginnt, wo selbst der strengste Analytiker aufhört, seine Methode — gegen sich selbst nämlich und auf die Frage der Lösbarkeit, selbst des Vorhandenseins seiner Aufgabe — anzuwenden. Den Satz: Es ist möglich, durch das Denken die Formen des Denkens festzustellen, hat Kant nicht bezweifelt, so zweifelhaft er dem Nichtphilosophen erscheinen mag. Den Satz: Es gibt eine Seele, deren Struktur wissenschaftlich zerlegbar ist; was ich durch kritische Beobachtung meiner bewußten Daseinsakte in Gestalt von psychischen Elementen, Funktionen, Komplexen isoliere, das ist meine Seele — hat noch kein Psychologe bezweifelt. Gleichwohl hätten die stärksten Zweifel sich hier einstellen sollen. Ist eine abstrakte Wissenschaft vom Seelischen überhaupt möglich? Ist, was man auf diesem Wege findet, identisch mit dem, was man sucht? Warum ist alle Psychologie, nicht als Menschenkenntnis und Lebenserfahrung, sondern als Wissenschaft genommen, von jeher die flachste und wertloseste der philosophischen Disziplinen geblieben, in ihrer jämmerlichen Leerheit ausschließlich der Jagdgrund mittelmäßiger Köpfe und unfruchtbarer Systematiker? Der Grund ist leicht zu finden. Die empirische Psychologie hat das Unglück, nicht einmal ein Objekt im Sinne wissenschaftlicher Technik zu besitzen. Ihr Suchen und Überwinden von Problemen ist ein Kampf mit Schatten und Gespenstern. Was[S. 406] ist das — Seele? Könnte der bloße Verstand eine Antwort geben, so wäre die Wissenschaft bereits überflüssig.
Keiner der tausend Psychologen unsrer Tage hat eine wirkliche Analyse oder Definition der Phänomene des Willens, der Reue, der Angst, der Eifersucht, der Laune, der künstlerischen Intuition geben können. Natürlich nicht, denn man definiert nur optisch-räumliche Einheiten und man unterscheidet nur Begriffe. Alle Feinheiten des geistigen Spiels mit begrifflichen Distinktionen, alle vermeintlichen Beobachtungen vom Zusammenhang sinnlich-körperlicher Befunde mit „innern Vorgängen“ berühren aber nichts von dem, was hier in Frage steht. Wille — das ist gar kein Begriff, sondern ein Name, ein Urwort wie Gott, ein Zeichen für etwas, dessen wir innerlich unmittelbar gewiß sind, ohne es jemals beschreiben zu können. Wir sind uns doch darüber klar — oder sollten es sein —, daß Seele mit Raum, Gegenstand, Distanz, Zahl, Grenze, Kausalität und also auch mit Begriff und System nichts zu tun hat.
Dasjenige, was hier gemeint ist, bleibt dem taghellen Geiste, dem Verstande, der empirischen Tatsachenforschung für immer unzugänglich. Nicht umsonst warnt jede Sprache mit ihren tausendfach sich verwirrenden Bezeichnungen davor, Seelisches theoretisch zergliedern, es systematisch ordnen zu wollen. Hier ist nichts zu ordnen. Logische Methoden sind Raumdinge. Wirklichkeiten sind nicht mehr Möglichkeiten. Eher ließe sich ein Thema von Beethoven mit Seziermesser oder Säure zerlegen, als die Seele durch die Mittel des abstrakten Denkens. Von der Seele kann nicht einmal sie selbst etwas „wissen“. Alles was sie weiß, ist eben, daß sie in diesem Sinne niemals etwas wissen wird. Naturerkenntnis und Menschenkenntnis haben in Ziel, Weg und Methode nichts gemeinsam. Rembrandt kann denen, die ihm innerlich verwandt sind, durch ein Selbstbildnis oder eine Landschaft etwas von seiner Seele mitteilen und Goethe gab es ein Gott zu sagen, was er leide. Man kann von gewissen Seelenregungen, die völlig unbeschreiblich sind, andern ein Gefühl durch einen Blick, ein paar Takte einer Melodie, eine kaum merkliche Bewegung vermitteln. Das ist die wahre Sprache von Seelen, die Fernstehenden unverständlich bleibt. Das Wort als Laut, als poetisches Element, kann hier die Beziehung herstellen,[S. 407] das Wort als Begriff, als Element wissenschaftlicher Prosa nie.
Das Wort Seele gibt dem höheren Menschen ein Gefühl seines innern Daseins, abgetrennt von allem Wirklichen und Gewordnen, ein sehr bestimmtes Gefühl von den geheimsten und eigensten Möglichkeiten seines Lebens, seines Schicksals, seiner Geschichte. Es ist in den Sprachen aller Kulturen von früh an ein Zeichen, in dem zusammengefaßt wird, was nicht Welt ist. Verstandesmäßig aufgefaßt, im alltäglich-rationalen Sprachgebrauch, gehört „Seele“ zu den Gegenbegriffen. Der Sinn dieses Wortes ergab sich an einer früheren Stelle. Es war gezeigt worden, wie „die Zeit“ aus dem Gefühl der Richtung des ewig bewegten Lebens, aus der innern Gewißheit eines Schicksals heraus vom reifen Geiste des Kulturmenschen als Gegenbegriff konzipiert wurde, zum Raume nämlich, als theoretisches Negativ zu einer positiven Größe, als Inkarnation dessen, was nicht Ausdehnung ist, und daß sämtliche „Eigenschaften“ der Zeit, durch deren abstrakte Analyse die Philosophen das Zeitproblem lösen zu können glauben, als Umkehrung der Eigenschaften des Baumes im Geiste allmählich fixiert und geordnet worden sind. Genau auf demselben Wege ist der Seelenbegriff — der mit dem Seelenbewußtsein des Kindes, des Urmenschen, des naiven Menschen noch in späten Zuständen nichts zu tun hat — als Umkehrung und Negativ des Weltbegriffs unter Zuhilfenahme der räumlichen Polarität „außen — innen“ und durch entsprechende Umdeutung der Attribute herauskristallisiert.
Der späte, städtische Trieb, abstrakt zu denken, alles ohne Ausnahme in die Sphäre der „Natur“ des Ausgedehnten, des Begriffs also zu ziehen, zwingt zu fortgesetztem Nachdenken auch über das Seelische, das Nicht-Ausgedehnte, das Nicht-Welthafte — und in jedem Moment dieses Nachdenkens taucht vor dem Geiste des Kulturmenschen ein Phantom, ein imaginäres Raumgebilde auf im Stile seiner Außenwelt, eine ätherische Vision, über deren Charakter als einer Fata Morgana er sich täuscht. Er glaubt in ihr die Struktur der Seele unmittelbar beobachten zu können. Die Worte, welche stets gewählt werden, um derlei „Erkenntnisse“ mitzuteilen, verraten alles. Da ist von[S. 408] Funktionen, Gefühlskomplexen, Triebfedern, Prozessen, Bewußtseinsschwellen, von Verlauf, Breite, Intensität, Parallelismus die Rede. Aber all diese Worte stammen aus der Vorstellungsweise der Naturwissenschaft. Das Objekt der Psychologie, mit dem sie die Seele in Händen zu haben glaubt, ist in der Tat ein Stück verkappter Physik. „Der Wille bezieht sich auf Gegenstände“ — das ist doch ein Raumbild. Bewußtes und Unbewußtes — da liegt allzu deutlich das Schema von überirdisch und unterirdisch zugrunde. In den modernen Theorien des Willens wird man die ganze Formensprache der Dynamik finden. Wir reden von Willensfunktionen und Denkfunktionen in genau demselben Sinne wie von der Funktion einer Maschine. Ein Gefühl analysieren heißt ein raumartiges Schattenbild an seiner Stelle mathematisch behandeln, es abgrenzen, teilen und messen. Jede Seelenforschung dieses Stils, sie mag sich über Gehirnanatomie noch so erhaben dünken, ist voll von mechanischen Lokalisationen und bedient sich, ohne es zu wissen, eines eingebildeten Koordinatensystems in einem eingebildeten Seelenraum. Der Psychologe merkt gar nicht, daß er den Physiker spielt. Kein Wunder, daß sein Verfahren mit den albernsten Methoden der experimentellen Psychologie so verzweifelt gut übereinstimmt. Gehirnbahnen und Assoziationsfasern entsprechen der Vorstellungsweise nach durchaus dem optischen Schema: „Willens-“ oder „Gefühlsverlauf“; sie behandeln beide verwandte, nämlich räumliche Phantome. Es ist prinzipiell kein großer Unterschied, ob ich ein psychisches Vermögen begrifflich oder eine entsprechende Region der Großhirnrinde graphisch abgrenze. Die wissenschaftliche Psychologie hat ein geschlossenes System von optischen Fiktionen herausgearbeitet und bewegt sich mit vollkommener Selbstverständlichkeit in ihm. Man prüfe jede einzelne Aussage jedes einzelnen Psychologen und man wird nur Variationen dieses Systems im Stile der jeweiligen Außenwelt finden.
Das klare Denken setzt den Geist einer Kultursprache als Medium voraus, die, vom Seelentum einer Kultur als Teil und Träger ihres Ausdrucks geschaffen,[92] nun die logische Sphäre[S. 409] bildet, innerhalb deren die abstrakten Gedanken, Begriffe, Schlüsse — Abbilder von Kausalität, Zahl, Bewegung — ihr mechanisch bestimmtes Dasein führen. Das jeweilige Bild der Seele ist also ein Etwas, das abhängig vom Geiste der zugehörigen Sprache ist. Die abendländischen — faustischen — Kultursprachen besitzen sämtlich den Begriff „Wille“ — eine Größe, die übrigens auch der Syntax all dieser Sprachen im Gegensatz zu den antiken immanent ist; sie besitzen ihn, weil das faustische Sein dies Zeichen fordert. Mithin erscheint, von der Sprache bestimmt, im wissenschaftlichen Seelenbilde aller abendländischen Psychologien die greifbare Gestalt des Willens als eines wohlumgrenzten Vermögens, das man in den einzelnen Schulen wohl verschieden bestimmt, dessen Vorhandensein an sich aber keiner Kritik unterworfen ist.
Ich behaupte also, daß die eigentliche Psychologie, weit entfernt das Wesen der Seele aufzudecken — es ist hier hinzuzufügen, daß jeder von uns, ohne es zu wissen, Psychologie dieser Art treibt, wenn er sich eigne oder fremde Seelenregungen „vorzustellen“ sucht —, zu allen Symbolen, die den Makrokosmos des Kulturmenschen ausmachen, noch eins hinzufügt. So erklärt sich die merkwürdige Tatsache, daß nie bemerkt worden ist, daß das Seelenbild, wie es dem Psychologen und überhaupt dem Menschen, der über sein Inneres nachdenkt, im buchstäblichen Sinne des Wortes vorschwebt, ein wirkliches Bild, etwas Gewordnes und Ruhendes nämlich ist, von deutlichem Raumcharakter — wie etwa der Dedekindsche Zahlenkörper und die gedankliche Impression mehrdimensionaler Zahlenmannigfaltigkeiten — kausaler Verknüpfung nicht fremd und den Prinzipien der Begrenzung (Distinktion, Disposition) unterworfen. Wie alles Vollendete, nicht sich Vollendende, stellt es einen Mechanismus an Stelle eines Organismus dar. Man vermißt[S. 410] im Bilde, was unser Lebensgefühl erfüllt und was doch gerade „Seele“ sein sollte: das Schicksalhafte, die wahllose Richtung des Daseins, das Mögliche, welches das Leben in seinem bewußten Ablauf verwirklicht. Ich glaube nicht, daß in irgend einem psychologischen System das Wort Schicksal vorkommt oder eine reiche Lebenserfahrung zu uns redet. Assoziationen, Apperzeptionen, Affekte, Triebfedern, Denken, Fühlen, Wollen — all das sind optische Größen, tote Mechanismen, deren Topographie den belanglosen Inhalt der Seelenwissenschaft bildet. Man wollte das Leben finden und traf auf eine Ornamentik. Die Seele blieb, was sie war, das was weder gedacht, noch vorgestellt werden kann, das Geheimnis, das ewig Werdende, das reine Erlebnis.
Dieser imaginäre Seelenkörper — das sei hier zum ersten Male ausgesprochen — ist niemals etwas andres als das getreue Spiegelbild der Gestalt, in welcher der gereifte Kulturmensch, der ja allein über das Seelische objektiv nachzudenken vermag, die äußere Welt auffaßt. Der Urmensch und das Kind besitzen, wie wir sahen, noch keine Welt, sondern nur eine ideell ungeordnete Masse sinnlicher Eindrücke, ein Chaos, keinen Kosmos, und darum besitzen sie auch noch kein Bild ihrer oder einer fremden Seele, sondern ebenfalls nur eine Masse undeutlicher und unbegreiflicher Bildelemente. Jede primitive Mythologie kennt außer einem Reich dämonischer Naturmächte, unter deren Namen die numina der Außenwelt in dunklen Umrissen ergriffen werden, einen genau entsprechenden Seelenglauben und Seelenkult, der das den Leib bewohnende numen zu beschwören sucht, vor allem, wenn es nach dem Tode frei geworden ist. Im Griechentum liegt dort der Ursprung des Apollinischen, hier der des Dionysischen. Die „Innenwelt“ ist eine Funktion der Außenwelt, die empirische Seele ihrer Gestalt nach das alter ego, der Reflex der empirischen Natur. Deshalb allein ist so oft von einem inneren Sinn, einem inneren Auge und Blick die Rede, eine Analogie, die viel tiefer geht, als sie eigentlich soll. Vom Erwachen des Innenlebens, jenem geheimnisvoll plötzlichen und entscheidenden Moment, der Kindheit und Jugend im Dasein jedes höheren Menschen trennt, ist oft gesprochen worden. Hier wird endlich der ganze Sinn dieses[S. 411] Icherlebnisses offenbar. Durch einen mystischen Akt sondern sich aus dem dumpfen Bewußtsein Seele und Welt als klare bildhafte Pole des Daseins, in strengem Gegensatz und zugleich in vollkommener Harmonie.
Das Tiefenerlebnis verwirklicht, schafft mit einem Schlage die ausgedehnte Welt, es ordnet mit schicksalhafter Notwendigkeit die Masse der Empfindungen (Breite) durch die lebendige Richtung (Tiefe). Dies Erlebnis ist identisch mit dem Bewußtwerden der eignen Seele. Ein Reflex des Tiefenerlebnisses liegt vor. Zur Welt gehört die Spiegelung einer Gegenwelt. Auch die empirische Seele hat ihren Raum, ihre Tiefe, ihre Weite. Ein „inneres Auge“ sieht, ein „inneres Ohr“ hört. Es gibt eine deutliche Empfindung von einer inneren Ordnung, die wie die äußere das Merkmal der Notwendigkeit trägt — hier entsteht das ethische Grundproblem von Freiheit und Notwendigkeit. Ihm liegt der Widerspruch zwischen der Seele zugrunde, die wir haben, fühlen, erleben, und der, welcher wir uns verstandesmäßig bewußt sind. Erst das Denken, die mechanisierende Erkenntnis weckt hier unlösbare Zweifel, und zwar die gleichen, welche das Bild der äußeren Historie verwirren. Materialistische Geschichtsauffassung und ethischer Determinismus beruhen auf dem gleichen Mißgriff, der dem Intellekt natürlichen Verwechslung von Schicksal und Kausalität. Was wir erkennen, ist nur das Seelenbild, gleichsam eine Landschaft im reflektierten Lichte des Tagesbewußtseins. In bedeutenden, ganz innerlichen Momenten des Lebens — in denen z. B. alle wahren lyrischen Gedichte entstehen — ist es verschwunden und der Mensch ist sich seiner Seele und seiner „Freiheit“ unmittelbar bewußt.
Und damit ergibt sich nach allem, was in diesem Buche über die Erscheinung des höheren Menschentums schon gesagt worden ist, eine ungeheure Erweiterung und Bereicherung der Seelenforschung. Alles, was von Psychologen heute gesagt und geschrieben wird — es ist nicht mehr von bloßer Wissenschaft, sondern von Menschenkenntnis im weitesten Sinne die Rede —, bezieht sich auf das gegenwärtige Stadium der abendländischen Seele, während die bisher selbstverständliche Meinung, diese Erfahrungen seien für die „menschliche Seele“ überhaupt gültig, ohne Prüfung hingenommen worden ist.
[S. 412]
Das Seelenbild ist immer nur das Bild einer ganz bestimmten Seele und kann nie etwas andres, etwas Allgemeines sein. Der Forscher mag noch so objektiv vorgehen, er wird nie aus seinem Kreise herauskommen; was er auch „erkennen“ möge, jeder dieser Erkenntnisakte ist bereits ein Ausdruck seiner Seele und sein ganzes Wissen von ihr ein Zeugnis seines — faustischen, magischen oder apollinischen — Daseins. Glaubt er antike, indische, arabische Seelenregungen zu erkennen, nicht an ihren Wirkungen, sondern an sich selbst, so sieht er sie durch das Medium der eignen, in Gestalt der eignen; er assimiliert sie einem vorhandnen Bilde und es ist kein Wunder, daß er dann überall ein und dieselben Formen zu finden glaubt.
In der Tat gibt es keine allgemein menschliche Gestalt der Seele, so wenig es — das war früher nachgewiesen worden — eine einzige, im Lauf der Weltgeschichte sich entwickelnde Mathematik gibt. Wir finden so viele Mathematiken, Logiken, Physiken, als es große Kulturen gibt. Jede von ihnen, das heißt jedes Zahlenbild, Denkbild, Naturbild ist Ausdruck einer einzelnen Kultur und dem organischen Dasein, der Gestalt, Lebensdauer und Entfaltung nach von dieser bestimmt. Dasselbe gilt vom Seelenbilde, dem einzigen Seelenelement, wovon wir — wie von der Natur — Erfahrung haben können. Es ist eine Illusion, anzunehmen, daß eine Struktur dieses, ich möchte sagen Oberflächlich-Seelischen vorhanden sei, die für alle Menschen gilt. Jede Kultur, jede Epoche einer Kultur sogar schuf ihr eignes Seelenbild, in dem sie dann allerdings das der Menschheit zu erblicken glaubte. Seine Züge sind der symbolische Ausdruck dessen, was ich die Idee des Daseins genannt hatte. Der faustische Mensch mit seinem leidenschaftlichen Hange zum Grenzenlosen und Ewigen befindet sich in einem steten Widerspruch gegen die sinnlichen Vordergründe des Daseins, die er zu überwinden sucht, um den Sinn seiner Existenz, ihre Bestimmung zu erfüllen. Im empirischen Bilde seiner Seele erscheint deshalb ein Symbol, das diese Seite unsres Lebensgefühls repräsentiert. Wir sprechen vom menschlichen Willen wie von einem Wesen, empfinden ihn als ein an sich selbst existierendes Etwas und sind überzeugt, daß er in jeder Menschenseele zu finden sei. Die Griechen fanden ihn aber dort nicht.[S. 413] Obwohl gute Menschenkenner, lassen sie in ihrer Psychologie jede Andeutung davon vermissen. Ihr Lebensgefühl, ihre Art zu sein, forderte andre Symbole im Seelenbilde.
Eine wissenschaftliche Psychologie, selbst auf der Höhe einer Zivilisation, tut dasselbe wie der Urmensch, nur geistiger, nur klarer, nur bedeutsamer. Wir sahen, wie alle frühe Kunst hinsichtlich ihrer ornamentalen Formensprache eine Beschwörung des Fremden, der Dämonen war, wie sie das Gewordne „tabu“ zu machen sucht, indem sie es in eine Gestalt, Ausdruck und Abbild des eignen Seins, bannt. Auch der Psycholog — und hier ahnt man, weshalb jeder Kulturmensch das tiefe Bedürfnis hat, es zu sein — beschwört das „Seelchen“; er macht es tabu wie der primitive Mensch, nicht durch elementare, sondern durch geistige Formen, nicht durch Riten und Fetische, sondern durch Vorstellungen und begriffliche Distinktionen. Das ist seine Art, sich gegen das Unheimliche und Unergründliche zu wehren, das im Seelischen schläft. Alle theoretische Psychologie ist ein Namenzauber, eine Sublimation desselben Aktes, durch den der Wilde seinen Feind, sei es ein Mensch oder eine Gottheit, in seine Gewalt bringt. Das Seelenbild, vermeintlich ein untrügliches Resultat objektiven Denkens, ist ein Stück später Mythologie; es gehört zu den Schöpfungen, gegen welche der Spruch sich richtet: Du sollst dir kein Bildnis noch irgend ein Gleichnis machen.
So ergibt sich eine neue Stellung und Richtung der Seelenforschung. Ich komme auf die Unterscheidung der beiden Welten zurück, die dem höheren Menschen möglich sind: Natur und Geschichte. Im Hinblick auf die morphologische Betrachtung entspricht ihnen der Gegensatz von Systematik und Physiognomik. Die alte, systematische Psychologie betrachtete das Seelenbild wie ein Stück Natur, gesetzlich ein für allemal fixiert, zeitlos als das, was ist, und sie wurde so zu einer Art Topographie, die räumlich und kausal geordnete Einzelheiten festzustellen versuchte; die neue wird es als ein sich beständig wandelndes historisches Phänomen betrachten, und zwar jedes einzelne der bisher erschienenen Seelenbilder hinsichtlich dessen, was es bedeutet. Physiognomik treiben — das heißt die jeweilige menschliche Erscheinung als symbolischen Ausdruck[S. 414] eines inneren Seins auffassen. Zu dieser Erscheinung gehören aber nicht nur Gesichtszüge, Haltung, Geste, Tracht, sondern auch die Idee einer Zahl, das Bild der Natur und ihm genau entsprechend das Bild der Seele, wie es der Mensch einer Kultur mit wahlloser Notwendigkeit besitzt.
Nach allem wird man über die hohe Bedeutung der einzelnen, in der Weltgeschichte auftauchenden Seelenbilder nicht mehr im Zweifel sein. Der antike — apollinische, dem punktförmigen, euklidischen Sein hingegebene — Mensch blickte auf seine Seele wie auf einen zur Gruppe schöner Teile geordneten Kosmos. Plato nannte sie νοῦς, θυμός, ἐπιθυμία und verglich sie mit Mensch, Tier und Pflanze, einmal sogar mit dem südlichen, nördlichen und hellenischen Menschen. Was hier nachgebildet ist, ist die Natur, wie sie sich vor den Blicken antiker Menschen entfaltet: eine wohlgeordnete Summe greifbarer Dinge, denen gegenüber der Raum als das Nichtseiende empfunden wird. Wo findet sich in diesem Bilde der „Wille“? Wo die Vorstellung funktionaler Zusammenhänge? Wo sind die übrigen Schöpfungen unserer Psychologie? Glaubt man, daß Plato und Aristoteles sich auf die Analyse schlechter verstanden haben und etwas nicht sahen, was sich uns geradezu aufdrängt? Oder fehlt hier der Wille, wie in der antiken Mathematik der Raum, in der Physik die Kraft fehlt?
Dagegen nehme man unter den abendländischen Psychologien, welche man will. Man wird immer eine funktionale, keine stereometrische Analyse finden; y = f(x): das ist die Urgestalt aller Eindrücke, die wir von unserm Innern empfangen. Denken, Fühlen, Wollen — aus dieser Dreiheit kommt kein westeuropäischer Psychologe heraus, so gern er möchte — sind nicht Teile eines körperhaften Ganzen, sondern transzendente Beziehungskomplexe, Funktionszentren. Assoziationen, Apperzeptionen, Willensvorgänge und wie die Bildelemente sonst heißen mögen, sind ohne Ausnahme vom Typus mathematischer Funktionen und der Form nach gänzlich unantik.
Das faustische und das apollinische Seelenbild stehen einander schroff gegenüber. Alle früheren Gegensätze tauchen wieder auf. Man darf die imaginäre Einheit, auf welche psychologische Überlegungen sich beziehen, hier als Seelenkörper,[S. 415] dort als Seelenraum bezeichnen. Der Körper besitzt Teile, im Raum verlaufen Prozesse. Der antike Mensch empfindet seine Psyche plastisch. So weilt sie im Hades, schattenhaft, aber ein wohl erkennbares Abbild des Körpers. So sieht sie auch der Philosoph. Ihre drei schön geordneten Teile — λογιστικόν, ἐπιθυμητικόν, θυμοειδές — erinnern an die Gruppe des Laokoon. Wir stehen unter einer musikalischen Imagination; die Sonate des innern Lebens hat den Willen als Hauptthema; Denken und Fühlen sind die Nebenthemen; der Satz unterliegt den strengen Regeln eines seelischen Kontrapunkts, die zu finden Aufgabe der Psychologie ist. Die einfachsten Elemente unterscheiden sich wie antike und abendländische Zahlen: dort sind sie Größen, hier Beziehungen. Der seelischen Statik des apollinischen Daseins — dem stereometrischen Ideal der σωφροσύνη und ἀταραξία — steht die Seelendynamik des faustischen — des tätigen Lebens — gegenüber.
Deshalb besaß der hellenische Mensch nicht jenes faustische Gedächtnis, jenes historische Grundgefühl, in dem die gesamte innere Vergangenheit stets gegenwärtig ist und den Augenblick in eine werdende Unendlichkeit taucht. Dies Gedächtnis, die Grundlage aller Selbstbetrachtung, Sorge und Pietät gegen die eigne Geschichte, entspricht dem Seelenraum mit seinen unendlichen Perspektiven. Auch dieser innere Raum ist für den echten Hellenen τὸ μὴ ὄν; er lebt punktförmig, völlig im Jetzt aufgehend; seine Erinnerungen sind eine Anzahl zufällig behaltener Daten, nicht mehr, vor allem nichts, was auf die Gegenwart noch wirken könnte. In keiner griechischen Tragödie spielt das Innenleben eine Rolle, wie es im Othello, im König Lear, im Tasso der Fall ist. Der Stil der griechischen Seele ist anekdotisch-mythisch, der der nordischen genetisch-historisch. Das ist der Unterschied zwischen psychischer Plastik und Musik.
Das apollinische Seelenbild — Platos Zweigespann mit dem νοῦς als Lenker — verflüchtigt sich sofort mit der Annäherung an das magische Seelentum der arabischen Kultur. Es verblaßt schon in der späteren Stoa, deren Schulhäupter vorwiegend Semiten waren. In der früheren Kaiserzeit ist es selbst in der stadtrömischen Literatur nur als Reminiszenz anzutreffen.
[S. 416]
Das magische Seelenbild trägt die Züge eines strengen Dualismus zweier rätselhafter Substanzen, Geist und Seele. Zwischen ihnen herrscht weder das antike, statische, noch das abendländische, funktionale Verhältnis, sondern wieder ein völlig anders gestaltetes, das sich eben nur als magisch bezeichnen läßt. Man denke im Gegensatz zur Physik Demokrits und zu der Galileis an die Alchymie und den Stein der Weisen. Dies spezifisch morgenländische Seelenbild liegt mit innerer Notwendigkeit allen psychologischen, vor allem auch theologischen Betrachtungen zugrunde, welche die „gotische“ Frühzeit der arabischen Kultur (0–300) erfüllen. Das Johannesevangelium zählt nicht weniger dazu wie die Schriften der Gnostiker und Kirchenväter und die sich ganz religiös äußernde Altersstimmung des Imperium Romanum, die das wenige Lebendige in ihrem Philosophieren dem jungen Orient, Syrien und Alexandria, entnahm. Schon der große Poseidonios, trotz der antiken Außenseite seines ungeheuren Wissens ein echter Semit und von früharabischem Geiste, empfand im innerlichsten Gegensatz zum apollinischen Lebensgefühl diese magische Struktur der Seele als die wahre. Ein den Körper belebendes Prinzip befindet sich in deutlichem Wertunterschiede gegen ein andres, das abstrakte, göttliche πνεῦμα, das allein die Anschauung Gottes gestattet. Dieser „Geist“ ist es, der die höhere Welt hervorruft, durch deren Erzeugung er über das bloße Leben, die vitale Seele, die Natur triumphiert. Es ist dies das Urbild, das, bald religiös, bald philosophisch, bald künstlerisch gefaßt — ich erinnere an das Porträt der konstantinischen Zeit mit den starr ins Unendliche blickenden Augen; dieser Blick repräsentiert das πνεῦμα —, allem Ichgefühl zugrunde liegt. Plotin und Origines haben so empfunden. Paulus unterscheidet (z. B. 1. Kor. 15, 44) zwischen σῶμα ψυχικόν und σῶμα πνευματικόν. Der Gnosis war die Vorstellung einer doppelten, leiblichen oder geistigen Ekstase und die Einteilung der Menschen in niedere und höhere, Psychiker und Pneumatiker, geläufig. Plutarch hat die in der spätantiken Literatur verbreitete Psychologie, den Dualismus von νοῦς und ψυχή, orientalischen Vorbildern nachgeschrieben. Man setzte ihn alsbald zu dem Gegensatz von christlich und heidnisch, Geist und Natur in Beziehung, aus dem[S. 417] dann das noch heute nicht überwundene Schema der Weltgeschichte, die Einteilung in Altertum, Mittelalter und die erst von der abendländischen Wissenschaft hinzugefügte, immer wieder hinausgeschobene Neuzeit damals hervorgegangen ist.
Seine streng wissenschaftliche Vollendung erfährt das magische Seelenbild in den Schulen von Bagdad und Basra. Alfarabi und Alkindi haben die verwickelten und uns wenig zugänglichen Probleme dieser magischen Psychologie eingehend behandelt. Ihr Einfluß auf die junge Seelenlehre (weniger das Ichgefühl) des Abendlandes darf nicht unterschätzt werden. Scholastische und mystische Psychologie haben von Bagdad denselben Einfluß empfangen wie die gotische Kunst. Man vergesse nicht, daß das Arabertum die Kultur der gestifteten Offenbarungsreligionen ist. In ihrer Frühzeit rief sie das Christentum, den Neuplatonismus und den Manichäismus, drei magische Systeme, ins Leben, gar nicht zu reden von den vermeintlich spätantiken Kulten; in ihrer Spätzeit den Islam und, was gleichfalls bisher kaum bemerkt worden ist, die religiöse Fassung des heutigen Judentums, das seine Verwandtschaft mit maurischem Geiste nirgends verleugnet. Man denke an die Kabbala und den Anteil jüdischer Philosophen an der sogenannten Philosophie des Mittelalters, d. h. zuerst des späten Arabertums und dann der frühen Gotik. Ich nenne nur ein merkwürdiges, völlig unbeachtet gebliebenes Beispiel: Spinoza. Aus dem Ghetto stammend ist er, neben seinem Zeitgenossen Schirazi, der letzte verspätete Vertreter des magischen und ein Fremder in der Formenwelt des faustischen Weltgefühls. Er hat als kluger Schüler der Barockzeit seinem System die Farbe abendländischen Denkens zu geben gewußt; in der Tiefe steht er völlig unter dem Aspekt des arabischen Dualismus zweier Seelensubstanzen. Dies ist der wahre, innere Grund, weshalb ihm der Kraftbegriff Galileis und Descartes’ fehlt. Dieser Begriff ist der Schwerpunkt eines dynamischen Universums und damit dem magischen Weltgefühl fremd. Zwischen der Idee vom Stein der Weisen — die in Spinozas Idee der Gottheit als causa sui versteckt liegt — und der kausalen Notwendigkeit unsres Naturbildes gibt es keine Vermittlung. Deshalb ist sein Willensdeterminismus genau der, welcher von der Orthodoxie in Bagdad verteidigt wurde[S. 418] — „Kismet“ — und dort hat man die Heimat des Verfahrens „more geometrico“ zu suchen, das in seiner Ethik innerhalb unsrer Philosophie ein groteskes Unikum bildet.
Noch einmal hat dann die deutsche Romantik dies magische Seelenbild flüchtig heraufbeschworen. Man fand an Magie und Astrologie ebenso wie an der Schwärmerei für maurische Kunst und neuplatonische Visionen Gefallen, ohne von diesen entlegenen Dingen eben viel zu verstehen. Schelling und sein Kreis gefielen sich in unfruchtbaren Spekulationen in arabisch-jüdischem Stil, die man mit deutlichem Behagen als dunkel, als „tief“ empfand, was sie für die Orientalen nicht gewesen waren, die man wohl zum Teil selbst nicht begriff und von denen man hoffte, daß sie auch vom Hörer nicht begriffen werden würden. Bemerkenswert ist an dieser Episode nur der Reiz des Dunklen, den diese Gedankenkreise ausübten. Man darf den Schluß wagen, daß die klarsten und zugänglichsten Fassungen faustischer Gedanken, wie man sie etwa bei Descartes und in den Prolegomena von Kant findet, auf einen arabischen Metaphysiker denselben Eindruck des Nebelhaften und Abstrusen gemacht haben würden. Was für uns wahr ist, ist für sie falsch und umgekehrt: das gilt vom Seelenbilde der einzelnen Kulturen wie von jedem andern Resultat wissenschaftlichen Nachdenkens.
Die Kultur — ein Urphänomen im goetheschen Sinne — war als Verwirklichung des seelisch Möglichen bezeichnet worden. Die junge, ertagende, die gotische und dorische Seele ahnt nur die Gestalt ihres Seins; sie sucht nach Ausdruck; sie möchte sich und alles andere begreifen; sie sehnt sich hinaus zur Klarheit des späten Zustandes. Die Außenwelt liegt noch in derselben Ungewissen Dämmerung wie die innere. In diesem Stadium beginnt die Klärung des Seelenbildes, von dem gezeigt worden war, daß es in jedem Augenblick das Abbild und Komplement des Naturbildes ist. Die Zukunft wird sich an die schwierige Aufgabe wagen müssen, in dem krausen Wust der Philosophie gotischen Stiles, der Scholastik und Mystik, die gleiche Sonderung der letzten Elemente vorzunehmen wie in der Ornamentik der[S. 419] Kathedralen und in der primitiven damaligen Malerei, die zwischen dem flachen Goldgrund und weiträumigen landschaftlichen Hintergründen — der magischen und der faustischen Art, Gott in der Natur zu sehen — noch keine Entscheidung zu treffen wagt. Es vermischen sich im frühen Seelenbilde, wie es in dieser Philosophie zum Vorschein kommt, in zaghafter Unreife die Züge christlich-arabischer Metaphysik, des Dualismus von Geist und Seele, mit nordischen Ahnungen von funktionalen Seelenkräften, die man sich noch nicht eingesteht. Dieser Zwiespalt liegt dem Streit um den Primat des Willens oder der Vernunft zugrunde, dem Grundproblem der gotischen Philosophie, das man bald im alten arabischen, bald im neuen abendländischen Sinne zu lösen sucht. Man kann die frühe Philosophie Westeuropas, ihren Kern, nur aus diesem großen Zusammenhange begreifen. Es ist dasselbe Thema, das in stets sich ändernder Fassung den Gang unserer gesamten Philosophie bestimmt und diese von jeder anderen scharf unterscheidet. Schopenhauer, ihr letzter großer Systematiker, hat es auf die Formel „Die Welt als Wille und Vorstellung“ gebracht und seine Ethik ist es, die gegen den Willen entscheidet.
Hier tritt der geheimste Grund und Sinn alles Philosophierens innerhalb einer Kultur unmittelbar zutage. Denn es ist die faustische Seele, die in vielhundertjährigem Mühen ein visionäres Bild von sich zu formen versucht, ein Bild, das zugleich mit dem Bilde der Welt einen tiefgefühlten Einklang aufweist. Die gotische Philosophie mit ihrem Dilemma von Vernunft und Wille ist in der Tat ein Ausdruck des Lebensgefühls jener Menschen der Kreuzzüge, der Staufenzeit und der Dombauten. Man sah die Seele so, weil man so war. Und als Schopenhauer den Gegensatz noch einmal, in seiner schärfsten, zivilisierten Form hinstellte, bewies er nur, daß sich in dem, was diese faustische Seele von jeder andern unterscheidet, nichts geändert hatte.
Wollen und Denken im Seelenbilde — das ist Richtung und Ausdehnung, Historie und Natur im Bilde der äußern Welt. Daß unser Ursymbol die unendliche Ausgedehntheit ist, tritt in diesen Grundzügen beider Aspekte zutage. Der Wille knüpft die Zukunft an die Gegenwart, das Denken[S. 420] — das faustische, nicht das apollinische — das Grenzenlose an das Hier. Die historische Zukunft ist die werdende, der unendliche Welthorizont die gewordene Ferne: dies ist der Sinn des faustischen Tiefenerlebnisses. Das Richtungsgefühl wird als „Wille“, das Raumgefühl als „Verstand“ wesenhaft, beinahe mythisch vorgestellt: so entsteht das Bild, welches unsre Psychologen mit Notwendigkeit aus dem Innenleben abstrahieren.
Daß die faustische Kultur Willenskultur ist, ist nur ein andrer Ausdruck für ihren eminent historischen Charakter. Der Wille ist der psychische Repräsentant der „Welt als Geschichte“. Der antike Mensch ist ahistorisch, rein gegenwärtig, ohne jenes das Weltbild beherrschende, die Sinneseindrücke zum unendlichen Raum dehnende Richtungsgefühl: er ist „willenlos“. Darüber läßt die antike Schicksalsidee, das Fatum, keinen Zweifel, noch weniger der architektonische Typus der dorischen Säule und die nackte Statue mit ihrer stereotypen Maske. Folglich kann auch das apollinische Seelenbild keinen Richtungsfaktor, keinen „Willen“ also, enthalten. Neben dem Denken (νοῦς), das von den großen Philosophen sehr bezeichnend Zeus genannt wird, stehen die ahistorischen Komplexe der animalischen und vegetativen Triebe (θυμός und ἐπιθυμία), ganz somatisch, ganz ohne einen bewußten Zug und Drang zu einem Ziel. Nichts deutet auf ein Unendlichkeitsbedürfnis hin.
Um die Entwicklung des „Seelenraumes“, jener transzendenten Unendlichkeit, die unser inneres Auge überblickt und in Momenten der Reflexion durchdringt, deutlich zu machen, wüßte ich nichts Besseres als an die Reihe der Porträts von Jan van Eyck bis auf Velasquez und Rembrandt herab zu erinnern, deren Ausdruck im Gegensatz zu dem ägyptischer und byzantinischer Bildnisse mit wachsender Bestimmtheit das fühlen läßt, was die wissenschaftliche Psychologie unterdes in ein System hatte bringen wollen. Der Widerstreit von Wollen und Denken ist das geheime Thema dieser Köpfe und ihrer Physiognomik, sehr im Gegensatz zu den hellenistischen Idealbildnissen des Euripides, Plato, Demosthenes, die ein ganz anderes Ichgefühl vortragen.
Der „Wille“ ist das symbolische Etwas, welches das faustische Seelenbild von jedem andern unterscheidet. Der Wille wird sich so wenig jemals begrifflich fassen lassen wie der letzte Sinn der Worte[S. 421] Gott, Kraft, Raum. Er ist ein Urwort wie sie, das man erlebt, erfühlt, nicht erkennt. Das gesamte Dasein des abendländischen Menschen — Leben als Verwirklichung des innerlich Möglichen gedacht — steht unter seinem Aspekt. Seelenbild und Lebensgefühl gehören zusammen.
Wie man das faustische Prinzip bezeichnen will, das uns und nur uns angehört, ist gleichgültig. Name ist Schall und Rauch. Auch Raum ist ein Wort, das in tausend Nuancen im Munde des Mathematikers, Denkers, Dichters, Malers ein und dasselbe Unbeschreibliche ausdrücken möchte, das anscheinend der ganzen Menschheit angehört und in Wahrheit nur innerhalb der abendländischen Kultur die Geltung hat, die wir ihm mit innerer Notwendigkeit zuschreiben. Nicht das angebliche Vermögen „Wille“, sondern der Umstand, daß es für uns dies Wort überhaupt gibt, während die Griechen es gar nicht kannten, hat die Bedeutung eines großen Symbols. Im letzten Grunde besteht zwischen Raum und Wille kein Unterschied mehr. Den antiken Sprachen fehlt die Bezeichnung für das eine und also auch für das andere.[93] Der reine Raum des faustischen Weltbildes ist eine ganz besondere Idee, nicht bloße Extension, sondern Ausdehnung als Wirksamkeit, als Überwindung des Nur-Sinnlichen, als Spannung und Tendenz, als Wille zur Macht. Ich weiß wohl, wie unzulänglich diese Umschreibungen sind. Es ist vollständig unmöglich, durch exakte Begriffe den Unterschied[S. 422] anzugeben zwischen dem, was wir und was die Menschen der arabischen oder indischen Kultur Raum nennen und bei diesem Worte denken, empfinden, vorstellen. Daß es etwas durchaus Verschiedenes ist, beweisen die sehr verschiedenen Grundanschauungen der jeweiligen Mathematik und bildenden Kunst, vor allem die unmittelbaren Äußerungen des Lebens. Wir werden sehen, wie die Identität von Raum und Wille in den Taten des Kopernikus und Kolumbus so gut wie in denen der Hohenstaufen und Napoleons zum Ausdruck kommt — Beherrschung des Weltraums —, aber sie liegt in andrer Weise auch in den physikalischen Begriffen der Raumenergie (Energie der Lage, Spannung) und des Potentials, die man keinem Griechen hätte verständlich machen können. Raum als die Form a priori der Anschauung, die Formel, in der Kant endgültig aussprach, was die Barockphilosophie unablässig gesucht hatte — das bedeutet einen Herrschaftsanspruch der Seele über das Fremde. Das Ich regiert vermittelst der Form die Welt.[94]
Das bringt die Tiefenperspektive der Ölmalerei zum Ausdruck, die den unendlich gedachten Bildraum vom Betrachter abhängig macht, der ihn von der gewählten Entfernung aus im wörtlichen Sinne beherrscht. Es ist jener Zug in die Ferne, der zum Typus der heroischen, historisch empfundenen Landschaft im Gemälde wie im Park führt, dasselbe, was der mathematisch-physikalische Begriff des Vektors zum Ausdruck bringt. Jahrhunderte hindurch hat die Malerei leidenschaftlich nach diesem großen Symbol gestrebt, in dem alles liegt, was die Worte Raum, Wille, Kraft ausdrücken möchten. Ihm entspricht die ständige Tendenz der Metaphysik, durch Distinktionen[S. 423] wie die von Form der Erscheinung und Ding an sich, Wille und Vorstellung, Ich und Nicht-Ich, die sämtlich von rein dynamischem Gehalte sind, sehr im Gegensatz zur Lehre des Protagoras vom Menschen als dem Maß, also nicht dem Schöpfer aller Dinge, die funktionale Abhängigkeit der Dinge vom Geiste zu formulieren. Der antiken Metaphysik gilt der Mensch als Körper unter Körpern, und Erkennen ist hier eine Art von Berührung. Die optischen Theorien des Anaxagoras und Demokrit sind weit entfernt, dem Menschen eine Aktivität in der Sinneswahrnehmung zuzugestehen. Plato empfindet das Ich niemals als Mittelpunkt einer transzendenten Wirkungssphäre, wie es Kant ein inneres Bedürfnis war. Die Gefangenen in seiner berühmten Höhle sind wirklich Gefangene, Sklaven äußerer Eindrücke, nicht ihre Herren, von der allgemeinen Sonne beschienen, nicht selbst Sonnen, die das All durchleuchten.
Der physikalische Begriff der Raumenergie — die gänzlich unantike Vorstellung, daß bereits die räumliche Distanz eine Energieform, sogar die Urform aller Energie ist — denn das ist die Grundlage der Begriffe Kapazität und Intensität — beleuchtet das Verhältnis des Willens zum imaginären Seelenraum. Wir fühlen, daß beides, das dynamische Weltbild Galileis und Newtons und das dynamische Seelenbild mit dem Willen als Schwerpunkt und Beziehungszentrum, ein und dasselbe bedeuten. Sie sind beide Barockphänomene, Symbole der zur vollen Reife gelangten faustischen Kultur.
Man tut unrecht, wie es oft geschieht, die Willenspsychologie, wenn nicht für allgemein menschlich, so doch für allgemein christlich zu halten und sie aus orientalischen Theorien abzuleiten. Dieser Zusammenhang gehört lediglich der historischen Oberfläche an, und es war wiederholt darauf hingewiesen worden, daß unter dem Namen und der äußeren Form des magischen Christentums auf westeuropäischem Boden eine neue Religion entstanden ist. Aber das gleiche gilt von allen philosophischen Begriffen. Wenn arabische Psychologen, Murtada z. B., von der Möglichkeit mehrerer Willen reden, von einem Willen, der mit dem Tun zusammenhängt, von einem andern, der ihm selbständig voraufgeht, von einem Willen, der überhaupt keine Beziehung zur Tat hat, der das Wollen erst erzeugt usw., so haben[S. 424] wir offenbar ein Seelenbild vor uns, das der Struktur nach von dem faustischen gänzlich verschieden ist.
Bei Augustinus erscheint ein dem unsern entfernt verwandter Willensbegriff, und zwar in Verbindung mit einem entsprechenden Gottesbegriff. Auch dieser Zusammenhang ist von tiefer Notwendigkeit. Die Seelenelemente sind für jeden Menschen, welcher Kultur er auch angehört, die Gottheiten eines innern Kosmos. Was Zeus für den äußeren Olymp ist, das ist für den der inneren Welt, für jeden Griechen mit absoluter Deutlichkeit vorhanden, der νοῦς. Was für uns „Gott“ ist, Gott als Weltatem, als die Allkraft, als die allgegenwärtige Wirkung und Vorsehung, das ist, aus dem Weltraum in den imaginären Seelenraum zurückgespiegelt und von uns mit Notwendigkeit als wirklich vorhanden empfunden, „Wille“. Zum psychischen Dualismus der magischen Kultur, zu πνεῦμα und ψυχή, gehört mit Notwendigkeit der kosmische Gegensatz von Gott und Luzifer, dem absolut Guten und dem absolut Bösen, und man wird bemerken, daß im abendländischen Weltgefühl beide Gegensätze zugleich verblassen. In demselben Grade, wie der Wille sich als Mitte eines psychischen Monotheismus herausbildet, entschwindet die Gestalt des Teufels aus der wirklichen Welt. Der Pantheismus der äußeren Welt hat einen innern unmittelbar zur Folge und was — in welcher Bedeutung auch — das Wort „Gott“ der Natur gegenüber bezeichnen soll, das bezeichnet jedesmal das Wort Wille gegenüber der Seele: den Herrscher in seinem Reich.[95] Das Gefühl, welches der faustische Mensch, sei es Pascal oder Goethe oder Beethoven, von Gott hat, erschöpft sich in dem Ausdruck Weltwille. Der Darwinismus ist nichts anderes als eine außergewöhnlich flache Fassung dieses Gefühls. Kein Grieche würde das Wort Natur im Sinne einer absoluten und planmäßigen Aktivität so gebraucht haben, wie die moderne Biologie es tut. Der „Wille Gottes“ ist für uns ein Pleonasmus. Gott (oder „die Natur“) ist nichts als[S. 425] Wille. So gut der Gottesbegriff seit der Renaissance unmerklich mit dem Begriff des unendlichen Weltraums identisch wird und die sinnlichen, persönlichen Züge verliert — Allgegenwart und Allmacht sind beinahe mathematische Begriffe geworden —, so gut wird er zum unanschaulichen Weltwillen. Die reine Instrumentalmusik überwindet mit Bach die Malerei, als das einzige und letzte Mittel, dies Gefühl von Gott zu verdeutlichen. Der Prozeß einer symbolischen Klärung, der die Geistesgeschichte des Barock ausfüllt, offenbart sich in der dichten Folge metaphysischer Systeme, die sämtlich das Grundgefühl, welches Goethe in Verse und Bach und Beethoven in Musik brachten, in ein abstraktes System zu fassen versuchten. Giordano Bruno ist der erste, Hegel der letzte in dieser Reihe. Demgegenüber denke man an die Götter Homers. Zeus besitzt durchaus nicht die Macht über die Welt; selbst auf dem Olymp ist er — wie es das apollinische Weltgefühl fordert — primus inter pares, Körper unter Körpern. Die Notwendigkeit, die ἀνάγκη, welche das antike Denken im Kosmos statuiert, ist keineswegs von ihm abhängig. Im Gegenteil: die Götter sind ihr unterworfen. Das wird nicht ausgesprochen, aber man fühlt es bei Homer im Streit der Götter und an jener entscheidenden Stelle, wo Zeus die Schicksalswage hebt, um das Los Hektors nicht zu fällen, sondern zu erfahren. Also stellt sich die antike Seele mit ihren Teilen und Eigenschaften als ein Olymp kleiner Götter dar, die in friedlichem Einvernehmen zu halten das Ideal hellenischer Lebensführung, die σωφροσύνη und ἀταραξία ist. Mehr als ein Philosoph verrät den Zusammenhang, indem er den höchsten Seelenteil, den νοῦς, als Zeus bezeichnet. Aristoteles schreibt seiner Gottheit als einzige Funktion die θεωρία, die Beschaulichkeit zu; es ist das Ideal des Diogenes: eine zur Vollkommenheit gereifte Statik des Lebens gegenüber der ebenso vollkommenen Dynamik im Lebensideal des 18. Jahrhunderts.
Das rätselhafte Etwas, welches das Wort Wille bezeichnet, die Leidenschaft der dritten Dimension, ist also ganz eigentlich eine Schöpfung des Barock, wie die Perspektive der Ölmalerei, wie der Kraftbegriff der neuern Physik, wie die Tonwelt der reinen Instrumentalmusik. In allen Fällen hatte die Gotik vorgedeutet, was diese Jahrhunderte der Durchgeistigung zur Reife[S. 426] brachten. Halten wir hier, wo es sich um den Charakter, den Stil des faustischen Lebens im Gegensatz zu jedem andern handelt, daran fest, daß Wille, Kraft, Raum, Gott Symbole sind, struktive Prinzipien großer, einander verwandter Formenwelten, in denen dieses Sein sich zum Ausdruck bringt. Man war bisher darauf aus, hier objektive Fakta, an sich seiende, konkrete, letzte Einheiten festzustellen, die irgendwann auf dem Wege analysierender Forschung einmal völlig isoliert, „erkannt“ werden könnten. Diese Illusion der exakten Naturwissenschaft war in gleicher Weise die der Psychologie und Erkenntnistheorie. Die Einsicht, daß diese vermeintlich rein menschlichen Gegebenheiten lediglich Barockphänomene sind, Ausdrucksformen von vergänglicher Bedeutung, einige Jahrhunderte hindurch und nur für den westeuropäischen Menschen „wahr“, verändert den ganzen Sinn dieser Wissenschaften, die nicht mehr Subjekt, sondern selbst, als historische Phänomene, Objekte einer höheren Betrachtung sind.
Die Architektur des Barock begann, wie wir sahen, als Michelangelo die tektonischen Prinzipien der Renaissance, Stütze und Last, durch die dynamischen: Kraft und Masse ersetzte. Brunellescos Pazzikapelle drückt eine heitere Gelassenheit aus; die Fassade von Il Gesù ist steingewordner Wille. Man hat den neuen Stil in seiner kirchlichen Prägung Jesuitenstil genannt, vor allem nach der Vollendung, die er durch Vignola und Della Porta erfuhr, und in der Tat besteht ein innerer Zusammenhang zwischen der Gründung des Ignaz von Loyola, dessen Orden den reinen, abstrakten Willen der Kirche,[96] einer transzendenten Gemeinschaft, in vollkommen spiritueller Weise repräsentiert, dessen verborgene, ins Unendliche sich erstreckende Wirksamkeit das Seitenstück zur Analysis und zur Potentialtheorie ist, und der künstlerischen Formensprache der Epoche. Damals war es, wo die Parkanlagen jenen strengen[S. 427] Ausdruck annahmen, der in geradlinigen Buchengängen, Alleen und Durchblicken (dem point de vue) die Absicht kundgibt, auch die Natur dem Willen und seinem Symbol, der räumlichen Tiefe unterzuordnen. Der chinesisch-japanische Park kennt, der Bilderperspektive entsprechend, dies gestaltende Prinzip nicht.
Es wird nun nicht mehr als Paradoxon empfunden werden, wenn künftig vom Barockstil, ja vom Jesuitenstil in der Psychologie, Mathematik und theoretischen Physik die Rede ist. Die Formensprache der Dynamik, welche den energischen Gegensatz von Kapazität und Intensität an Stelle des somatisch-willenlosen von Stoff und Form setzt, ist allen geistigen Schöpfungen dieser Jahrhunderte gemeinsam.
Es ist nun die Frage, inwiefern der Mensch dieser Kultur selbst erfüllt, was das von ihm konzipierte Seelenbild erwarten läßt. Darf man das Thema der neuern Physik jetzt ganz allgemein als den wirkenden Raum bezeichnen, so ist damit auch die Daseinsart, der Daseinsinhalt des gleichzeitigen Menschen bestimmt. Wir, faustische Naturen, sind gewöhnt, den einzelnen hinsichtlich seiner wirkenden, nicht seiner plastisch-ruhenden Erscheinung ins Ganze unsrer Lebenserfahrungen aufzunehmen. Was der Mensch ist, ermessen wir an seiner Tätigkeit, die nach innen wie nach außen gewendet sein kann, und alle einzelnen Vorsätze, Gründe, Kräfte, Überzeugungen, Gewohnheiten werten wir durchaus nach dieser Richtung. Das Wort, in dem wir diesen Aspekt zusammenfassen, heißt Charakter. Wir sprechen von Charakterköpfen, von Charakterlandschaften; der Charakter von bewegten Ornamenten, Pinselstrichen, Architekturmotiven, von Schriftzügen, von Gleichungen und Funktionen: das sind uns geläufige Wendungen. Die Musik ist die eigentliche Kunst des Charakteristischen, was von Melodie und Instrumentation gleichmäßig gilt. Auch dies Wort bezeichnet etwas Unbeschreibliches, etwas, das die faustische Kultur aus allen andern heraushebt. Und zwar ist die tiefe Verwandtschaft des Begriffs mit dem des Willens unverkennbar: Was der Wille im Seelenbilde, ist der Charakter im Bilde des[S. 428] Lebens, wie es uns und nur uns Westeuropäern mit Selbstverständlichkeit vorschwebt.
Daß der Mensch Charakter habe, ist der Grundanspruch all unsrer ethischen Systeme, so verschieden ihre metaphysischen oder praktischen Formeln sonst sein mögen. Der Charakter — der sich im Strome der Welt bildet, das Verhältnis des Lebens zur Tat — ist eine faustische Impression, und es besteht eine sehr feine Ähnlichkeit mit dem physikalischen Weltbilde darin, daß der vektorielle Kraftbegriff mit seiner Richtungstendenz sich von dem der Bewegung trotz schärfster theoretischer Untersuchungen nicht hat isolieren lassen. Ebenso unmöglich ist die strenge Scheidung von Wille und Seele, Charakter und Leben. Wir empfinden auf der Höhe dieser Kultur, sicher seit dem 17. Jahrhundert, das Wort Leben als schlechthin gleichbedeutend mit Wollen. Ausdrücke wie Lebenskraft, Lebenswille, tätige Energie füllen als etwas Selbstverständliches unsre ethische Literatur, während sie in das Griechisch der Zeit des Perikles nicht einmal übersetzbar wären.
Man bemerkt — was der Anspruch aller Moralen auf zeitliche und räumliche Allgemeingültigkeit bisher verdeckt hat —, daß jede einzelne Kultur als einheitliches Wesen höherer Ordnung im historischen Gesamtbilde ihre eigne moralische Fassung besitzt. Es gibt so viele Moralen, als es Kulturen gibt. Nietzsche, der als erster eine Ahnung davon hatte, ist trotzdem von einer objektiven Morphologie der Moral — jenseits von Gut und Böse — weit entfernt geblieben. Er kam über Geschmacks-, bestenfalls über Nützlichkeitswertungen gegenüber der antiken, indischen, Renaissancemoral nicht hinaus. Aber gerade unserm historischen Sinne hätte das Urphänomen der Moral als solches nicht entgehen sollen. Uns ist, und zwar schon seit den Tagen Petrarkas, die Vorstellung der Menschheit als eines tätigen, kämpfenden, fortschreitenden Ganzen so notwendig, daß es uns schwer wird, einzusehen, daß dies eine ausschließlich abendländische Betrachtungsweise von vorübergehender Geltung und Lebensdauer ist. Dem antiken Geiste erscheint die Menschheit als stationäre Masse, und dem entspricht eine ganz anders geartete Moral, deren Dasein sich von der homerischen Frühzeit bis zur Kaiserzeit verfolgen läßt. Überhaupt wird man[S. 429] finden, daß dem im höchsten Grade aktiven Lebensgefühl der faustischen Kultur die chinesische, babylonische und ägyptische, dem streng passiven der Antike die indische und arabische näherstehen. Dies äußert sich, um nur ein Beispiel zu nennen, darin, daß jene Kulturen hochorganisierte Staatsformen kannten, deren politisch-soziale Akte auf die Dauer und Zukunft hin orientiert waren, diese dagegen unter dem Namen Staat politische Zufallsbildungen — wie die Polis und den Khalifat — ohne historisch-formalen Gehalt und ohne Richtungsenergie besaßen.
Wenn je ein Volk einen Kampf ums Dasein beständig vor Augen hatte, so war es das hellenische, wo alle die Städte und Städtchen einander bis zur Vernichtung bekämpften, ohne Plan, ohne Sinn, ohne Gnade, aus einem vollkommen animalischen, ahistorischen Instinkt. Aber die griechische Ethik war, trotz Heraklit, weit entfernt, den Kampf zu einem ethischen Prinzip zu machen. Die Überwindung von Widerständen ist vielmehr der typische Akt der abendländischen Seele. Aktivität, Entschlossenheit, Selbstbehauptung werden gefordert; der Kampf gegen die Eindrücke des Augenblicks, der Vordergründe des Lebens, des Nahen, Greifbaren, Euklidischen, die Durchsetzung dessen, was Allgemeinheit und Dauer hat, was Vergangenheit und Zukunft seelisch aneinanderknüpft, ist der Inhalt aller faustischen Imperative von den frühesten Tagen der Gotik, der Dombauten und Kreuzzüge, bis zu Kant und Napoleon und weit darüber hinaus zu den ungeheuren Macht- und Willensäußerungen unsrer Waffen, unsrer Verkehrsmittel und unsrer Technik. Das Carpe diem, der antike Standpunkt, ist der vollkommene Widerspruch gegen das, was Goethe, Kant, Pascal, was die Kirche wie das Freidenkertum als allein wertvoll empfanden, das tätige Sein. Auch das Prinzip der bildenden Künste Westeuropas war die Überwindung des Augenscheins zugunsten des ewigen, reinen Raumes. Man fühlt, wie nahe diese energische Ethik an die Formenwelt der aus demselben Gefühl gestalteten theoretischen Physik streift. Auch da ist es die Überwindung von Widerständen, die in Gesetze gebracht wird.[97]
[S. 430]
Wie alle Formen der Dynamik — die malerische, musikalische, physikalische, soziale, politische — unendliche Zusammenhänge zur Geltung bringen, und nicht wie die antike Physik den Einzelfall und deren Summe, sondern den typischen Fall und dessen funktionale Regel betrachten, so hat man unter Charakter das grundsätzlich Gleichbleibende in der Genesis des Lebens zu verstehen. Andernfalls spricht man von Charakterlosigkeit. Charakter ist, als Form einer bewegten Existenz, in der mit größtmöglicher Variabilität im einzelnen die höchste Konstanz im Prinzipiellen erreicht wird, das, was eine echte Biographie wie Goethes „Wahrheit und Dichtung“ überhaupt möglich macht. Plutarchs typisch antike Biographien sind demgegenüber nur chronologisch, nicht organisch-genetisch geordnete Anekdotensammlungen, und man wird zugeben, daß von Alkibiades, Perikles oder überhaupt einem rein apollinischen Menschen nur die zweite, nicht die erste Art von Biographie denkbar ist. Ihren Erlebnissen fehlt nicht die Masse, sondern die Beziehung; sie haben etwas Atomistisches. Auf das physikalische Weltbild bezogen: der Grieche hat nicht etwa vergessen, in der Summe seiner Erfahrungen allgemeine Gesetze zu suchen; er konnte sie in seinem Kosmos gar nicht finden. Denn darin besteht der Unterschied apollinischer und faustischer Lebensläufe, daß die einen ahistorisch-mythisch, die andern historisch-genetisch angelegt sind, daß die einen in jedem Augenblick ein Sein, die andern ein Werden vor Augen führen, daß im Gegensatz zum antiken Menschsein für uns Charakter und Biographie sich wie Mögliches zu Wirklichem, physikalisch ausgedrückt wie potentielle zu kinetischer Energie verhalten.
Es folgt daraus, daß charakterologische Wissenschaften,[S. 431] vor allem Physiognomik und Graphologie, innerhalb der Antike höchst mager ausgefallen sein würden. An Stelle der Handschrift, die wir nicht kennen, beweist es das antike Ornament, das gegenüber dem gotischen — man denke z. B. an den Mäander und die Akanthusranke — von einer unglaublichen Simplizität und Schwäche des charakteristischen Ausdrucks, dafür von einem nie wieder erreichten Ausgeglichensein in zeitlosem Sinne ist.
Es versteht sich von selbst, daß wir, dem antiken Weltgefühl zugewendet, dort ein Grundelement der ethischen Wertung finden müssen, das dem Charakter ebenso entgegengesetzt ist wie die Statue der Fuge, die euklidische Geometrie der Analysis, der Körper dem Raume. Es ist die Geste. Damit ist das Grundprinzip einer seelischen Statik gegeben, und das Wort, welches an Stelle unsrer „Persönlichkeit“ in den antiken Sprachen steht, heißt πρόσωπον, persona (von personare, hindurchtönen), nämlich Rolle, Maske. Im spätgriechisch-römischen Sprachgebrauch bezeichnet es die öffentliche Erscheinung und damit den eigentlichen Wesenskern des antiken Menschen. Man sagte von einem Redner, daß er als priesterliches, als soldatisches πρόσωπον spreche. Der Sklave war ἀπρόσωπος, aber nicht ἀσώματος, d. h. er hatte keine Bedeutung, aber eine „Seele“. Daß das Schicksal jemandem die Rolle eines Königs oder Feldherrn zuerteilt habe, gibt der Römer durch persona regis, imperatoris.[98] Damit verrät sich der apollinische Stil des Lebens. Es handelt sich nicht um konsequente Entfaltung innerer Möglichkeiten durch tätiges Streben, sondern um die jederzeit geschlossene Haltung und strengste Anpassung an ein sozusagen plastisches Seelenideal. Nur in der antiken Ethik spielt der Begriff Schönheit eine Rolle. Mag man dies Ideal σωφροσύνη, καλοκἀγαθία oder ἀταραξία nennen, es ist immer die wohlgeordnete Gruppe sinnlich greifbarer, durchaus öffentlich erscheinender, für die andern, nicht für das eigene Ich bestimmter[S. 432] Vorzüge. Der Akzent liegt auf dem Sein, nicht auf dem Wirken. Man war Objekt, nicht Subjekt des Lebens. Das rein Gegenwärtige, Mythisch-Zeitlose, Augenblickliche, der Vordergrund wurde nicht überwunden, sondern herausgearbeitet. Alle antiken Ethiken, nicht nur die Stoa, predigen die willenlose Passivität, die schöne Hingabe an die punktförmige Gegenwart, den Menschen als Statue. Noch einmal: Innenleben ist in diesem Zusammenhange ein unmöglicher Begriff. Das unübersetzbare, stets im westeuropäischen Sinne mißverstandene ζῷον πολιτικόν des Aristoteles bezieht sich auf Menschen, die einzeln, einsam, nichts sind, die nur als Mehrzahl etwas bedeuten — was für eine groteske Vorstellung ist ein Athener in der Rolle des Robinson! —, auf der ἀγορά, dem forum, wo jeder sich an andern spiegelt und dadurch erst eigentlich Wirklichkeit erhält. Dies alles liegt in dem Ausdruck σώματα πόλεως: die Bürger der Stadt. Man begreift, daß das Porträt, das Probestück der Barockkunst, mit der Darstellung des Menschen identisch ist, insoweit er Charakter hat, und daß andrerseits in der ionischen Periode die Darstellung des Menschen hinsichtlich seiner Attitüde, des Menschen als „persona“, mit dem Formideal der attischen Aktstudie enden mußte.
Dieser Gegensatz hat zu zwei in jedem Betrachte grundverschiedenen Formen der Tragödie geführt. Die faustische, das Charakterdrama, und die apollinische, das Drama der erhabenen Geste, haben in der Tat nicht mehr als den Namen gemeinsam.
Die Barockzeit machte, bezeichnenderweise ausschließlich von Seneka und nicht von Äschylus und Sophokles ausgehend, mit steigender Entschiedenheit an Stelle der Ereignisse den Charakter zum Schwerpunkt des Ganzen, zur Mitte gewissermaßen eines seelischen Koordinatensystems, das allen szenischen Tatsachen in bezug auf sich Lage, Bedeutung und Wert zuweist; es entsteht eine Tragik des Wollens, der wirkenden Kräfte, der innern, nicht notwendig in Sichtbares umgesetzten Bewegtheit, während Sophokles das unvermeidliche Minimum an Geschehen[S. 433] vor allem durch das Kunstmittel des Botenberichts hinter die Szene verlegt. Die antike Tragik bezieht sich auf allgemeine Fälle, nicht auf Persönlichkeiten; Aristoteles bezeichnet sie ausdrücklich als μίμησις οὐκ ἀνθρώπων ἀλλὰ πράξεως καὶ βίου. Was er in seiner Poetik, sicherlich dem für unsere Dichtung verhängnisvollsten Buche, ἦθος nennt, nämlich die ideale Haltung eines ideal hellenischen Menschen in einer schmerzlichen Lage, hat mit unserm Begriff von Charakter als einer die Farbe der Ereignisse bestimmenden Beschaffenheit des Ich so wenig zu tun, wie eine Fläche in Euklids Geometrie mit dem gleichnamigen Gebilde etwa in Riemanns Theorie der algebraischen Gleichungen. Daß man ἦθος mit Charakter übersetzte, statt das kaum exakt Wiederzugebende durch Rolle, Haltung, Geste zu umschreiben, daß man μῦθος, die zeitlose Begebenheit, durch Handlung gab, ist für Jahrhunderte ebenso verderblich geworden wie die Ableitung des Wortes δρᾶμα von Tun. Othello, Don Quijote, der Misanthrop, Werther sind Charaktere. Das Tragische liegt im bloßen Dasein so gearteter Menschen inmitten der Welt. Ob gegen diese Welt, gegen sich, gegen andre: der Kampf wird durch den Charakter, nicht durch etwas von außen Kommendes aufgezwungen. Es ist Fügung, die Einfügung einer Seele in einen Zusammenhang widersprechender Beziehungen, die keine reine Auflösung gestattet. Antike Bühnengestalten aber sind Rollen, keine Charaktere. Auf der Szene erscheinen immer dieselben Figuren, der Greis, der Heros, die Jungfrau, dieselben schwer beweglichen, auf dem Kothurn schreitenden, maskierten Puppen. Deshalb war die Maske im antiken Drama auch der Spätzeit eine innere Notwendigkeit, während wir ohne das Mienenspiel der Darsteller nicht auskommen. Man wende ja nicht die Größe der griechischen Theater ein: auch die Gelegenheitsmimen trugen Masken, und wäre das tiefere Bedürfnis nach intimen Räumen dagewesen, so hätte sich die architektonische Form von selbst gefunden.
Die in bezug auf einen Charakter tragischen Begebenheiten folgen aus einer langen innern Entwicklung. In den tragischen Fällen des Ajax, des Philoktet, der Antigone und Elektra aber ist eine innere Vorgeschichte — selbst wenn sie in einem antiken Menschen anzutreffen wäre — für die Folgen gleichgültig.[S. 434] Das entscheidende Ereignis überfällt sie, unvermittelt, ganz zufällig und äußerlich, und hätte an ihrer Stelle jeden andern und mit der gleichen Wirkung überfallen können. Es brauchte nicht einmal ein Mensch desselben Geschlechtes zu sein.
Es bezeichnet den Gegensatz antiker und westeuropäischer Tragik noch nicht scharf genug, wenn man nur von Handlung oder Ereignis redet. Die faustische Tragödie ist biographisch, die apollinische ist anekdotisch, d. h. jene umfaßt die Genesis eines ganzen Lebens, diese den für sich stehenden gegenwärtigen Augenblick; denn welche Beziehung hat die gesamte innere Vergangenheit des Ödipus oder Orest zu dem vernichtenden Ereignis? Der Anekdote antiken Stils gegenüber kennen wir den Typus der charakteristischen, antimythischen Anekdote — es ist die Novelle deren Meister Cervantes, Kleist, Hoffmann, Storm sind —, die um so bedeutender ist, je mehr man fühlt, daß ihr Motiv nur einmal und nur zu dieser Zeit und unter diesen Menschen möglich war, während der Rang der mythischen Anekdote — der Fabel — durch die Reinheit der gegenteiligen Qualitäten bestimmt wird. Wir haben da also ein Schicksal, das wie der Blitz trifft, gleichgültig wen, und ein andres, das sich wie ein unsichtbarer Faden durch ein Leben spinnt und dieses eine vor allen andern auszeichnet. Es gibt im vergangenen Dasein Othellos, dieses Meisterstücks einer psychologischen Analyse, nicht einen, nicht den geringsten Zug, der ohne Beziehung zur Katastrophe wäre. Der Rassenhaß, das Alleinstehen des Emporkömmlings unter den Patriziern, der Mohr als Soldat, als Naturmensch, als der vereinsamte ältere Mann — nichts von diesen Momenten ist ohne Bedeutung. Man versuche doch, die Exposition des Hamlet, des Lear im Vergleich zu der sophokleischer Stücke zu entwickeln. Sie ist durchaus psychologisch, nicht eine Summe äußerer Daten. Von dem, was wir heute einen Psychologen nennen, was für uns beinahe mit dem Begriff eines Dichters identisch ist, hatten die Griechen keine Ahnung. So wenig sie Analytiker in der Mathematik waren, so wenig waren sie es im Seelischen, und antiken Seelen gegenüber konnte es nicht wohl anders sein. „Psychologie“ — das ist das eigentliche Wort für die abendländische Art von Menschengestaltung. Das paßt auf ein Porträt Rembrandts so[S. 435] gut wie auf die Tristanmusik, auf Flauberts Madame Bovary wie auf Dantes Vita Nuova. Keine andre Kultur kennt Ähnliches. Gerade das ist es, was von der Gruppe antiker Künste mit Strenge ausgeschlossen wurde. Psychologie ist die Form, in welcher der Wille, der Mensch als verkörperter Wille, nicht der Mensch als σῶμα kunstfähig wird. Wer hier Euripides nennt, der weiß gar nicht, was Psychologie ist. Welche Fülle des Charakteristischen liegt schon in der nordischen Mythologie mit ihren schlauen Zwergen, tölpischen Riesen, neckischen Elben, mit Loki, Baldr und den andern Gestalten, und wie typisch allgemein wirkt daneben der Olymp. Zeus, Apollo, Poseidon sind einfach „Männer“, Hermes ist „der Jüngling“, Athene eine reifere Aphrodite, die kleineren Götter — wie auch die spätere Plastik beweist — nur dem Namen nach unterscheidbar. Das gilt im vollen Umfange auch von den Gestalten der attischen Szene. Bei Wolfram von Eschenbach, Cervantes, Shakespeare, Goethe entwickelt sich das Tragische von innen heraus, dynamisch, funktional, bei den drei großen Tragikern Athens kommt es von außen, statisch, euklidisch. Man denke an den Geschlechterfluch im Hause der Atriden. Um eine früher auf die Weltgeschichte angewandte Bezeichnung zu wiederholen: das vernichtende Ereignis macht dort Epoche, hier bewirkt es eine Episode. Selbst der tödliche Ausgang ist nur die letzte Episode eines aus lauter Zufälligkeiten zusammengesetzten Daseins.
Eine Barocktragödie ist nichts als der führende Charakter noch einmal, nur im realen Raume zur Entfaltung gebracht, als Kurve statt als Gleichung, kinetische statt potentieller Energie. Die sichtbare Person ist der mögliche, die Handlung der sich verwirklichende Charakter. Dies ist der ganze Sinn unsrer noch heute unter antiken Reminiszenzen und Mißverständnissen verschütteten Dramaturgie. Der tragische Mensch der Antike ist ein euklidischer Körper, der in seiner Lage, die er nicht gewählt hat und nicht ändern kann, von der Moira getroffen wird, der sich in der Belichtung seiner Flächen durch die äußern Vorfälle unveränderlich zeigt. Das ist die Geste, das πρόσωπον als ethisches Ideal. In diesem Sinne ist in den Choephoren von Agamemnon als dem „flottenführenden königlichen Leibe“ die Rede und sagt Ödipus in Kolonos, daß das Orakel „seinem Leibe“[S. 436] gelte. Man wird bei allen bedeutenden Menschen der griechischen Geschichte bis auf Alexander hinab eine merkwürdige Unbildsamkeit finden. Ich wüßte keinen, der in den Kämpfen des Lebens eine innere Umwandlung vollzogen hätte, wie wir sie von Luther und Ignaz von Loyola kennen. Was man allzu flüchtig bei den Griechen Charakterzeichnung nennt, die Kunst, deren Meisterstücke noch im 19. Jahrhundert die Wahlverwandtschaften und Stendhals Julian Sorel sind, ist nichts als der Reflex der Ereignisse auf das ἦθος des Helden, niemals der Reflex einer Persönlichkeit auf die Ereignisse.
Und so verstehen wir faustischen Menschen das Drama mit innerster Notwendigkeit als ein Maximum an Aktivität, die Griechen mit derselben Notwendigkeit als ein Maximum an Passivität. Die attische Tragödie enthält überhaupt keine „Handlung“. Die antiken Mysterien — und Äschylus, der aus Eleusis stammte, hat das höhere Drama durch Übertragung der Mysterienform mit ihrer Peripetie erst geschaffen — waren sämtlich δράματα, d. h. liturgische Aktionen in der Art unserer Passionen und Oratorien. Aristoteles bezeichnet die Tragödie als Nachahmung eines Geschehens. Das, die Nachahmung, ist identisch mit der vielberufenen Profanation der Mysterien, und man weiß, daß Äschylus, der auch die sakrale Tracht der Eleusispriester für immer als das Kostüm der attischen Bühne eingeführt hat, deshalb angeklagt wurde.[99] Denn das eigentliche δρᾶμα mit seiner Peripetie von der Klage zum Jubel lag gar nicht in der Fabel, die erzählt wurde, sondern in der dahinter stehenden, vom Zuschauer im tiefsten Sinne aufgefaßten und nachgefühlten Kulthandlung. Es war sicherlich gewagt, den Vorgang dieser heiligen Erschütterung mit einer Burleske zu verbinden. Der uralte Bockgesang der τράγοι, der als Böcke verkleideten, von Dorf zu Dorf ziehenden Schauspieler, hatte mit seiner Beziehung auf die wieder erwachende Zeugungskraft der Natur Gelächter erregt. Das war volksmäßig. Nun aber hebt die Kalokagathie dies künstlerische Element zu sich empor. Äschylus als der[S. 437] Vertreter des aristokratisch-homerischen Prinzips führt den zweiten Schauspieler und damit die Wechselrede ein und so wächst aus der Harlekinade, die in das Satyrspiel am Schluß zurückgedrängt wird, die eigentliche antike Tragödie empor. In ihr siegt der Geist der Plastik über den Orgiasmus, Apollo über Dionysos. Hier am Seelenfeste des Dionysos im Frühling berühren sich Leben und Tod, das Phallische und die Klage um das Vergängliche. Dionysos ist der Herr der abgeschiedenen Seelen. Auch in Eleusis war das Umschlagen der Klage um den Tod zum Jubel über die Rettung der Kore Inhalt der heiligen Messe.
Die Tragödie wuchs aus dem θρῆνος (naenia), der feierlichen Klage am Totenfeste, hervor. Aber der apollinische, plastische Geist gestaltet die ursprünglich allgemeine Klage zur besonderen. Es ist der Heros der Stadt, über dessen Leiden der Chor die große Klage anstimmt. Denn das erst hat die Tragödie vollendet: Der Klage als dem gegebenen Thema wird die Gestaltung eines großen menschlichen Leidens als Motiv unterlegt. Äschylus führt die Heldensage in seinen 70 Dramen als die Vordergrundfabel (μῦθος) der Szene ein. Der Zuschauer, der den Sinn des Tages kannte, fühlte in den pathetischen Worten sich und seine Ahnen gemeint. In ihm vollzieht sich die Peripetie, die der eigentliche Zweck der heiligen Handlung ist. Die liturgische Klage über den Jammer des Menschengeschlechts ist immer, von Berichten und Erzählungen umgeben, der Schwerpunkt des Ganzen geblieben. Man sieht es am deutlichsten im Prometheus, Agamemnon und König Ödipus. Aber hoch über die Klage hinaus erhebt sich die Größe des Dulders, seine erhabene Attitüde, sein ἦθος, das in mächtigen Szenen zwischen den Chorpartien vorgeführt wird. Nicht der heroische Täter, dessen Willenskraft, dessen Lebenstendenz am Widerstand fremder Mächte oder an den Dämonen in der eignen Brust wächst und bricht, sondern der willenlos Leidende, dessen euklidisches, somatisches Dasein — ohne tiefern Grund, wie man hinzufügen muß — zerstört wird, ist das Thema. Die Prometheustrilogie des Äschylus beginnt gerade dort, wo Goethe sie vermutlich hätte enden lassen. Der Wahnsinn Lears ist die notwendige Folge höchst komplizierter psychischer Voraussetzungen, in deren Gewebe keine Masche fehlen darf. Der Ajax des Sophokles[S. 438] wird von Athene wahnsinnig gemacht, bevor das Drama beginnt. Das ist der Unterschied zwischen einem Charakter und einer szenischen Figur. In der Tat, Furcht und Mitleid sind, wie es Aristoteles beschreibt, die notwendige Wirkung antiker Tragödien auf antike, und nur auf antike Zuschauer. Das wird sofort klar, wenn man sieht, welche Szenen von ihm als die wirksamsten bezeichnet werden — man hat das bisher übersehen —, nämlich jähe Glückswechsel und Erkennungsszenen. Zu den ersten gehört vor allem der Eindruck des φόβος (Grauen), zu den zweiten der des ἔλεος (Rührung). Der Gedanke der Katharsis ist nur aus dem streng euklidischen Seinsideal der Ataraxie nachzuerleben. Die antike „Seele“ ist reine Gegenwart, reines σῶμα, unbewegtes punktförmiges Sein. Dies in Frage gestellt zu sehen, durch den Neid der Götter, das blinde Ungefähr, das wahllos, blitzartig über jeden hereinbrechen kann, ist das furchtbarste. Es greift an die Wurzeln der antiken Existenz, während es den faustischen, alles wagenden Menschen erst lebendig werden läßt. Und nun — das sich lösen zu sehen, wie wenn Gewitterwolken sich in dunklen Bänken am Horizont lagern und die Sonne wieder durchbricht, das tiefe Gefühl der Freude an der geliebten großen Geste, das Aufatmen der gequälten mythischen Seele, die Lust am wiedergewonnenen Gleichgewicht — das ist Katharsis. Das setzt aber auch eine Psychologie voraus, die uns vollkommen fremd ist. Das Wort ist in unsre Sprachen und Empfindungen kaum zu übersetzen. Die ganze ästhetische Mühe und Willkür des Barock und des Klassizismus mit der rückhaltlosen Ehrfurcht vor antiken Büchern im Hintergrunde, war notwendig, um uns dies seelische Fundament auch für unsre Tragödie aufzureden — angesichts der Tatsache, daß ihre Wirkung gerade die entgegengesetzte ist, daß sie nicht von passiven, statischen Affekten erlöst, sondern aktive, dynamische hervorruft, reizt und auf die Spitze treibt, daß sie die Urgefühle eines energischen Menschseins, die Grausamkeit, die Freude an Spannung, Gefahr, Gewalttat, Sieg, Verbrechen, das Glücksgefühl des Überwinders und Vernichters weckt, Gefühle, die seit der Wikingerzeit, den Hohenstaufentaten und Kreuzzügen in den Tiefen der nordischen Seele schlafen. Das ist die Wirkung Shakespeares. Ein Grieche hätte den Macbeth gar nicht ausgehalten;[S. 439] er hätte vor allem den Sinn dieser mächtigen biographischen Kunst mit ihrer Richtungstendenz nicht begriffen. Daß Gestalten wie Richard III., Don Juan, Faust, Michael Kohlhaas, Golo, unantik vom Scheitel bis zur Sohle, nicht Mitleid, sondern einen tiefen seltsamen Neid, nicht Furcht, sondern eine rätselhafte Lust an Qualen, einen verzehrenden Wunsch nach einem ganz andern Mit–Leiden wecken, verraten uns heute, wie die faustische Tragödie auch in ihrer spätesten, der deutschen Form endgültig abgestorben ist, die ständigen Motive der weltstädtischen Literatur Westeuropas, die man mit den entsprechenden alexandrinischen vergleiche: In den „nervenspannenden“ Abenteurer- und Detektivgeschichten und ganz zuletzt im Kinodrama, das durchaus den spätantiken Mimus vertritt, ist ein Rest der unbändigen faustischen Überwinder- und Entdeckersehnsucht fühlbar.
Dem entspricht genau das apollinische und das faustische Bühnenbild, das zur Vollständigkeit des Kunstwerkes gehört, wie es vom Dichter gedacht worden war. Das antike Drama ist ein Stück Plastik, eine Gruppe pathetischer Szenen von reliefmäßigem Charakter, eine Schau riesenhafter Marionetten vor der flach abschließenden Rückwand des Theaters. Es ist ausschließlich groß empfundene Geste, Ethos, während die spärlichen Begebenheiten der Fabel feierlich vorgetragen, dicht vorgeführt werden. Das Gegenteil will die Technik des abendländischen Dramas: Ununterbrochene Bewegtheit und strenge Ausschaltung handlungsarmer, statischer Momente. Die berühmten drei Einheiten des Ortes, der Zeit und des Vorgangs formulieren den Typus der attischen Marmorstatue. Und unvermerkt bezeichnen sie das Lebensideal des antiken, an die Polis, die reine Gegenwart, die Geste gebundenen Menschen. Die Einheiten haben sämtlich den Sinn von Negationen: man verleugnet den Raum, man verneint Vergangenheit und Zukunft, man lehnt alle seelischen Beziehungen in die Ferne ab. Die drei Einheiten, ahistorisch, antimusikalisch, schränken die Wirklichkeit auf den Vordergrund, die unmittelbare Nähe und Gegenwart ein. Alles andre ist „τὸ μὴ ὄν“. Sie enthalten zugleich das Ideal der euklidischen, der stoischen Ethik. Ἀταραξία — in dem Worte könnte man sie zusammenfassen. Man verwechsle diese Form ja nicht mit der oberflächlich ähnlichen im Drama der romanischen[S. 440] Völker. Das spanische Theater des 16. Jahrhunderts hat sich dem Zwang antiker Regeln unterworfen, aber man begreift, daß die kastilianische Würde der Zeit Philipps II. sich davon angesprochen fühlte, ohne den ursprünglichen Geist dieser Regeln zu kennen oder auch nur kennen zu wollen. Islamisches Schicksalsgefühl vermittelte hier zwischen antikem fatum und spanischem Katholizismus, ohne daß man sich der innern Distanz bewußt geworden wäre. Tirso de Molina erneuerte die Theorie von den Einheiten, die Corneille, der kluge Zögling spanischer Grandezza, in seiner berühmten Abhandlung von ihm entlehnte. Damit begann das Verhängnis. Die florentinische Nachahmung der maßlos bewunderten antiken Plastik, die niemand in ihren letzten Bedingungen begriff, konnte nichts verderben, denn es gab damals keine nordische Plastik mehr, die hätte verdorben werden können. Aber es gab die Möglichkeit einer mächtigen, rein faustischen Tragödie von ungeahnten Formen und Kühnheiten und daß sie, so groß Shakespeare ist, niemals den Bann einer mißverstandenen Konvention ganz überwunden hat, das hat der Glaube an die Poetik des Aristoteles verschuldet. Was hätte aus dem Drama des Barock unter den Eindrücken der ritterlichen Epik, des Tristan und Parzeval, und in Nachbarschaft zu den Oratorien und Passionen der Kirche werden können, wenn man niemals etwas vom griechischen Theater gehört hätte! Eine Tragödie aus dem Geiste der kontrapunktischen Musik, ohne die Fesseln einer für sie sinnlosen plastischen Gebundenheit, eine Bühnendichtung, die sich von Orlando Lasso und Palestrina an und neben Heinrich Schütz, Bach, Händel, Gluck, Beethoven vollkommen frei zu einer eignen und reinen Form entwickelt hätte — das wäre möglich gewesen. Nur dem glücklichen Umstande, daß die gesamte hellenische Freskomalerei verloren ging, verdanken wir die Rettung, die innere Freiheit der Ölmalerei.
Unsere tragischen Konzeptionen sind von faustischem Gehalt, aber der dramatische Körper spanischen, französischen oder elisabethanischen Stils, das fünfaktige Blankversdrama z. B., ist ein Kompromiß ohne Tiefe. Was ohne die Kenntnis apollinischer Formen hätte entstehen können, läßt allein der Faust ahnen, die einzige auch im Szenischen unabhängige (wegen des Mangels an einer großen Tradition allerdings fragmentarische) Schöpfung:[S. 441] was sie zerstört haben, lehrt Racine, dessen mächtige Gestaltungskraft sich im Kampfe mit einem Schema erschöpft hat, das niemand anzutasten wagte.
Mit den drei Einheiten war es nicht genug. Das attische Drama forderte statt des Mienenspiels die starre Maske mit den wulstigen, weit geöffneten Lippen — es verbot also die seelische Charakteristik, wie man die Aufstellung ikonischer Statuen verboten hatte. Es forderte den Kothurn und die überlebensgroße, rings bis zur Unbeweglichkeit gepolsterte Figur mit dem schleppenden Gewande — und beseitigte damit die Individualität der Erscheinung. Es forderte endlich den aus einem röhrenartigen Mundstück monoton erschallenden Sprechgesang, dessen für das Ohr nicht wahrnehmbare Kadenzen für das Auge durch Senken eines Stäbchens bezeichnet wurden. Das Statuenhafte, Euklidische des Szenenbildes war damit auf die Spitze getrieben. Nichts durfte in Sprache und Erscheinung das Gefühl von Raumfernen, Seelenhorizonten und zeitlichen Perspektiven heraufrufen.
Die faustische Tragik war die Ausschweifung einer Seele, die an einem unbändigen, unersättlichen Willen litt, eine Rettung ins Poetische, welche die Griechen, die an ganz andern Dingen litten, nicht nötig hatten und nicht verstanden haben würden. Der „Neid der Götter“, der das pflanzenhaft-euklidische Sein in seiner Ruhe bedrohte, trieb sie zur Verzweiflung. „Nie geboren zu sein, nie den Tag erblickt zu haben und sein flammenhufiges Gespann“ — das ist ihre Klage, und daneben und doch wieder eins und dasselbe steht die Klage des Achilleus, der lieber der ärmste Tagelöhner sein als im Reiche der Schatten weilen möchte. Deshalb klammerten sie sich mit nie endender Angst an den Vordergrund der Dinge und schlossen die Augen vor dem Fernen, das sie das Nichtseiende nannten. Deshalb umstellte der Grieche sein Leben mit allen Symbolen der Nähe und des Körperlichen, des tatenarmen, stoischen, richtungslosen Seins. Das trieb ihn zur Geselligkeit, zum Leben eines ζῷον πολιτικόν, eines Menschen der Nähe und Mehrzahl, als dessen leibhaftes Symbol der Chor auf der Szene weilt. Nichts steht dem ferner als das Monologische der faustischen Seele, ihre[S. 442] ungeheure Einsamkeit und Verlorenheit im All, die sich durch die gesamte abendländische Kunst wie eine unendliche Melodie hinzieht. Nichts ist einsamer als ein Bildnis Rembrandts, als eine Fuge von Bach, ein Quartett von Beethoven. Wir haben das attische Drama in seiner grandiosen Einseitigkeit und Unnatur gar nicht verstanden. Der bloße Text, wie wir ihn heute lesen — nicht ohne unvermerkt den Geist Goethes und Shakespeares und unsre ganze Kraft perspektivischen Sehens hineinzutragen — kann von dem tiefern Sinn dieses Dramas nichts geben. Antike Kunstwerke sind nur für das antike Auge, und zwar das leibliche Auge geschaffen. Erst die sinnliche Form der Darstellung schließt die eigentlichen Geheimnisse auf. Ein Drama des Äschylus ist eine viel komplexere Einheit, als wir, an das einsame Studium von Lesedramen gewöhnt — und an eine „innere Bühne“ also voller schrankenloser, die reale Darstellbarkeit weit überschreitender Möglichkeiten —, meist annehmen. Der antike Mensch war Zuschauer, nicht Leser, mit dem Leibe eher dabei als mit der „Seele“, und der Verlust beinahe aller Meisterdramen des Äschylus und Sophokles beweist, wie wenig ihm das Aufgeschriebene an sich, ohne die Szene, bedeutet hat. Euripides, dessen Werke eher sozialphilosophische Traktate sind, macht eine bezeichnende Ausnahme.
Die antike Seele, die nichts ist als die verwirklichte Form des antiken Leibes — Aristoteles hat da, in seiner Lehre von der Entelechie, das apollinische Lebensgefühl vollkommen richtig formuliert —, weiß nichts von einer nachschaffenden Phantasie. Sie war an die Szene mit der den Hintergrund schroff abschließenden Bühnenwand gebunden. Mit dem wirklichen, von der südlichen Sonne überstrahlten Vorgang war das Kunstwerk des Sophokles erschöpft. Führen wir, deren Leib ein physiognomischer Ausdruck der faustischen Seele ist, wie die Porträtkunst lehrt, aber heute ein Drama von ihm auf, so ist es kein antikes Drama mehr. Wir sehen mit andern Augen und nicht nur mit den leiblichen Augen und bemerken nun freilich den Gespensterschritt starrer Puppen nicht mehr, der ein Sinnbild jenes uns so fremden Lebensgefühls war. Wir sind geneigt, über derlei „Äußerlichkeiten“ hinwegzusehen und vergessen, daß die antike Kultur nur Äußerliches als wirklich anerkennt,[S. 443] daß die Tiefe dieses Seelentums nur im Sinnlich-Nahen liegt. Nichts kann das euklidische Lebensgefühl deutlicher machen als eben das Element des Chores. Der Chor ist die griechische Urtragödie, die Urklage über den Jammer des menschlichen Seins und der Dialog in den Chorpausen — feierlich und keineswegs „dem Leben abgelauscht“ — eine späte Zutat. Dieser Chor als Menge, als der ideale Gegensatz zum einsamen, zum innerlichen Menschen, zum Monolog der abendländischen Szene, dieser Chor, der immer anwesend bleibt, vor dem sich alle „Selbstgespräche“ abspielen, der die Angst vor dem Grenzenlosen, Leeren auch im Bühnenbilde vertreibt — das ist apollinisch. Die Selbstbetrachtung als öffentliche Tätigkeit, die prunkvolle öffentliche Klage statt des Schmerzes im einsamen Kämmerlein (— „wer nie die kummervollen Nächte auf seinem Bette weinend saß“ —), das tränenreiche Jammergeschrei, das eine ganze Reihe von Dramen wie den Philoktet und die Trachinierinnen füllt, die Unmöglichkeit, allein zu bleiben, der Sinn der Polis, all das Weibliche dieser Kultur, wie es der Idealtypus des Apoll von Belvedere verrät, offenbart sich im Symbol des Chores. Dieser Art von Drama gegenüber ist das Shakespeares ein einziger Monolog. Selbst die Zwiegespräche, selbst die Gruppenszenen lassen die ungeheure innere Distanz dieser Menschen empfinden, von denen jeder im Grunde nur mit sich selbst spricht. Nichts vermag diese seelische Ferne zu durchbrechen. Man fühlt sie im Hamlet wie im Tasso, im Don Quijote wie im Werther, aber sie ist schon im Parzeval in ihrer ganzen Unendlichkeit Gestalt geworden; sie unterscheidet die gesamte abendländische Poesie von der gesamten antiken. Unsre ganze Lyrik, von Walther von der Vogelweide bis auf Goethe, bis auf die Lyrik der sterbenden Weltstädte herab ist monologisch, die antike Lyrik ist eine Lyrik im Chor, eine Lyrik vor Zeugen. Die eine wird innerlich aufgenommen, im wortlosen Lesen, als unhörbare Musik, die andre wird öffentlich rezitiert. Die eine gehört dem schweigenden Raume — als Buch, das überall zu Hause ist —, die andre dem Platz, an dem sie erklingt.
Die Kunst des Thespis entwickelt sich deshalb, obwohl die Mysterien von Eleusis und die thrakischen Feste der Epiphanie[S. 444] des Dionysos nächtlich gewesen waren, mit innerster Notwendigkeit zu einer Szene des Vormittags und des vollen Sonnenlichts. Aus den abendländischen Volks- und Passionsspielen dagegen, die aus der Predigt mit verteilten Rollen hervorgegangen sind und erst von Klerikern in der Kirche, später von Laien auf dem freien Platz davor, und zwar an den Vormittagen der hohen Kirchenfeste (Kirmessen) vorgetragen wurden, entstand unvermerkt eine Kunst des Abends und der Nacht. Schon zu Shakespeares Zeiten spielte man am Spätnachmittag und dieser mystische Zug, der das Kunstwerk der ihm zugehörigen Helligkeit annähern will, hatte zur Zeit Goethes sein Ziel erreicht. Jede Kunst, jede Kultur überhaupt hat ihre bedeutsame Tagesstunde. Die kontrapunktische Musik ist die Kunst der Dunkelheit, wo das innere Auge erwacht, die attische Plastik die des vollen Lichtes. Wie tief diese Beziehung reicht, beweisen, die gotische Plastik mit der sie umhüllenden ewigen Dämmerung und die ionische Flöte, das Instrument des hohen Mittags. Die Kerze bejaht, das Sonnenlicht verneint den Raum gegenüber den Dingen. In den Nächten siegt der Weltraum über die Materie, im Lichte des Mittags verleugnen die Dinge den Raum. So unterscheiden sich das attische Fresko und die nordische Ölmalerei. So wurden Helios und Pan antike, der Sternenhimmel und die Abendröte faustische Symbole. Auch die Seelen der Toten gehen mitternachts um, vor allem in den zwölf langen Nächten nach Weihnachten. Die antiken Seelen gehörten dem Tage. Noch die alte Kirche hatte vom δωδεκαήμερον, den zwölf geweihten Tagen, geredet; mit dem Erwachen der abendländischen Kultur wurde die „Zwölftnacht“ daraus.
Die antike Vasen- und Freskomalerei — man hat das noch nie bemerkt — kennt keine Tageszeit. Kein Schatten zeigt den Stand der Sonne, kein Himmel die Gestirne an; es herrscht reine, zeitlose Helligkeit. Das Atelierbraun der klassischen Ölmalerei entwickelte sich mit gleicher Selbstverständlichkeit zum Gegenteil, einer imaginären, von der Stunde unabhängigen Dunkelheit, der eigentlichen Atmosphäre des faustischen Seelenraumes. Stete Helle und stete Dämmerung trennen in der Tat antike und westeuropäische Malerei, antike und westeuropäische Bühne voneinander. Und darf man nicht auch die euklidische[S. 445] Geometrie eine Mathematik des Tages, die Analysis eine der Nacht nennen?
Man wird die Beziehung jener plastischen Geometrie zum Szenenbild des Dionysostheaters — mit Chor, Maske, Kothurn und den drei Einheiten — nicht verkennen und ebensowenig die der Analysis zum unkörperlichen Szenenbilde unsres Dramas, dem umrahmten Bühnenausschnitt in künstlichem Lichte und mit perspektivischem Horizont, der den Weltraum bedeutet. Gerade die raumfeindliche euklidische Körperlehre macht das Prinzip der „Einheit des Ortes“ begreiflich. Jeder Szenenwechsel, der die Phantasie zu einer Einheit höherer, nicht sinnlicher Ordnung heraufruft, sprengt die rein stoffliche Gegenwart, bezieht den Weltraum ein, wirkt perspektivisch, richtunggebend, musikalisch und zerstört den stereometrischen, statuenhaften Aspekt, in dem alle Bedeutung für den antiken Zuschauer beschlossen liegt.
Für die Griechen sicherlich eine Art profanen Frevels, ist der Szenenwechsel für uns beinahe ein religiöses Bedürfnis, eine Forderung der innern Wahrheit. In der gleichbleibenden Szene des Tasso liegt etwas Heidnisches. Wir empfinden das als Unnatur. Wir brauchen innerlich ein Drama voller Perspektiven und weiter Hintergründe, eine Bühne, die alle sinnlichen Schranken aufhebt und die ganze Welt in sich zieht. Shakespeare, der geboren wurde, als Michelangelo starb, und zu dichten aufhörte, als Rembrandt zur Welt kam, hat das Maximum von Unendlichkeit, von leidenschaftlicher Überwindung aller statischen Gebundenheit erreicht. Seine Wälder, Meere, Gassen, Gärten, Schlachtfelder liegen im Fernen, Grenzenlosen. Jahre fliehen in Minuten vorüber. Der wahnsinnige Lear zwischen dem Narren und dem tollen Bettler im Sturm auf der nächtlichen Heide, das Ich in tiefster Einsamkeit im Raume verloren — das ist faustisches Lebensgefühl. Man wird bemerken, daß — wie im Ölgemälde, dessen infinitesimaler Geist mit dem der tragischen Szene völlig identisch ist — auch im Szenenbilde die charakteristische Landschaft eine vorwiegende Rolle spielt, und auch das schlägt die Brücke hinüber zu den innerlich gesehenen, erfühlten Landschaften der Musik, daß die Bühne der elisabethanischen Zeit das alles nur bezeichnet, während das[S. 446] geistige Auge sich aus spärlichen Andeutungen ein Bild der Welt entwirft, in welcher die Szenen sich abspielen und die eine Illusionsbühne niemals hätte verifizieren können. Der Renaissance gegenüber entsteht ein Trieb nach dem Freien, Unbegrenzten, Nichtoptischen, in dem für uns der tiefere Sinn aller Natur liegt, und wo umschlossene Räume notwendig werden, weist eine offene Halle oder ein Fenster in die Ferne. Die griechische Szene ist niemals Landschaft; sie ist überhaupt nichts. Man darf sie höchstens als die Basis wandelnder Statuen bezeichnen. Die Figuren sind alles, auf dem Theater wie im Fresko. Hier erinnere man sich der viel bemerkten, aber nie wirklich aufgeklärten Tatsache, daß „der antike Mensch kein Naturgefühl in unserm Sinne“ besitzt. Hier ist der Grund. Das apollinische Tiefenerlebnis, das Ursymbol des σῶμα, hat einen andern Begriff von Natur zur Folge. Das faustische Naturgefühl ist ein Gefühl des Unendlichen, das durch und über den Dingen sich manifestiert, der Natur als Raum. Dies Gefühl hat die echte Szene Goethes und Shakespeares geschaffen und würde darüber weit hinausgeführt haben, hätte das antike Vorbild den Willen dazu nicht gelähmt. Die Natur des Griechen war etwas andres, uns so fremd, daß wir sie als solche nicht erkannt haben und das Gefühl von ihr ist es, das sich, uns kaum verständlich, in der Bindung des Sinnlichen durch die drei Einheiten äußert.
Alles Sinnliche aber ist gemeinverständlich. Damit wurde unter allen Kulturen, die es bisher gab, die antike in den Äußerungen ihres Lebensgefühls am meisten, die abendländische am wenigsten populär. Gemeinverständlichkeit ist das Gegenteil von Esoterik. Es ist das Merkmal einer Schöpfung, die sich jedem Betrachter auf den ersten Blick mit all ihren Geheimnissen preisgibt; einer Schöpfung, deren Sinn sich in der Außenseite und Oberfläche verkörpert. Gemeinverständlich ist in jeder Kultur das, was von urmenschlichen Zuständen und Bildungen her unverändert geblieben ist, was der Mann von den Tagen der Kindheit an fortschreitend begreift, ohne eine ganz neue Betrachtungsweise erkämpfen zu müssen, überhaupt das, was[S. 447] nicht erkämpft werden muß, was sich von selbst gibt, was im sinnlich Gegebenen unmittelbar zutage liegt, nicht durch dasselbe nur angedeutet ist und nur — von wenigen, unter Umständen von ganz vereinzelten — gefunden werden kann. Es gibt volkstümliche Ansichten, Werke, Menschen. Jede Kultur hat ihren ganz bestimmten Grad von Esoterik oder Popularität, der ihren gesamten Leistungen innewohnt, soweit sie symbolische Bedeutung haben. Das Gemeinverständliche hebt den Unterschied zwischen den Menschen auf, hinsichtlich des Umfangs und der Tiefe ihres Seelischen. Die Esoterik betont ihn, verstärkt ihn. Endlich, auf das ursprüngliche Tiefenerlebnis des zum Selbstbewußtsein erwachenden Menschen angewendet und damit auf das Ursymbol seines Daseins und den Stil seiner Umwelt bezogen: zum Ursymbol des Körperhaften gehört die rein populäre, „naive“, zum Symbol des unendlichen Raumes die ausgesprochen unpopuläre Beziehung zwischen Kulturschöpfungen und den dazu gehörigen Kulturmenschen. Populär ist die Helle und Nähe, der Vordergrund, das Augenblickliche und Gegenwärtige, in dem die unmittelbare Sinnesempfindung über den Raum siegt. Populär ist jede Wissenschaft, welche die nächsten und greifbarsten Motive aufsucht und ihrer innern Struktur nach sich in ihnen erschöpft und erschöpfen kann. Die Ferne weist ab; sie legt Raum zwischen sich und die Menschen; sie fordert Überwindung, Willen, Kraft; sie wird damit den wenigsten zugänglich. Die Nähe bietet sich jedermann an.
Die antike Geometrie ist die des Kindes, die eines jeden Laien. Euklids Elemente der Geometrie werden noch heute in England als Schulbuch gebraucht. Der Alltagsverstand wird sie stets für die einzig richtige und wahre halten. Alle andern Arten natürlicher Geometrie, die möglich sind und die — in angestrengtester Überwindung des populären Augenscheins — von uns gefunden wurden, sind nur einem Kreise berufener Mathematiker verständlich. Die berühmten vier Elemente des Empedokles sind die jedes naiven Menschen und seiner „angebornen Physik“. Was Sophokles und Euripides schrieben, begriff jeder Zuschauer. Ihre Tragik ist die der Orakel, die des Volksglaubens an Wahrsagung und des deus ex machina, die uns — man denke an die Braut von Messina und ähnliches —[S. 448] unerträglich ist. Für wie viel Menschen aber sind Wolframs Parzeval, der Sturm, der Tasso wirklich geschrieben?
Alles Antike ist — dem pflanzenhaften Lebensgefühl entsprechend — mit einem Blick zu umfassen, sei es der dorische Tempel, die Statue, die Polis, der Götterkult; es gibt keine Hintergründe und Geheimnisse. Aber man vergleiche daraufhin eine gotische Domfassade mit den Propyläen, eine Radierung mit einem Vasengemälde, die Politik des athenischen Volkes mit der modernen Kabinettspolitik. Man bedenke, wie jedes unsrer epochemachenden Werke der Poesie, der Politik, der Wissenschaft eine ganze Literatur von Erklärungen hervorgerufen hat, mit sehr zweifelhaftem Erfolge dazu. Die Parthenonskulpturen des Phidias waren für jeden Hellenen da, die Musik Bachs und seiner Zeitgenossen war eine Musik für Musiker. Wir haben den Typus des Rembrandtkenners, des Dantekenners, des Kenners der kontrapunktischen Musik und es ist — mit Recht — ein Einwand gegen Wagner, daß der Kreis der Wagnerianer allzu weit geworden ist, daß allzu wenig von seiner Musik nur dem gewiegten Musiker vorbehalten bleibt. Aber eine Gruppe von Phidiaskennern? Oder gar Homerkennern? Hier wird eine Reihe von Phänomenen verständlich, als Symptomen des abendländischen Lebensgefühls, die man bisher geneigt war, als allgemein menschliche Beschränktheiten moralphilosophisch oder wohl richtiger melodramatisch aufzufassen. Der „unverstandene Künstler“, der „verhungernde Poet“, der „verhöhnte Erfinder“, der Denker, „der erst in Jahrhunderten begriffen wird“ — das sind Typen einer exklusiven und esoterischen Kultur. Das Pathos der Distanz, in dem sich der Hang zum Unendlichen und also der Wille zur Macht verbirgt, liegt diesen Phänomenen zugrunde. Sie sind im Umkreise faustischen Menschentums, und zwar von der Gotik bis zur Gegenwart ebenso notwendig, als sie unter apollinischen Menschen undenkbar sind.
Alle hohen Schöpfer des Abendlandes waren von Anfang bis zu Ende in ihren eigentlichen Absichten nur einem kleinen Kreise zugänglich. Michelangelo hat gesagt, daß sein Stil dazu berufen sei, Narren zu züchten. Gauß hat dreißig Jahre lang seine Entdeckung der nichteuklidischen Geometrie verschwiegen,[S. 449] weil er das „Geschrei der Böoter“ fürchtete. Aber das gilt von jedem Maler, jedem Staatsmann, jedem Philosophen. Man vergleiche doch Denker beider Kulturen, Anaximander, Heraklit, Protagoras mit Giordano Bruno, Leibniz oder Kant. Man denke daran, daß — außer Schiller — kein deutscher Dichter, der überhaupt Erwähnung verdient, von Durchschnittsmenschen verstanden werden kann und daß es in keiner abendländischen Sprache ein Werk von dem Range und zugleich der Simplizität Homers gibt. Das Nibelungenlied ist eine spröde und verschlossene Dichtung, und Dante zu verstehen ist wenigstens in Deutschland selten mehr als eine literarische Pose. Was es in der Antike nie gab, hat es im Abendlande immer gegeben: die exklusive Form. Ganze Zeitalter wie die der provencalischen Kultur und des Rokoko sind im höchsten Grade gewählt und abweisend. Ihre Ideen, ihre Formensprache sind nur für eine wenig zahlreiche Klasse von höheren Menschen vorhanden. Gerade daß die Renaissance, diese vermeintliche Wiedergeburt der — so gar nicht exklusiven, in ihrem Publikum so gar nicht wählerischen — Antike keine Ausnahme macht, daß sie durch und durch die Schöpfung der Medici und einzelner erlesener Geister war, ein Geschmack, der die Menge von vornherein abwies, daß im Gegenteil das Volk von Florenz gleichgültig, erstaunt oder unwillig zusah und gelegentlich, wie im Falle Savonarolas, mit Vergnügen die Meisterwerke zerschlug und verbrannte, beweist, wie tief diese Seelenferne geht. Denn die attische Kultur besaß jeder Bürger. Sie schloß keinen aus und sie kannte deshalb den Unterschied von tief und flach, der für die faustische Sphäre von entscheidender Bedeutung ist, überhaupt nicht. Populär und flach sind für uns Wechselbegriffe, in der Kunst wie in der Wissenschaft; für antike Menschen sind sie es nicht. „Oberflächlich aus Tiefe“ hat Nietzsche die Griechen einmal genannt.
Man betrachte daraufhin unsre Wissenschaften, die alle, ohne Ausnahme, neben elementaren Anfangsgründen „höhere“, dem Laien unverständliche Gebiete haben — auch dies ein Symbol des Unendlichen und der Richtungsenergie. Es gibt bestenfalls tausend Menschen auf der Welt, für welche heute die letzten Kapitel der theoretischen Physik geschrieben werden. Gewisse[S. 450] Probleme der modernen Mathematik sind nur einem noch viel engern Kreise zugänglich. Alle volkstümlichen Wissenschaften sind heute von vornherein wertlose, verfehlte, verfälschte Wissenschaften. Wir haben nicht nur eine Kunst für Künstler (l’art pour l’art), sondern auch eine Mathematik für Mathematiker, eine Politik für Politiker — von der das profanum vulgus der Zeitungsleser keine Ahnung hat,[100] während die antike Politik niemals über den geistigen Horizont der ἀγορά hinausging — und und eine Poesie für Philosophen. Man kann den beginnenden Verfall der abendländischen Wissenschaft, der schon deutlich fühlbar ist, allein an dem Bedürfnis nach einer Wirkung ins Breite ermessen; daß die strenge Esoterik der Barockzeit als drückend empfunden wird, verrät die sinkende Kraft, die Abnahme des Distanzgefühls, das diese Schranke ehrfürchtig anerkennt. Die wenigen Wissenschaften, die heute noch ihre ganze Feinheit, Eleganz und Energie des Schließens und Folgerns bewahrt haben und nicht vom Feuilletonismus angegriffen sind — es sind nicht mehr viele: die theoretische Physik, die Mathematik, die katholische Dogmatik, vielleicht noch die Jurisprudenz —, wenden sich an einen engen, gewählten Kreis von Kennern. Der Kenner aber ist es, der mit seinem Gegensatz, dem Laien, der Antike fehlt, wo jeder alles kennt. Für uns hat diese Polarität von Kenner und Laie den Rang eines großen Symbols und wo die Spannung dieser Distanz nachzulassen beginnt, da erlischt das faustische Lebensgefühl.
Dieser Zusammenhang gestattet für die letzten Stadien der abendländischen Geistigkeit — also für die nächsten zwei, vielleicht nicht einmal zwei Jahrhunderte — den Schluß, daß, je höher die weltstädtische Leere und Trivialität der öffentlich und „praktisch“ gewordenen Künste und Wissenschaften steigt, desto strenger sich der posthume Geist der Kultur in sehr enge Kreise zurückziehen und dort ohne Zusammenhang mit der Öffentlichkeit an Gedanken und Formen wirken wird, die nur einer äußerst geringen Anzahl von bevorzugten Menschen etwas bedeuten können.
[S. 451]
Kein antikes Kunstwerk sucht eine Beziehung zum Betrachter. Das hieße den unendlichen Raum, in dem das einzelne Werk sich verliert, durch dessen Formensprache bejahen, ihn in die Wirkung einbeziehen. Eine attische Statue ist vollkommen euklidischer Körper, zeitlos und beziehungslos, durchaus in sich abgeschlossen. Sie schweigt. Sie hat keinen Blick. Sie weiß nichts vom Zuschauer. Wie sie im Gegensatz zu den plastischen Gebilden aller andern Kulturen ganz für sich steht und sich in keine größere architektonische Ordnung einfügt, so steht sie unabhängig neben dem antiken Menschen, Körper neben Körper. Er empfindet ihre bloße Nähe, ihre ruhende Form, nicht ihre Macht, keine den Raum durchdringende Wirkung. So äußert sich das apollinische Lebensgefühl.
Die erwachende magische Kunst kehrte alsbald den Sinn dieser Formen um. Das Auge der Statuen und Porträts konstantinischen Stils richtet sich groß und starr auf den Betrachter. Es repräsentiert die höhere der beiden Seelensubstanzen, das Pneuma. Die Antike hatte das Auge blind gebildet; jetzt wird die Pupille gebohrt, das Auge wendet sich, unnatürlich vergrößert, in den Raum hinein, den es in der attischen Kunst nicht als seiend anerkannt hatte. Im antiken Freskogemälde waren die Köpfe einander zugewendet; jetzt, in den Mosaiken von Ravenna und schon in den Reliefs der altchristlich-spätrömischen Sarkophage, wenden sie sich sämtlich dem Betrachter zu und heften den durchgeistigten Blick auf ihn. Eine geheimnisvoll eindringliche Fernwirkung geht, höchst unantik, von der Welt im Kunstwerk in die Sphäre des Zuschauers hinüber. Noch in den frühflorentinischen und frührheinischen Bildern auf Goldgrund ist etwas von dieser Magie zu spüren.
Und nun betrachte man die abendländische Malerei, von Lionardo an, wo sie zum vollen Bewußtsein ihrer Bestimmung gelangt ist. Wie begreift sie den einen unendlichen Raum, dem das Werk und der Zuschauer, beide bloße Schwerpunkte dynamischer Seelenkräfte, angehören? Das volle faustische Lebensgefühl, die Leidenschaft der dritten Dimension, ergreift die Form des „Bildes“, der einfachen, farbig behandelten Fläche, und gestaltet[S. 452] sie in unerhörter Weise um. Das Gemälde bleibt nicht für sich, es richtet sich nicht auf den Zuschauer; es nimmt ihn in seine Sphäre auf. Der durch den Bildrahmen begrenzte Ausschnitt — das Guckkastenbild, das getreue Seitenstück des Bühnenbildes — repräsentiert den Weltraum selbst. Vordergrund und Hintergrund verlieren ihre stofflich-nahe Tendenz und schließen auf, statt abzugrenzen. Ferne Horizonte vertiefen das Bild ins Unendliche; die farbige Behandlung der Nähe löst die ideale vordere Scheidewand der Bildfläche auf und erweitert den Bildraum so, daß der Betrachter in ihm weilt. Die Überschneidungen durch den Rahmen, die seit 1500 immer häufiger und kühner werden, entwerten auch die seitliche Grenze. Der hellenische Betrachter eines polygnotischen Fresko stand vor dem Bilde. Wir „versenken“ uns in ein Bild von Rubens und Lorrain, d. h. wir werden durch die Gewalt der Raumbehandlung in das Bild gezogen. Damit ist die Einheit des Weltraumes hergestellt. In dieser durch das Bild imaginierten Unendlichkeit herrscht nun die abendländische Perspektive.
Das Problem der Perspektive ist ein metaphysisches. Was das Tiefenerlebnis für den seelisch erwachenden Kulturmenschen bedeutet, das plötzliche Werden einer ihm allein zugehörigen Welt, das wiederholt sich in jeder dieser großen Künste, die auf einer Fläche ein Stück Welt, ein Ausgedehntes von bedeutsamem Typus geben wollen. Es gibt eine Vielzahl möglicher Perspektiven, deren jede eine Weltanschauung repräsentiert, und die Wahl, welche die Malerei einer Kultur hier mit unbedingter Notwendigkeit trifft, hat den Rang eines Symbols.
Betrachtet man Ölgemälde der abendländischen, Vasenbilder der antiken, Reliefs der ägyptischen, Mosaiken der arabischen und Bildrollen der chinesischen Kultur, so findet man, daß das ganz Einzige der faustischen Seele das Bedürfnis eines idealen Mittelpunktes im Unendlichen, eines dynamischen Zentrums ist. Dies ist der Sinn der westeuropäischen Perspektive in Bild, Bühne und Park, des Durchblicks vom Portal zum Hochaltar der Dome, des Anfangspunktes mathematischer und physikalischer Kraftsysteme. Diese Perspektive wählt einen Konvergenzpunkt, der nun seinerseits das Ich zum funktionalen Schwerpunkt der Welt macht. Das ist Richtungsenergie, Wille zur Macht.[S. 453] Dergleichen hat keine andre Kultur gekannt. Das ist es, was die solipsistische Philosophie des Barock stets gesucht hat. Ob sie die Welt zur Vorstellung macht, zur Erscheinung des Dinges an sich durch die Form der geistigen Rezeption, ob sie das Problem realistisch oder idealistisch faßt, immer ist es das Ich, ohne das die Welt nicht möglich erscheint. Das Problem ist unlösbar, ein inneres Postulat des abendländischen Seelentums. Alle Denker verloren sich darüber in Widersprüche und Unmöglichkeiten. Nur das Fundament blieb unerschüttert, das Lebensgefühl, das die einsame Seele zum schöpferischen Mittelpunkt des Alls macht. Der Grieche ist Atom in seinem Kosmos, der Chinese fühlt sein Selbst irgendwo im weiten Ausgedehnten, wo er sich eine friedliche Insel sucht; nur das faustische Ich ist Herrscher im Raume, auch im Raume des Gemäldes, das sich in den vom Blickpunkt aus geordneten Hintergrund verliert und ihn umschließt.
Man hat es noch nicht genügend bemerkt, wie zu Beginn der arabischen Kultur und zwar zugleich in der heidnischen und christlichen Kunst die antike Bildperspektive — die von unserm Standpunkt aus nur Mangel an Perspektive, d. h. an Beherrschung eines ausgedehnten Ganzen durch ein ordnendes Prinzip ist, da hier jeder einzelne Körper seine eigne Orientierung besitzt — sich plötzlich umwandelt, das wunderbare Zeichen eines neuen Weltgefühls, welches das Tiefenerlebnis vollkommen anders deutet. Am klarsten wird die magische „umgekehrte“ Perspektive unter den erhaltenen Beispielen am Theodosius-Obelisken in Konstantinopel: am größten ist die vom Betrachter entfernteste Figur, am kleinsten die nächste — weil die Gestalt des Kaisers den Raum beherrscht und von ihm aus die Ordnung empfunden wird. Die chinesisch-japanische Malerei verdeutlicht das Welterlebnis einer wieder ganz anders angelegten Seele, der faustischen zwar in manchem verwandt und auch einem grenzenlosen Ausgedehnten hingegeben, aber ohne den ordnenden Machtanspruch des Ich. Die chinesische Philosophie, Konfucius z. B., unterscheidet sich in diesem Punkte durchaus und in derselben Richtung von der abendländischen. Wie die fortlaufenden Darstellungen der Rollbilder zeigen, empfindet der Betrachter das Räumliche vom Mittelgrunde aus, in dem er[S. 454] zwanglos, selbst im Raume verloren statt ihn bildend (Kant), die Tiefe und Nähe durchstreift, ohne daß auf die Ferne das uns notwendige und selbstverständliche Schwergewicht gelegt wird. Daher die ostasiatische Parallelperspektive (alle Parallelen werden als solche gezeichnet) im Gegensatz zur faustischen Konvergenzperspektive. Man faßt das einzelne einzeln auf, nicht das Ganze als eine vom Blick beherrschte Einheit. Die chinesische Seele fühlt darin der ägyptischen nicht unähnlich. Auch die auf starke Nahsicht berechneten Reliefs des Alten Reiches, welche das Hintereinander durch Übereinanderordnung geben, wollen im Entlangschreiten der Reihe nach aufgefaßt werden — hier wie dort liegt ein Symbol des Lebensweges der elementaren Anordnung zugrunde.
Die chinesische Landschaft ist also entweder Nah- oder Fernbild, je nachdem der Mittelgrund, von dem die Bedeutung des Ganzen gleichsam ausstrahlt, nah oder fern vom Betrachter angenommen worden ist. Unsere Landschaften, in die wir durch den Rahmen hineinblicken, sind beides zugleich, unendliche Ferne und unendliche Nähe, durch das Konvergenzprinzip zusammengefaßt.[101] „Die Ferne ist die Seele der Landschaft“ — dieser altchinesische Meisterspruch rührt aber dennoch an den Geist Rembrandts. Erinnern wir uns, daß Landschaften in der raumverneinenden antiken Kunst undenkbar sind, auch das am Unendlichen haftende Naturgefühl. Es sind nur diese zwei Kulturen, einander so fern gelegen, die beide die reine, in die Ferne sich dehnende Landschaft zum Thema einer großen Kunst erhoben. Es folgt daraus, daß sie allein eine Gartenkunst großen Stiles besaßen; die abendländische wiederholt in ihr das Prinzip der Konvergenzperspektive — der point de vue der großen Rokokoparks —, die chinesische mit gleicher Eindringlichkeit der Formensprache das der Parallelperspektive. Ich möchte hier auch an schöne altdeutsche Rechts- und Gelöbnisformeln erinnern, die das gleiche Unendlichkeitsgefühl, in starkem Gegensatz zur plastischen Gegenwärtigkeit des römischen Rechts und der griechischen Kunst zum Ausdruck bringen. „Immer[S. 455] und ewiglich, dieweil Grund und Grat stehet“; „so weit die Sonne scheint“; „solange als der Wind die Wolken treibt“; „so weit gehen als der Wind weht und der Hahn kräht“; „so weit sich das Blaue am Himmel erstreckt“: dies Gefühl ist es, dem die westeuropäische Landschaftsmalerei eine große Form gegeben hat.
Wie tief die Esoterik der faustischen Seele geht, in wie hohem Grade sie alles und jedes in ihrem Ausdruck erkämpfen mußte, während der antiken Seele ihre populären Symbole geschenkt wurden, beweist auch die Geschichte der Perspektive. Unter allen, die bisher als Ausdruck eines Welterlebnisses in historische Erscheinung traten, fordert die abendländische den höchsten Grad von Abstraktion, die peinlichste Strenge der Formgebung. Das Bedürfnis nach ihr taucht in den Niederlanden zugleich mit der Entstehung des Kontrapunkts auf, unmittelbar nach Vollendung des gotischen Bausystems. Der Drang nach diesem Prinzip von höchstem symbolischen Gehalt und die Kraft, es zu verwirklichen, waren keineswegs gleich. Brunellesco fand um 1430 wenigstens eine annähernde mathematische Lösung der Zentralperspektive, sicherlich die einfachste, aber in ihrer schematischen Enge wenig befriedigend. In der Tat war sie, an Körpern haftend, nicht durch Luftbehandlung realisierbar, wohl für die architektonischen Bildkulissen südlicher, nicht aber für die freien Landschaften nordischer Meister brauchbar. Diese im Grunde plastische Linienperspektive besitzt eine antigotische Tendenz und bestimmt den allgemeinen Stil der Renaissancemalerei ebenso wie die Wahl ihrer Entwürfe. Sie bildet den Raum durch seine körperhaften Grenzen, nicht den Raum an sich. Das entspricht durchaus dem florentinischen, aber schon nicht mehr dem venezianischen Formgefühl. Die deutschen Meister haben immer mehrere Konvergenzpunkte, wodurch sie den Schein einer unkörperlichen Freiheit bewahren. Im Grunde hat man eine mathematische Präzision, die ein Verkennen des tiefern Sinnes der Malerei bedeuten würde, nie erstrebt. Wie schwer aber selbst die Zentralperspektive zu verwirklichen ist, beweist die Tatsache, daß Maler und Bildhauer der Frührenaissance sich den perspektivischen Grundriß ihrer Bilder und Reliefs von andern einzeichnen ließen. So hat Brunellesco das für Masaccio[S. 456] und Donatello getan. Die Ölmalerei ging dann mit steigender Entschiedenheit von der linearen zur atmosphärischen Perspektive über, mathematisch gesprochen und an einem gleichzeitigen Phänomen verdeutlicht von der Koordinatengeometrie zur reinen funktionalen Analysis, denn die reine Landschaftsperspektive wird nur durch die Funktionen der Farbentöne verwirklicht. Es ist der Schritt vom zeichnerischen zum malerischen Stil, und in diesem Sinne hat die faustische Konvergenzperspektive ihre letzte Fassung, die jeden Rest linearer, d. h. renaissancemäßiger Tiefenbehandlung ausschloß, in der Freilichtmalerei des 19. Jahrhunderts erhalten.
Das faustische Lebensgefühl knüpft nun das perspektivische Rahmenbild an ein astronomisches Weltbild von einer ungeheuren Leidenschaft im Durchdringen unendlicher Raumfernen.
Der apollinische Mensch hatte den Weltraum nie bemerken wollen; seine philosophischen Systeme schweigen sämtlich von ihm. Sie kennen nur Probleme der greifbar wirklichen Dinge, und dem „zwischen den Dingen“ haftet nichts irgendwie Positives und Bedeutsames an. Sie nehmen die Erde, auf der sie stehen, als die schlechthin gegebene ganze Welt und nichts wirkt für den, der hier noch die innersten und geheimsten Gründe zu sehen vermag, grotesker als die immer wiederholten Versuche, das Himmelsgewölbe der Erde theoretisch so zuzuordnen, daß deren symbolischer Vorrang in keiner Weise angetastet wird. Eine Art metaphysischer Angst trieb hier zu Entwürfen, wie sie der Gestaltungskraft der antiken Seele — man denke an den Mythus und seine immer höchst stofflichen Bildungen — sonst ganz fern liegen. Wir haben das Schauspiel großartiger Astronomien in der ägyptischen, babylonischen, arabischen Kultur und mitten unter ihnen den antiken Menschen, der gleichgültig oder besorgt um sein euklidisches Weltbild zusieht. Wie dürftig sind die wenigen nacherzählten Angaben in seiner Philosophie und wo wäre der Denker im Athen des Perikles, der sich eine Sternwarte erbaut und eigne Gedanken über ein Weltsystem gehabt hätte! Es sei noch einmal erwähnt, daß gerade damals in Athen ein Volksbeschluß durchging, der die Verbreitung astronomischer[S. 457] Theorien mit den schwersten Strafen bedrohte. Daß die Erde Kugelgestalt besitzt, das heißt, daß sie in einem gewaltigen Raume schwebt, war ihnen wiederholt bewiesen worden. Pythagoras wußte es schon. Aber man ließ den Gedanken nicht ins Innere der Seele dringen und hielt das Weltgefühl unabhängig davon. Man vergaß ihn immer wieder, weil man ihn vergessen wollte.
Und damit vergleiche man die erschütternde Vehemenz, mit welcher die Entdeckung des Kopernikus, dieses „Zeitgenossen“ des Pythagoras, die Seele des Abendlandes durchdrang, und die tiefe Inbrunst, mit welcher Kepler die Gesetze der Planetenbahnen entdeckte, die ihm als eine unmittelbare Offenbarung Gottes erschienen; er wagte bekanntlich nicht an ihrer kreisförmigen Gestalt zu zweifeln, weil jede andre ihm ein Symbol von zu geringer Würde darzustellen schien. Hier kam das altnordische Lebensgefühl, die Wikingersehnsucht nach dem Grenzenlosen, zu ihrem Rechte. Dies gibt der echt faustischen Erfindung des Fernrohrs einen tiefen Sinn. Indem es in Räume eindringt, die dem bloßen Auge verschlossen bleiben, an denen der Wille zur Macht über den Weltraum eine Grenze findet, erweitert es das All, das wir „besitzen“. Das wahrhaft religiöse Gefühl, das den heutigen Menschen ergreift, der zum erstenmal diesen Blick in den Sternenraum tun darf, ein Machtgefühl, dasselbe, das Shakespeares größte Tragödien erwecken wollen, wäre einem Sophokles als der Frevel aller Frevel erschienen.
Das Pathos des kopernikanischen Weltbewußtseins, das ausschließlich unsrer Kultur angehört und — ich wage hier eine Behauptung, die heute noch ungeheuer paradox erscheinen wird — in ein gewaltsames Vergessen der Entdeckung umschlagen würde und wird, sobald sie der Seele einer künftigen Kultur bedrohlich erscheint, dies Pathos beruht auf der Gewißheit, daß nunmehr dem Kosmos das Körperlich-Statische, das sinnbildliche Übergewicht des plastischen Erdkörpers, genommen ist. Bis dahin befand sich der Himmel, der ebenfalls als substanzielle Größe gedacht oder mindestens empfunden war, im metaphysischen, polaren Gleichgewicht zur Erde. Jetzt ist es der Raum, der das All beherrscht; „Welt“ bedeutet Raum und die Gestirne sind kaum mehr als mathematische Punkte, deren Stoffliches[S. 458] das Weltgefühl nicht mehr berührt. Demokrit, der im Namen der apollinischen Kultur hier eine Körpergrenze schaffen wollte und mußte, hatte sich eine Schicht hakenförmiger Atome gedacht, die wie eine Haut den Kosmos abschließt. Demgegenüber steht unser nie gestillter Hunger nach immer neuen Weltfernen. Das System des Kopernikus hat, zuerst durch Giordano Bruno, in den Jahrhunderten des Barock eine unermeßliche Erweiterung erfahren. Wir wissen heute, daß die Summe aller Sonnensysteme — etwa 35 Millionen — ein geschlossenes Sternensystem bildet, das nachweisbar endlich ist[102] und die Gestalt eines Rotationsellipsoids besitzt, dessen Äquator mit dem Bande der Milchstraße annähernd zusammenfällt. Schwärme von Sonnensystemen durchziehen wie Züge von wandernden Vögeln mit gleicher Richtung und Geschwindigkeit diesen Raum. Eine solche Schar bildet unsre Sonne mit den hellen Sternen Capella, Wega, Atair und Beteigeuze. Die Achse des ungeheuren Systems, dessen Mitte unsre Sonne gegenwärtig nicht sehr fern steht, wird 470 Millionen mal so groß als der Abstand von Sonne und Erde angenommen. Der nächtliche Sternenhimmel gibt uns gleichzeitig Eindrücke, deren zeitlicher Ursprung bis zu 3700 Jahren auseinanderliegt; so viel beträgt der Lichtweg von der äußersten Grenze bis zur Erde. Im Bilde der Historie, das sich vor unsren Augen entfaltet, entspricht das einer Dauer über die gesamte antike und arabische Kultur zurück bis zum Höhepunkt der ägyptischen, zur Zeit der 12. Dynastie. Dieser Aspekt ist für den faustischen Geist erhaben,[103] für den apollinischen wäre er grauenvoll gewesen, eine vollkommene Vernichtung der tiefsten Bedingungen seines Daseins. Daß eine endgültige Grenze des für uns Gewordnen und Vorhandnen mit dem Rande des Sternenkörpers statuiert wird, wäre ihm als Erlösung erschienen. Wir aber haben mit innerster Notwendigkeit die unausweichliche neue[S. 459] Frage: Gibt es außerhalb dieses Systems etwas? Gibt es Mengen solcher Systeme in Entfernungen, denen gegenüber die hier festgestellten Dimensionen außerordentlich klein sind? Für die sinnliche Erfahrung erscheint eine absolute Grenze erreicht; durch diese massenleeren Räume. die eine bloße Denknotwendigkeit für uns sind, kann weder das Licht noch die Gravitation ein Existenzzeichen geben. Die seelische Leidenschaft, das Bedürfnis nach restloser Verwirklichung unsrer Daseinsidee in Symbolen aber leidet unter dieser Grenze unsrer Sinnesempfindungen.
Deshalb haben die Germanen, in deren urmenschlicher Seele das Faustische sich bereits zu regen begann, in grauer Vorzeit die Segelschiffahrt erfunden, die sie vom Festland befreite. Die Ägypter standen ihr nahe, aber sie zogen nur den Vorteil der Arbeitsersparnis daraus. Sie fuhren wie früher mit ihren Ruderschiffen die Küste entlang nach Punt und Syrien, ohne die Idee der Hochseefahrt, das Befreiende und Symbolische in ihr zu empfinden. Denn die Segelschiffahrt überwindet den euklidischen Begriff des Landes. Im Anfang des 14. Jahrhunderts erfolgt beinahe gleichzeitig — und gleichzeitig mit der Erfindung der Ölmalerei und des Kontrapunkts! — die Erfindung des Schießpulvers und des Kompasses, also der Fernwaffen und des Fernverkehrs, die beide mit tiefer Notwendigkeit auch innerhalb der chinesischen Kultur erfunden worden sind. Es war der Geist der Wikinger, der Hansa, der Geist jener Urvölker, welche die Hünengräber als die Male einsamer Seelen auf weiter Ebene aufschütteten — statt der häuslichen Aschenurne der Hellenen —, die ihre toten Könige auf brennendem Schiffe in die hohe See treiben ließen, ein erschütterndes Zeichen jener dunklen Sehnsucht nach dem Grenzenlosen, die sie trieb, auf ihren winzigen Kähnen um 900, als die Geburt der abendländischen Kultur sich ankündigte, die Küste Amerikas zu erreichen, während die von Ägyptern und Karthagern bereits ausgeführte Umschiffung Afrikas die antike Menschheit völlig gleichgültig ließ. Wie statuenhaft ihr Dasein auch hinsichtlich des Verkehrs war, bezeugt die Tatsache, daß die Nachricht vom[S. 460] ersten punischen Kriege (264–241), einem der gewaltigsten der antiken Geschichte, nur wie ein dunkles Gerücht von Sizilien nach Athen drang.
Selbst die Seelen der Griechen waren im Hades versammelt, ohne sich zu regen, als Schattenbilder (εἴδωλα), ohne Kraft, Wunsch und Empfindung. Die nordischen Seelen gesellten sich dem „wütenden Heere“ zu, das rastlos durch die Lüfte schweift und „wiederkehrt“. Der Geist des Patroklos aber — in jener wundervollen Szene am Schluß der Ilias — will nur Ruhe finden und fleht deshalb den Freund an, die Bestattung zu beschleunigen.
Auf der gleichen Kulturstufe wie die Entdeckungen der Spanier und Portugiesen erfolgte die große hellenische Kolonisation (1500 und 750–600). Aber während jene von der Abenteurersehnsucht nach ungemessenen Fernen und allem Unbekannten und Gefahrvollen besessen waren, ging der Grieche Punkt für Punkt vorsichtig hinter den bekannten Spuren der Phöniker und Karthager her, und seine Neugier erstreckte sich nicht im geringsten auf das, was jenseits der Säulen des Herkules oder des Roten Meeres lag, so leicht erreichbar es ihm gewesen wäre. Man hörte in Athen von dem Weg in die Nordsee, nach dem Kongo, nach Sansibar, nach Indien reden; zur Zeit des Heron war die Lage der Südspitze Indiens und der Sundainseln bekannt; aber man verschloß sich dem so gut wie dem astronomischen Wissen des alten Ostens. Die Kolumbussehnsucht blieb der apollinischen Seele ebenso fremd wie die Sehnsucht des Kopernikus. Diese auf den Gewinn so versessenen hellenischen Kaufleute hatten eine tiefe metaphysische Scheu vor der Ausdehnung des geographischen Horizontes. Auch da hielt man sich an Nähe und Vordergrund. Das Dasein der Polis, jenes merkwürdige Ideal des Staates als Statue, war ja nichts als eine Zuflucht vor der „weiten Welt“ der Germanen. Und dabei ist die Antike unter allen bisher erschienenen Kulturen die einzige, deren Mutterland nicht auf der Fläche eines Kontinents, sondern um die Küsten eines Inselmeeres gelagert war und ein Meer als eigentlichen Schwerpunkt umschloß. Trotzdem hat nicht einmal der Hellenismus mit seiner intellektuellen Vorliebe für Technisches sich vom Gebrauche der Ruder befreit, welche die Schiffe an der Küste hielten. Die Schiffbaukunst konstruierte damals[S. 461] — in Alexandria — Riesenschiffe von 80 m Länge, und man hatte wieder einmal das Dampfschiff im Prinzip erfunden. Aber es gibt — wir werden das später sehen — Entdeckungen von dem Pathos eines großen und notwendigen Symbols, die etwas sehr Innerliches offenbaren, und solche, die lediglich ein Spiel des Geistes sind. Das Dampfschiff ist für den apollinischen Menschen das letzte, für den faustischen das erste. Erst der Rang im Ganzen des Makrokosmos gibt einer Erfindung und ihrer Anwendung Tiefe oder Oberflächlichkeit.
Die Entdeckungen des Kolumbus und Vasco da Gama erweiterten den geographischen Horizont ins Ungemessene: Das Weltmeer trat dem Lande gegenüber in das gleiche Verhältnis wie der Weltraum zur Erde. Jetzt erst entlud sich die politische Spannung des faustischen Weltbewußtseins. Für den Griechen war und blieb Hellas das wesentliche Stück der Erdfläche; mit der Entdeckung Amerikas wurde das Abendland zur Provinz in einem riesenhaften Ganzen. Von hier an trägt die Geschichte der nordischen Kultur planetarischen Charakter.
Jede Kultur besitzt ihren eignen Begriff von Heimat und Vaterland, schwer greifbar, kaum in Worte zu fassen, voller dunkler metaphysischer Beziehungen, aber trotzdem von unzweideutiger Tendenz. Das antike Heimatgefühl, das den einzelnen ganz leibhaft und euklidisch an die Polis band, steht hier jenem rätselhaften Heimweh des Nordländers gegenüber, das etwas Musikhaftes, Schweifendes und Unirdisches hat. Der antike Mensch empfindet als Heimat nur, was er von der Burg seiner Vaterstadt aus übersehen kann. Wo der Horizont von Athen endet, beginnt die Fremde, der Feind, das „Vaterland“ der andern. Der Römer selbst der letzten republikanischen Zeit hat unter patria niemals Italien, auch nicht Latium, stets nur die Urbs Roma verstanden. Die antike Welt löst sich mit steigender Reife in eine Unzahl vaterländischer Punkte auf, unter denen ein körperliches Absonderungsbedürfnis in Gestalt eines Hasses besteht, der den Barbaren gegenüber nie in dieser Stärke zum Vorschein kommt; und nichts kann das endgültige Erlöschen des antiken und den Sieg des magischen Weltgefühls nach dieser Seite hin schärfer kennzeichnen als die Verleihung des römischen Bürgerrechts an alle Provinzialen durch Caracalla (212). Damit[S. 462] war der antike, statuenhafte Begriff des Bürgers aufgehoben. Es gab ein „Reich“, es gab folglich auch eine neue Art von Zugehörigkeit. Bezeichnend ist der entsprechende römische Begriff des Heeres. Es gab kein „römisches Heer“, wie man vom preußischen Heere spricht; es gab nur Heere, d. h. durch Ernennung eines Legaten als solche, als begrenzte und sichtbar-gegenwärtige Körper bestimmte Truppenteile („Truppenkörper“), einen exercitus Scipionis, Crassi, aber keinen exercitus Romanus. Ein verwandter Unterschied läßt sich zwischen Napoleons Grande Armée und dem abstrakten, Zeit und Raum überschreitenden Begriff der armée française feststellen. Erst Caracalla, der durch den erwähnten Akt den Begriff des civis Romanus tatsächlich aufhob, der die römische Staatsreligion durch Gleichsetzung der städtischen Gottheiten mit allen fremden auslöschte, hat auch den — unantiken, magischen — Begriff des kaiserlichen Heeres geschaffen, das durch die einzelnen Legionen in Erscheinung tritt, während altrömische Heere nichts bedeuten, sondern ausschließlich etwas sind. Von nun an ändert sich auf den Inschriften der Ausdruck fides exercituum in fides exercitus: an Stelle körperlich empfundener Einzelgottheiten (der Treue, des Glücks der Legion), denen der Legat opferte, war ein allgemein geistiges Prinzip getreten. Dieser Bedeutungswandel hat sich auch im Vaterlandsgefühl des Menschen der Kaiserzeit — nicht nur des Christen — vollzogen. Heimat ist dem apollinischen Menschen, solange ein Rest seines Weltgefühls wirksam ist, im ganz eigentlichen, körperhaften Sinne der Boden, auf dem seine Stadt erbaut ist. Man wird sich hier der „Einheit des Ortes“ attischer Tragödien und Statuen erinnern. Dem magischen Menschen, dem Christen, dem Neuplatoniker, dem Mohammedaner, dem Juden ist sie nichts, was mit geographischen Wirklichkeiten zusammenhängt. Uns ist sie eine ungreifbare Einheit von Natur, Sprache, Klima, Sitte, Geschichte; nicht Erde, sondern „Land“, nicht punktförmige Gegenwart, sondern Vergangenheit und Zukunft, nicht eine Einheit von Menschen, Göttern und Häusern, sondern eine Idee, die sich mit rastloser Wanderschaft, mit tiefster Einsamkeit und mit jener urdeutschen Sehnsucht nach dem Süden verträgt, an der von den Sachsenkaisern bis auf Hölderlin die Besten gestorben sind.
[S. 463]
Die faustische Kultur war deshalb im stärksten Maße erobernd; sie überwand alle geographisch-stofflichen Schranken; sie hat zuletzt die Erdoberfläche in ein einziges Kolonialgebiet verwandelt. Was von Meister Eckart bis auf Kant alle Denker wollten, die Welt „als Erscheinung“ den Machtansprüchen des erkennenden Ich unterwerfen, das taten von Otto dem Großen bis auf Napoleon alle Führer. Das Grenzenlose war das eigentliche Ziel ihres Ehrgeizes, die Weltmonarchie der großen Salier und Staufen, die Pläne Gregors VII. und Innozenz III., jenes Reich der spanischen Habsburger, „in dem die Sonne nicht unterging“, und der Imperialismus, um den heute der Weltkrieg geführt wird. Der antike Mensch konnte aus einem inneren Grunde kein Eroberer sein, trotz des Alexanderzuges, der als romantische Ausnahme und mehr noch durch den inneren Widerstand der Begleiter lediglich die Regel bestätigt. Sein pflanzenhaftes Seelentum verbot ihm das Schweifen in die Ferne. In den Zwergen, Nixen und Kobolden hat die nordische Seele Wesen geschaffen, die mit einer unstillbaren Sehnsucht aus dem bindenden Element erlöst sein wollen, einer Sehnsucht nach Fernem und Freiem, die den griechischen Dryaden und Oreaden unbekannt ist. Die Griechen gründeten Hunderte von Pflanzstädten am Küstensaum des Mittelmeeres, aber man findet nicht den geringsten Versuch, erobernd ins Hinterland zu dringen. Sich fern der Küste ansiedeln hieße die Heimat aus den Augen verlieren, sich allein niederlassen, liegt völlig außerhalb der Möglichkeiten des antiken Menschentums. Ein Phänomen wie die Auswanderung nach Amerika — jeder einzelne auf eigene Faust und mit einem tiefen Bedürfnis, allein zu bleiben —, der Strom der kalifornischen Goldsucher, der Trapper in den Prärien, der unbändige Wunsch nach Freiheit, Einsamkeit, ungemessener Selbständigkeit, diese gigantische Verneinung eines noch irgendwie begrenzten Heimatgefühls ist allein faustisch. Das kennt keine andre Kultur, auch die chinesische nicht.
Der hellenische Auswandrer gleicht dem Kinde, das sich an der Mutter Schürze hält: aus der alten Stadt in eine neue ziehen, die samt Mitbürgern, Göttern und Gebräuchen das genaue Ebenbild der alten ist, das gemeinsam befahrene Meer immer vor Augen; dort auf der Agora die gewohnte Existenz des[S. 464] ζῷον πολιτικόν weiterführen — darüber hinaus durfte der Szenenwechsel eines apollinischen Daseins nicht getrieben werden. Uns, die wir Freizügigkeit wenigstens als Menschenrecht und Ideal nicht vermissen können, würde das die ärgste aller Sklavereien bedeutet haben. Unter diesem Gesichtspunkt hat man die leicht mißzuverstehende römische Expansion aufzufassen, die von einer Ausdehnung des Vaterlandes weit entfernt ist. Sie hält sich genau innerhalb des Bereiches, das von Kulturmenschen schon in Besitz genommen war und jetzt ihnen als Beute zufiel. Von dynamischen Weltmachtplänen im Hohenstaufen- oder Habsburgerstil, von einem mit der Gegenwart vergleichbaren Imperialismus ist nie die Rede gewesen. Die Römer haben keinen Versuch gemacht, ins innere Afrika zu dringen. Sie haben ihre spätern Kriege nur geführt, um ihren Besitz sicherzustellen, ohne Ehrgeiz, ohne einen symbolischen Drang nach Ausbreitung, und sie haben Germanien und Mesopotamien ohne Bedauern wieder aufgegeben.
Fassen wir all dies zusammen, den Aspekt der Sternenräume, zu dem sich das Weltbild des Kopernikus erweitert hat, die Beherrschung der Erdoberfläche durch den abendländischen Menschen (das „Bleichgesicht“) im Gefolge der Entdeckung des Kolumbus, die Perspektive der Ölmalerei und der tragischen Szene und das durchgeistigte Heimatgefühl; fügen wir die zivilisierte Leidenschaft des schnellen Verkehrs, die Beherrschung der Luft, die Nordpolfahrten und die Ersteigung kaum zugänglicher Berggipfel hinzu, so taucht aus allem das Ursymbol der faustischen Seele, der grenzenlose Raum auf, als dessen Ableitungen wir die besonderen, in dieser Form rein westeuropäischen Phänomene des Willens, der Kraft, der Tat aufzufassen haben.
[92] Ursprachen bilden keine Unterlage für abstrakte Gedankengänge. Am Anfang jeder Kultur erfolgt eine innere Wandlung der vorhandenen Sprachkörper, die sie zu den höchsten symbolischen Aufgaben der Kulturentwicklung fähig macht. So entstehen zugleich mit dem romanischen Stil das Deutsche aus den germanischen Sprachen der Frankenzeit und das Französische, Italienische, Spanische aus der lingua rustica der ehemaligen Römerprovinzen, trotz so verschiedener Herkunft Sprachen von identischem metaphysischem Gehalt.
[93] ἐθέλω und βούλομαι heißen die Absicht, den Wunsch haben, geneigt sein; βουλή heißt Rat, Plan; zu ἐθέλω gibt es überhaupt kein Hauptwort. Voluntas ist kein psychologischer Begriff, sondern in echt römischem Tatsachensinne wie potestas und virtus eine Bezeichnung für praktische, äußere, sichtbar ausgeübte Begabung. Wir gebrauchen in diesem Falle das Fremdwort Energie. Der Wille Napoleons und die Energie Napoleons — das ist etwas sehr Verschiedenes. Man verwechsle die nach außen gerichtete Intelligenz, die den Römer als zivilisierten Menschen vor dem hellenischen Kulturmenschen auszeichnet, nicht mit dem, was hier Wille genannt ist. Cäsar ist nicht Willensmensch im Sinne Napoleons. Bezeichnend ist der Sprachgebrauch im römischen Recht, das der Poesie gegenüber das Grundgefühl der römischen Seele viel ursprünglicher darstellt. Die Absicht heißt hier animus (animus occidendi), der Wille, der sich auf Strafbares richtet, dolus im Gegensatz zur ungewollten Rechtsverletzung (culpa). Voluntas kommt als technischer Ausdruck gar nicht vor. „Willensfreiheit“ wird in der spätlateinischen Literatur durch liberum arbitrium nur sehr annäherungsweise gegeben.
[94] Die chinesische Seele „wandelt in der Welt“: dies ist der Sinn der ostasiatischen Malerperspektive, deren Konvergenzpunkt in der Bildmitte, nicht in der Tiefe liegt. Es sei daran erinnert, daß die antike Malerei eine Perspektive überhaupt nicht kennt. Man versteht jetzt: dies, die antike Verneinung des Hintergrundes, bedeutet den Mangel an Richtungsgefühl, an Willen, an Herrschaftsansprüchen über das „Nicht-Ich“. Durch die Perspektive werden die Dinge dem Ich, das sie ordnend auffaßt, unterworfen. Und zwar möchte ich, gegenüber dem mächtigen Zug in die Tiefe, der unsre Landschaftsmalerei auszeichnet, von einer konfucianischen Perspektive der Ostasiaten reden, womit ein im Bilde wirkendes, nicht mißzuverstehendes Weltgefühl angedeutet ist.
[95] Es versteht sich, daß der Atheismus keine Ausnahme bildet. Wenn der Materialist oder Darwinist der Gegenwart von „der Natur“ redet, die etwas zweckmäßig anordnet, die eine Auslese trifft, die etwas hervorbringt oder vernichtet, so hat er dem Deismus des 18. Jahrhunderts gegenüber nur ein Wort verändert und das Weltgefühl unverändert bewahrt.
[96] Der große Anteil, den gelehrte Jesuiten an der Entwicklung der theoretischen Physik haben, darf nicht übersehen werden. Der Pater Boscovich war der erste, der über Newton hinausgehend ein System der Zentralkräfte schuf (1759). Im Jesuitismus ist die Identifikation Gottes mit dem reinen Raume fühlbarer noch als im Kreise der Jansenisten von Port Royal, dem die Mathematiker Pascal und Descartes nahestanden.
[97] Luther hat, und dies ist einer der wesentlichsten Gründe für die Wirkung des Protestantismus gerade auf tiefere Naturen, die praktische Tätigkeit — was Goethe die Forderung des Tages nannte — in den Mittelpunkt der Moral gestellt. Die „frommen Werke“, denen die Richtungsenergie im hier angegebenen Sinne fehlt, treten unbedingt zurück. In ihrer Hochschätzung wirkte, wie in der Renaissance, ein Rest von südlichem Gefühl. Hier findet man den tiefen ethischen Grund für die steigende Mißachtung, die das Klosterwesen von nun an trifft. In der Gotik war der Eintritt ins Kloster, der Verzicht auf die Sorge, die Tat, das Wollen ein Akt von höchster ethischer Dignität. Es war das höchste denkbare Opfer: das des Lebens. Im Barock empfinden selbst Katholiken nicht mehr so. Die Stätte nicht der Entsagung, sondern des untätigen Genießens fiel dem Geist der Aufklärung zum Opfer.
[98] Πρόσωπον heißt im älteren Griechisch Gesicht, später in Athen Maske. Aristoteles hat das Wort in der Bedeutung „Persönlichkeit“ noch nicht gekannt. Erst der juristische Ausdruck persona, der ursprünglich die Theatermaske bedeutet, hat in der Kaiserzeit auch dem griechischen πρόσωπον den prägnanten römischen Sinn gegeben.
[99] Die eleusinischen Mysterien enthielten durchaus keine Geheimnisse. Jeder wußte, was dort vorging. Aber sie wirkten mit einer geheimnisvollen Erschütterung auf die Gläubigen und man „verriet“, man entweihte sie, wenn man ihre heiligen Formen außerhalb der Tempelstätte nachahmte.
[100] Die große Masse der Sozialisten würde sofort aufhören es zu sein, wenn sie den Sozialismus der neun oder zehn Menschen, die ihn heute in seinen äußersten historischen Konsequenzen begreifen, auch nur von fern verstehen könnte.
[101] Mit dem vom Maler gewählten Standort des Betrachters vor dem Bilde ist der Konvergenzpunkt im Bilde notwendig bestimmt. Für die chinesische Perspektive besteht dieser Zusammenhang nicht.
[102] Nach dem Rande zu nimmt bei wachsender Stärke des Fernrohres die Zahl der neuerscheinenden Sterne rasch zu.
[103] Das Berauschende großer Zahlen ist ein bezeichnendes Erlebnis, das nur der Mensch des Abendlandes kennt. In der gegenwärtigen Zivilisation spielt gerade dies Symbol, die Leidenschaft für Riesensummen, für unendlich große und unendlich kleine Messungen, für Rekorde und Statistiken eine ungewöhnliche Rolle.
[S. 465]
Damit ist endlich das Phänomen der Moral — als der Interpretation des Lebens durch sich selbst — verständlich geworden. Hier ist die Höhe erreicht, von der aus ein freier Umblick über dies weiteste und bedenklichste aller Gebiete menschlichen Nachdenkens möglich ist. Aber gerade hier tut eine Objektivität not, zu der sich bisher niemand ernstlich verstanden hat. Mag Moral zunächst sein, was sie will; ihre Analyse darf nicht selbst der Teil einer Moral sein. Nicht was wir tun, was wir erstreben, wie wir werten sollen, führt auf das Problem, sondern die Einsicht, daß diese Fragestellung ihrer Form nach bereits ein Symptom ausschließlich des abendländischen Weltgefühls ist.
Der westeuropäische Mensch steht hier unter dem Einfluß einer ungeheuren optischen Täuschung, jeder ohne Ausnahme. Alle fordern etwas von den andern. Ein „Du sollst“ wird ausgesprochen in der Überzeugung, daß hier wirklich etwas in einheitlichem Sinne verändert, gestaltet, geordnet werden könne und müsse. Der Glaube daran und an das Recht dazu ist unerschütterlich. Hier wird befohlen und Gehorsam verlangt. Das erst heißt uns Moral. Im Ethischen des Abendlandes ist alles Richtung, Machtanspruch, gewollte Wirkung in die Ferne. In diesem Punkte sind Luther und Nietzsche, Päpste und Darwinisten, Sozialisten und Jesuiten einander völlig gleich. Ihre Moral tritt mit dem Anspruch auf allgemeine und dauernde Gültigkeit auf. Das gehört zu den Notwendigkeiten faustischen Seins. Wer anders denkt, fühlt, will, ist schlecht, abtrünnig, ein Feind. Man bekämpft ihn ohne Gnade. Der Mensch soll. Der Staat soll. Die Gesellschaft soll. Diese Form der Moral[S. 466] ist uns selbstverständlich; sie repräsentiert uns den eigentlichen und einzigen Sinn aller Moral. Aber das ist ja weder in Indien noch in Hellas so gewesen. Buddha gab ein freies Vorbild, Epikur erteilte einen guten Rat. Auch das sind Grundformen hoher — statischer, willensfreier — Moralen.
Wir haben das Exzeptionelle einer moralischen Dynamik gar nicht bemerkt. Gesetzt, daß der Sozialismus, ethisch, nicht wirtschaftlich verstanden, das Weltgefühl ist, welches die eigne Meinung im Namen aller verfolgt, so sind wir ohne Ausnahme Sozialisten, ob wir es wissen und wollen oder nicht. Selbst der leidenschaftlichste Gegner aller „Herdenmoral“, Nietzsche, ist gar nicht fähig, in antikem Sinne seinen Eifer auf sich selbst zu beschränken. Er denkt nur an „die Menschheit“. Er greift jeden an, der es anders meint. Aber Epikur war es herzlich gleichgültig, was andre meinten und taten. Eine Umgestaltung der Menschheit — daran hat er keinen Gedanken verschwendet. Er und seine Freunde waren zufrieden, daß sie so und nicht anders waren. Das antike Lebensideal war die Interesselosigkeit (ἀπάθεια) am Lauf der Welt, gerade an dem, dessen Beherrschung dem faustischen Menschen der ganze Lebensinhalt ist. Der wichtige Begriff der ἀδιάφορα gehört hierher. Es gibt auch einen moralischen Polytheismus in Hellas. Aber der ganze Zarathustra — angeblich jenseits von Gut und Böse stehend — atmet die Pein, die Menschen so zu sehen, wie man sie nicht haben will, und die tiefe, so ganz unantike Leidenschaft, das Leben auf ihre Änderung, im eignen, einzigen Sinne natürlich, zu verwenden. Und eben das, die allgemeine Umwertung, ist ethischer Monotheismus, ist Sozialismus. Alle Weltverbesserer sind Sozialisten. Folglich gibt es keine antiken Weltverbesserer.
Der moralische Imperativ als Form der Moral ist faustisch und nur faustisch. Es ist völlig belanglos, ob Schopenhauer theoretisch den Willen zum Leben verneint oder ob Nietzsche ihn bejaht sehen will. Diese Distinktionen liegen an der Oberfläche. Sie bezeichnen einen Geschmack, ein Temperament. Wesentlich ist, daß auch Schopenhauer die ganze Welt als Willen fühlt, als Bewegung, Kraft, Richtung; darin ist er der Ahnherr der gesamten ethischen Modernität. Dies Grundgefühl ist bereits[S. 467] unsre ganze Ethik. Alles andre sind Nuancen. Was wir Tat, nicht nur Tätigkeit nennen,[104] ist ein durch und durch historischer, von Richtungsenergie gesättigter Begriff. Es ist die Daseinsbestätigung, die Daseinsweihe einer Art Mensch, dessen Seele die Tendenz auf Zukünftiges besitzt, der die Gegenwart nicht als Punkt an sich, sondern stets als Epoche in einem großen Zusammenhange des Werdens empfindet, und zwar sowohl im persönlichen Sein als im Sein der gesamten Geschichte. Die Stärke und Deutlichkeit dieses Bewußtseins bestimmt den Rang eines faustischen Menschen, aber selbst der unbedeutendste besitzt etwas davon, das seine geringsten Lebensakte nach Art und Gehalt von denen jedes antiken Menschen unterscheidet. Es ist der Unterschied von Charakter und Attitüde, von bewußtem Werden und einfach hingenommenem statuenhaften Gewordensein, von tragischem Wollen und tragischem Dulden.
Vor den Augen des faustischen Menschen, in seiner Welt ist alles Bewegtheit einem Ziele zu. Er selbst lebt unter dieser Bedingung. Leben heißt für ihn kämpfen, sich durchsetzen. Der Kampf ums Dasein als ideale Form des Daseins gehört schon der gotischen Zeit an und liegt ihrer Architektur deutlich genug zugrunde. Das 19. Jahrhundert hat ihm nur eine mechanistisch-utilitarische Fassung gegeben. In der Welt des apollinischen, mythischen, ahistorischen Menschen gibt es keine zielvolle „Bewegung“ — das Werden Heraklits, ein absicht- und zielloses Spiel, ἡ ὁδὸς ἄνω κάτω, kommt hier nicht in Frage —, keinen „Protestantismus“, keinen „Sturm und Drang“, keine ethische, geistige, künstlerische „Umwälzung“, die das Bestehende bekämpfen und vernichten will. Der ionische und korinthische Stil treten ohne den Anspruch auf Alleingeltung neben den dorischen. So findet man sie auf der Akropolis und an Römerbauten verschwistert. Aber selbst die sich so antik gebärdende Renaissance wurde im Kreise Brunellescos als energische und ausschließende Bewegung eingeleitet, in offener Feindschaft gegen[S. 468] die Gotik (die kein einziger der Gründer je in sich überwunden hat). Das Barock hat die Renaissance, der Klassizismus das Barock angefeindet. Selbst das Mönchtum des Abendlandes, wie es Franziskaner und Dominikaner darstellen, erscheint in Gestalt einer Ordensbewegung, sehr im Gegensatz zur frühchristlichen, einsiedlerischen Form der Askese.
Es ist dem faustischen Menschen gar nicht möglich, diese Grundgestalt seines Daseins zu verleugnen, geschweige zu ändern. Jede Auflehnung dagegen setzt sie schon voraus. Wer den „Fortschritt“ bekämpft, hält diese Wirksamkeit doch selbst für einen Fortschritt. Wer für eine „Umkehr“ agitiert, meint damit eine Weiterentwicklung. „Immoral“ — das ist nur eine neue Moral, und zwar mit dem gleichen Anspruch des Vorrangs vor allen andern. Der Wille zur Macht ist intolerant. Alles Faustische will Alleinherrschaft. Für das apollinische Weltgefühl — das Nebeneinander vieler Einzeldinge — ist Toleranz selbstverständlich. Sie gehört zum Stil der willensfremden Ataraxia. Für die abendländische Welt — den einen grenzenlosen Seelenraum, den Raum als Spannung — ist sie Selbsttäuschung oder ein Zeichen des Erlöschens. Der faustische Instinkt, tätig, willensstark, in die Ferne und Zukunft gerichtet, fordert Duldung, d. h. Raum für die eigne Wirksamkeit, aber nur für sie. Man bedenke etwa, welches Maß davon die großstädtische Demokratie der Kirche gegenüber in deren Handhabung religiöser Machtmittel anzuwenden willens ist, während sie für sich schrankenlose Anwendung der eignen fordert und, wenn sie kann, die „allgemeine“ Gesetzgebung daraufhin stimmt. Jede „Bewegung“ will siegen; jede antike „Haltung“ will nur da sein und kümmert sich wenig um das Ethos der andern. Für oder gegen die Zeitströmung kämpfen, Reform oder Umkehr betreiben, aufbauen, umwerten oder zertrümmern — das ist gleichmäßig unantik (und unindisch). Und gerade das ist der Unterschied der sophokleischen und shakespeareschen Tragik, der Tragik des Menschen, der nur da sein, und des Menschen, der siegen will.
Es ist falsch, das Christentum mit dem moralischen Imperativ in Verbindung zu bringen. Nicht das Christentum hat den faustischen Menschen, er hat das Christentum umgeformt. Der Wille zur Macht auch im Moralischen, die Leidenschaft,[S. 469] seine Moral zur allgemeinen zu erheben, sie der Menschheit aufzwingen, alle andersgearteten umdeuten, überwinden, vernichten zu wollen, ist unser eigenstes Eigentum. In diesem Sinne ist — ein tiefer und noch nie begriffener Vorgang — die Moral Jesu ein passiv-geistiges, aus dem magischen Weltgefühl heraus als heilkräftig empfohlenes Verhalten, dessen Kenntnis als eine besondere Gnade verliehen wird, in der gotischen Frühzeit innerlich in eine befehlende umgeprägt worden.[105]
Ethik — das ist endlich das unmittelbare, zur Formel erhobene Gefühl der Seele vom Schicksal, innerlichste, wahllose Deutung der eignen Existenz. Im Urseelentum primitiver Völker regen sich nur dumpfe, dunkle Fragen, aber jede Kultur, jedes erwachende Seelentum gibt dem Leben einen Sinn. Im wachen Bewußtsein des Kulturmenschen haben sich Seele und Welt, Mögliches und Wirkliches als Pole gesondert. Das Schicksalsproblem (das Rätsel der Zeit) taucht auf und der ganze Makrokosmos, die Welt als Ausdruck der Seele, ist die Antwort der Seele auf die Frage nach dem Sinn ihres Seins.
Die antike Seele empfand ihr Schicksal als Moira, blindes, augenblickliches, beziehungsloses Ungefähr. Die Tragödie vernichtete den einzelnen Menschen; die Polis verfügte über ihn nach ihrer jeweiligen Laune. Das Los des Ödipus, Ajas, Herakles war das allgemeine. Die stoische Ethik ist die Antwort darauf: dem Leben Größe im Dulden, einen passiven Heroismus, Leidenschaftslosigkeit (ἀπάθεια), Bedürfnislosigkeit zu geben, ist das Ziel. So ist der Sinn des apollinischen Seins kein Tun, sondern eine Haltung.
[S. 470]
Das faustische Schicksal ist Fügung. Es stellt den Charakter vor Entscheidungen. Die Seele antwortet durch eine Ethik, deren Elemente Tat, Person und Wollen sind, die sich nicht auf die Gebärde des Augenblicks, sondern auf das Leben als Ganzes bezieht. Der „Wille Gottes“, im Gegensatz zum griechischen Neid der Götter — in dieser Vorstellung liegt das Grundgefühl einer historischen Logik des Weltganzen, die sich auch auf die einzelne Biographie erstreckt. Es war gezeigt worden, wie in gleichzeitigen Epochen beider Kulturen Polyklet und Bach ihren Kanon abfaßten, die reine, strenge Theorie der plastischen und der kontrapunktischen Form. Nun wohl: was wir Moral nennen, die Struktur des bewußten eigenen Lebens, sein Stil, unterliegt den Prinzipien dieses Kanons. Alle Moralsysteme des Abendlandes von den Franziskanern und den Idealen des Rittertums an bis auf die Sozialethik und „Herrenmoral“ unserer Tage, so verschieden sie dem Wortlaut nach sein mögen, sind kontrapunktische Gebilde des bewegten, strebenden, im Raume sich verbreitenden, alle antiken Moralen sind Theorien des plastischen, auf die Gegenwart eingeschränkten, ruhenden Lebens.
Aber jede Ethik gehört damit in die Nachbarschaft der großen Künste. Sie ist ganz Form, ganz Ausdruck und Symbol und kann ihrem innersten Wesen nach nie erschöpfend in Begriffen ausgesprochen, am wenigsten in ein System gebracht werden. Das Bedeutendste aller Ethik liegt im Unbewußten. Sie offenbart sich in den schlichtesten Lebensäußerungen, in den unmittelbarsten philosophischen Intuitionen, in der Erscheinung großer, für ihre Kultur bezeichnender Menschen, im tragischen Stil, selbst im Ornament. Der Mäander z. B. ist ein stoisches Motiv; in der dorischen Säule verkörpert sich geradezu das antike Lebensideal. Sie ist deshalb die einzige der antiken Säulenformen, welche der Barockstil unbedingt ausschließen mußte. Man wird sie aus einem sehr tiefliegenden seelischen Grunde auch in der gesamten Renaissancekunst vermieden finden. Sie widerspricht der immanenten Ethik aller nordischen Bauweisen. Wer das verstanden hat, wird auch das subtile Phänomen der in Begriffe gekleideten Moraltheorien — notwendig unvollkommener Formen, die in ehrlichster Meinung oft genug das Gegenteil von dem[S. 471] sagen, was sie sagen wollten oder sollten — als Symbole zweiter Ordnung begreifen und deuten können.
Jetzt lösen sich uralte Rätsel und Verlegenheiten. Es gibt so viel Moralen, als es Kulturen gibt, nicht mehr und nicht weniger. Niemand hat hier eine freie Wahl. So gewiß es für jeden Maler und Musiker etwas gibt, das ihm gar nicht zum Bewußtsein kommt, das die Formensprache seiner Werke von vornherein beherrscht und sie von den künstlerischen Leistungen aller anderen Kulturen unterscheidet, so gewiß hat jede Lebensäußerung eines Kulturmenschen von vornherein, a priori in Kants strengstem Sinne, eine Beschaffenheit, die noch tiefer liegt als alles bewußte Urteilen und Streben und die ihren Stil als den einer bestimmten Kultur erkennen läßt. Der einzelne kann moralisch oder antimoralisch handeln, „gut“ oder „schlecht“ aus dem Urgefühl seiner Kultur heraus, aber die Form seines Handelns ist schlechthin gegeben. Jede Kultur hat ihren eigenen ethischen Maßstab, dessen Gültigkeit mit ihr beginnt und endet. Es gibt keine allgemein menschliche Ethik.
Es gibt also im tiefsten Sinne auch keine wahre Mission und kann keine geben. Jede Moral ist ein Urphänomen, die zum Gesetz gewordne Idee eines Daseins. Sie ist innerhalb einer physiognomisch wohl unterschiedenen Menschenart einfach vorhanden. Man kann sie wecken und theoretisch in eine Lehre fassen, ihren geistigen Ausdruck verändern und verdeutlichen; erzeugen kann man sie nicht. So wenig wir imstande sind, unser Weltgefühl zu ändern — so wenig, daß selbst der Versuch einer Änderung schon in seinem Stile verläuft und es bestätigt, statt es zu überwinden —, so wenig haben wir Gewalt über die ethische Grundform unsres Daseins. Man hat in den Worten einen gewissen Unterschied gemacht und die Ethik eine Wissenschaft, die Moral eine Aufgabe genannt. Es gibt in diesem Sinne keine Aufgabe. So wenig die Renaissance fähig war, die Antike wieder heraufzurufen, und so sehr sie mit jedem antiken Detail nur das Gegenteil apollinischen Weltgefühls zum Ausdruck brachte, eine versüdlichte, eine „antigotische Gotik“ nämlich.[S. 472] so unmöglich ist die Bekehrung eines Menschen zu einer seiner Kultur fremden Moral. Mag man heute von einer Umwertung aller Werte reden, mag man als moderner Großstädter zum Buddhismus, zum Heidentum oder zu einem romantischen Katholizismus „zurückkehren“, der Anarchist für individualistische, der Sozialist für Gesellschaftsethik schwärmen, man tut, will, fühlt dasselbe. Die Bekehrung zur Theosophie oder zum Freidenkertum, die heutigen Übergänge von einem vermeintlichen Christentum zu einem vermeintlichen Atheismus, sind eine Veränderung der Worte und Begriffe, der religiösen oder intellektuellen Oberfläche, nicht mehr. Keine unsrer „Bewegungen“ hat den Menschen verändert.
Die innere Form einer Moral ist das Wesentliche. Ihr programmatischer Inhalt, ihre religiöse, philosophische, wissenschaftliche Farbe, der Wortlaut ihrer Sätze und Bekenntnisse, oft genug mißverstandene Überlieferung, noch häufiger bloße Theorie und leerer Schall, ist Maske. Nur diese äußere Form tritt in jeder Kultur in tausend Arten auf, um die man streiten, zu denen man bekehren, die man annehmen oder „überwinden“ kann. Die eigentliche und unveränderliche Struktur des gesamten faustischen Seins ist eben jenes Unbeschreibliche, das als Kraft, Wille, unendlicher Raum, Streben, Ferne im westeuropäischen Dasein und ihm allein in Erscheinung tritt. Alle Sätze und Formeln der einzelnen Denker, Kirchen, Strömungen, Systeme sind nur Variationen über ein schlechthin gegebenes Thema.
Es ist klar: Das Wort Seele bezeichnet hier jedesmal etwas andres, sobald von einer andern Kultur die Rede ist. Jene apollinische, in ihrer spätesten Fassung stoische Moral ist die einer Seele, welche ihr eigenes Bild im Freskostil entwarf, als eine plastische Gruppe schön geordneter Teile, wie sie Plato beschreibt, ohne Hintergrund (welcher Zukunft, Ferne, Wirksamkeit bedeutet hätte), voller Linie, Nähe und Klarheit. Die faustische, in ihrer Ausgangsform sozialistische Ethik entspricht jenem perspektivischen Seelenbilde aller abendländischen Psychologien, dessen Schwerpunkt in dem unendlichen Horizonte liegt (im Bild „Wille“ genannt), während die anderen psychischen Elemente — nicht Teile, sondern Beziehungskomplexe — „Denken“ und[S. 473] „Fühlen“, sich wie Licht und Schatten der Perspektive einordnen. Eine theoretisch fixierte Moral ist lediglich der Kommentar des zugehörigen Seelenbildes.
Eine strenge Morphologie aller Moralen ist die Aufgabe der Zukunft. Nietzsche hat auch hier das Wesentliche, den ersten Schritt, getan. Aber seine Forderung an den Denker, sich jenseits von Gut und Böse zu stellen, hat er selbst nicht erfüllt. Er wollte Skeptiker und Prophet, Moralkritiker und Moralverkündiger zugleich sein. Das verträgt sich nicht. Man ist nicht Psycholog ersten Ranges, solange man noch Romantiker ist. Und so ist er hier, wie in all seinen entscheidenden Einsichten, bis zur Pforte gelangt, aber vor ihr stehen geblieben. Indes hat es noch niemand besser gemacht. Wir waren bisher blind für den unermeßlichen Reichtum der moralischen Formensprache. Wir haben ihn weder übersehen noch begriffen. Selbst der Skeptiker verstand seine Aufgabe nicht; er erhob im letzten Grunde die eigene, durch persönliche Anlage, durch den privaten Geschmack bestimmte Fassung der Moral zur Norm und maß danach die andern. Die modernsten Revolutionäre, Stirner, Ibsen, Strindberg, Shaw, haben nichts andres getan. Sie verstanden es nur, diese Tatsache — auch vor sich selbst — hinter neuen Formeln und Schlagworten zu verstecken.
Aber eine Moral ist wie eine Plastik, Musik oder Malerei eine in sich geschlossene Formenwelt, die ein Lebensgefühl zum Ausdruck bringt, schlechthin gegeben, in der Tiefe unveränderlich, von innerer Notwendigkeit. Sie ist innerhalb ihrer historischen Sphäre immer wahr, außerhalb immer unwahr. Es war gezeigt worden, daß, wie für den einzelnen Dichter, Maler, Musiker seine einzelnen Werke, so für die großen Individuen der Kulturen die Kunstgattungen als organische Einheit, die ganze Ölmalerei, die ganze Aktplastik, die kontrapunktische Musik, die Reimlyrik Epoche machen und den Rang großer Lebenssymbole einnehmen. In beiden Fällen, in der Geschichte einer Kultur wie im Einzeldasein, handelt es sich um die Verwirklichung von Möglichem. Das innerlich Seelische wird zum Stil einer Welt. Neben diesen großen Formeinheiten, deren Werden, Vollendung und Abschluß eine vorbestimmte Reihe menschlicher Generationen umfaßt und die nach einer Dauer von wenigen Jahrhunderten unwiderruflich[S. 474] dem Tode verfallen, steht die Gruppe der faustischen, die Summe der apollinischen Moralen, ebenfalls als Einheit höherer Ordnung aufgefaßt. Ihr Vorhandensein ist Schicksal, das man hinzunehmen hat; nur die bewußte Fassung ist das Resultat einer Offenbarung oder wissenschaftlichen Einsicht.
Für den, welcher hier sehen gelernt hat, sind deshalb die Formensprache einer Moral und die der zugehörigen Mathematik im tiefsten Grunde identisch. Sie offenbaren beide ein Seelentum, sie verwirklichen beide unbewußte Möglichkeiten, sie gestalten beide etwas Gesetztes, ein „Gesetz“ — von dem religiösen Gehalt der Zahlen war schon die Rede —, mögen sie im einzelnen in religiöser, künstlerischer, praktischer Verkleidung in Erscheinung treten. Die antike Zahl, die Größe, hat Maß und Haltung. Das entspricht der Kalokagathia, dem Ethos des antiken Menschen. Die abendländische Zahl, die Funktion, wird nicht nach ihrem sinnlichen Sein (als Kurve), sondern nach Charakter und Wirkung gewertet. Das ist der Sinn der Analysis. Darin wiederholt sich das Lebensideal des nordischen Menschen, dessen Sein Wirksamkeit ist. Es hat sich wohl noch niemand träumen lassen, daß, was in der heutigen Politik Fortschritt heißt, identisch ist mit dem, was die Physik Prozeß, die Analysis Funktion, der Darwinismus Evolution, die Kirche Rechtfertigung durch die guten Werke, die Psychologie Wille, die Malerei Tiefenperspektive nennt, daß nichts von alledem in irgendeiner andren Kultur vorkommt und daß es sich also lediglich um eine Gruppe von Symbolen eines Seins handelt, das einmal und für einige Jahrhunderte im Bilde der Historie auftaucht und mit diesen Symbolen in kurzer Zeit verschwunden sein wird. Dürfen wir also von einer euklidischen und einer analytischen Ethik reden? Wie wir von einer euklidischen und analytischen Form der Tragödie gesprochen hatten? Der tragische Stil, wie ihn beide Kulturen entwickeln, dringt tiefer in die seelischen Geheimnisse ein als irgendeine geschriebene Ethik, in deren Fassung tausend fremde Motive durcheinanderwirken. Die tragische Attitüde ist der Kern des apollinischen, das tragische Wollen des faustischen Szenenbildes, das unmittelbar den ersehnten Aspekt des Lebens gibt. Hier finden wir zwei entgegengesetzte Arten von Heroismus und jede andere Kultur, sofern sie überhaupt[S. 475] eine Tragödie in die Gruppe der ihr möglichen und also notwendigen Künste eingefügt hat, wie die indische und chinesische, stellt ihnen eine andre zur Seite.
Jede antike Ethik ist also eine Ethik der Gebärde, jede abendländische eine Ethik der Tat. Dem euklidisch-beschaulichen Lebensgefühl steht das analytisch-aktive gegenüber. Das entspricht den mathematischen Symbolen des greifbaren Einzelkörpers und des reinen Raumes, der Wirklichkeit, welche den Sinnen gegeben ist, und der, welche ihnen abgerungen werden muß. Das antike Ideal ist die Hingabe an den Vordergrund in jedem Sinne, an das Jetzt und Hier, an den Leib und die einzelne Stunde; das faustische Ideal ist zu alledem der stärkste Gegensatz. Ihm ist nichts gegeben. Es ist Kampf und Überwindung ohne Ausnahme. Man erinnere sich jener Szene im Faust, in welcher der Sinn eines ganzen Jahrtausends liegt, wo der zur Höhe gereifte Geist dieser Kultur das „Im Anfang war das Wort“ des Evangeliums verdeutscht: „Im Anfang war die Tat.“ Das ist die Umdeutung des frühen Christentums aus dem Magischen ins Nordische.
Jede denkbare antike Ethik gestaltet den einzelnen Menschen, als Leib, als Atom unter Atomen. Alle Wertungen des Abendlandes beziehen sich auf den Menschen, sofern er Wirkungszentrum einer unendlichen Allgemeinheit ist. Ethischer Sozialismus — das ist die Gesinnung der Tat, die durch den Raum in die Ferne wirkt, das Pathos der dritten Dimension, als deren Zeichen das Urgefühl der Sorge, für die Mitlebenden wie für die Kommenden, über dieser ganzen Kultur schwebt. So kommt es, daß im Aspekt der ägyptischen Kultur für uns etwas Sozialistisches, etwas Preußisches liegt. Auf der andern Seite erinnert die Tendenz auf Attitüde, Wunschlosigkeit, statische Abgeschlossenheit des einzelnen für sich an die indische Ethik und den von ihr gestalteten Menschen. Man denke an die sitzenden, „ihren Nabel beschauenden“ Buddhastatuen, denen Zenons Ataraxia nicht so ganz fremd ist. Das ethische Ideal des antiken Menschen war das, zu welchem die Tragödie[S. 476] hinleitete. Die Katharsis, die Entladung der apollinischen Seele von dem, was nicht apollinisch, nicht frei von „Ferne“ und Richtung war, offenbart hier ihren tiefsten Sinn. Man versteht sie nur, wenn man den Stoizismus als ihre reife Form erkennt. Was das Drama in einer feierlichen Stunde bewirkte, wünschte die Stoa über das ganze Leben zu verbreiten: die statuenhafte Ruhe, das willensfreie Ethos. Und weiter: Eben jenes buddhistische Ideal des Nirwana, eine sehr späte Formel, aber ganz indisch und schon von den vedischen Zeiten an zu verfolgen: ist das nicht der Katharsis nahe verwandt? Rücken vor diesem Begriff der ideale antike und der ideale indische Mensch nicht nahe zusammen, sobald man sie mit dem faustischen Menschen vergleicht, dessen Ethik sich ebenso deutlich aus der Tragödie Shakespeares und ihrem dynamischen Schwung begreifen läßt? In der Tat: Sokrates, Epikur und vor allem Diogenes am Ganges — das wäre sehr wohl vorstellbar. Diogenes in einer der westeuropäischen Weltstädte wäre ein bedeutungsloser Narr. Und andrerseits, Friedrich Wilhelm I., das Urbild eines Sozialisten in großem Sinne, ist in dem Staat am Nil immerhin denkbar. Im perikleischen Athen ist er es nicht.
Hätte Nietzsche etwas vorurteilsfreier und weniger von einer romantischen Schwärmerei für ethische Schöpfungen bestimmt seine Zeit beobachtet, so würde er bemerkt haben, daß eine, vermeintlich spezifisch christliche Mitleidsmoral auf dem Boden Westeuropas tatsächlich gar nicht besteht. Man muß sich durch den Wortlaut humaner Formeln nicht über ihre faktische Bedeutung täuschen lassen. Zwischen der Moral, die man hat, und der, die man zu haben glaubt, besteht ein sehr schwer aufzufindendes und höchst variables Verhältnis. Gerade hier wäre eine subtile Psychologie am Platze gewesen. Mitleid ist ein gefährliches Wort. Es fehlt noch an einer Untersuchung darüber, was man zu verschiedenen Zeiten darunter verstanden und darunter gelebt hat. Man darf heute sagen, daß Nietzsche sich hier jedesmal vergriffen hat. Die christliche Moral zur Zeit des Origenes ist etwas ganz anderes als die zur Zeit des Franz von Assisi. Es ist hier nicht der Ort zu untersuchen, was faustisches Mitleid als sakraler oder rationaler Begriff und als wirksames Lebensgefühl im Unterschiede von orientalisch-christlichem,[S. 477] fatalistischem, laszivem Mitleid bedeutet, inwiefern es als Wirkung in die Ferne, als praktische Dynamik aufzufassen ist und andrerseits als Opfer einer stolzen Seele in naher Verwandtschaft mit der Gesinnung gotischer Dombauten oder wieder als Äußerung eines überlegenen Distanzgefühls. Der unveränderliche Schatz ethischer Wendungen, wie ihn das Abendland seit der Renaissance besitzt, hat eine unermeßliche Fülle verschiedener Gesinnungen von sehr verschiedenem Gehalt zu decken. Der Oberflächensinn, an den man glaubt, das bloße Wissen um Ideale ist unter so historisch und retrospektiv angelegten Menschen, wie wir es sind, ein Ausdruck der Ehrfurcht vor Vergangenem, in diesem Falle der religiösen Tradition. Aber Überzeugungen sind nie der Maßstab für ein Sein. Sie sind immer etwas volkstümlicher und bleiben weit hinter der Tiefe der seelischen Wirklichkeit zurück. Die theoretische Verehrung neutestamentlicher Satzungen steht in der Tat mit der theoretischen Hochschätzung der antiken Kunst durch die Renaissance und den Klassizismus auf einer Stufe. Die eine hat so wenig den Menschen, wie die andre den Geist der Werke umgewandelt. Die stets genannten Beispiele der Bettelorden, der Herrnhuter, der Heilsarmee beweisen schon durch ihre geringe Zahl, noch mehr durch ihr geringes Gewicht, daß sie den Ausnahmefall von etwas ganz anderm, der eigentlich faustisch-christlichen Moral nämlich, darstellen. Man wird ihre Formulierung allerdings bei Luther und im Tridentinum vergeblich suchen, aber alle Christen großen Stils, Innozenz III. und Luther, Loyola und Savonarola, trugen sie im Widerspruch zu ihren Lehrmeinungen in sich, ohne daß sie das je bemerkt hätten.
Man braucht nur den rein abendländischen Begriff jener männlichen Tugend, der durch Nietzsches „moralinfreie“ virtù recht gut bezeichnet ist, mit jener sehr weiblichen ἀρετή des hellenischen Ideals zu vergleichen, als deren Praxis immer die Genußfähigkeit (ἡδονή), Gemütsruhe (γαλήνη, ἀπάθεια), Bedürfnislosigkeit und vor allem immer wieder die ἀταραξία zum Vorschein kommt. Was Nietzsche die blonde Bestie nannte und was er in dem von ihm sehr überschätzten Typus des Renaissancemenschen verkörpert fand (der nur ein raubkatzenhafter[S. 478] Nachklang der großen Deutschen der Staufenzeit war) — ja, das ist doch das strengste Gegenteil des Typus, den ohne Ausnahme alle antiken Ethiken gewünscht und alle antiken Menschen von Bedeutung verkörpert haben. Dahin gehören die Menschen von Granit, von denen die faustische Kultur eine lange Reihe vorüberziehen sah, die antike nicht einen einzigen. Denn Perikles und Themistokles waren weiche Naturen im Sinne attischer Kalokagathie, Alexander war ein Schwärmer, der nie aufgewacht ist, Cäsar war ein kluger Rechner; Hannibal, der Fremde, der Semit, war der einzige „Mann“ unter ihnen. Die Menschen der Frühzeit, auf die man aus Homer schließen darf, diese Odysseus und Ajax hätten sich neben der Ritterschaft der Kreuzzüge sehr merkwürdig ausgenommen. Es gibt auch eine Brutalität als Rückschlag sehr femininer Naturen. Hier im Norden aber erscheinen an der Schwelle der Frühzeit die großen Sachsen-, Franken- und Staufenkaiser, umgeben von einer Schar riesenhafter Menschen wie Heinrich dem Löwen und Gregor VII. Es folgen die Menschen der Renaissance, der Hugenottenkriege, die spanischen Konquistadoren, die preußischen Kurfürsten und Könige, Napoleon, Bismarck. Wo gab es eine zweite Kultur, die dem etwas an die Seite zu setzen hätte? Wo besitzt die ganze hellenische Geschichte eine Szene von der Mächtigkeit jener von Legnano, wo der Zwist zwischen Staufen und Welfen zum Ausbruch kam? Die germanischen Recken der Völkerwanderung, spanische Ritterlichkeit, preußische Disziplin, napoleonische Energie — das alles hat wenig Antikes. Und wo findet sich auf den Höhen faustischen Menschentums von den Kreuzzügen bis zum Weltkrieg jene „Sklavenmoral“, jene weiche Entsagung, jene Caritas im Betschwesternsinne? In den Worten, die man achtet, nirgends sonst. Ich denke da auch an die Typen des faustischen Priestertums, an jene prachtvollen Bischöfe der Kaiserzeit, die hoch zu Roß in wilden Schlachten ihre Leute anführten, an die Päpste, denen Heinrich IV. und Friedrich II. unterlagen, an den Deutschritterorden in den Ostmarken, an den Luthertrotz, in dem sich altnordisches Heidentum gegen altrömisches aufbäumte, an die großen Kardinäle Richelieu, Mazarin und Fleury, die Frankreich geschaffen haben. Das ist faustische Moral. Man muß blind sein, um[S. 479] diese unbändige Lebenskraft nicht im gesamten Bilde der westeuropäischen Geschichte wirksam zu finden. Und man denke auch, auf einem ganz andern Gebiete, an die Energie riesenhafter Konzeptionen bei Dante, Wolfram, Shakespeare, Bach, Beethoven, an die technischen, in diesem Umfange nur in Ägypten wiederkehrenden Probleme, welche die gotischen Baumeister sich gestellt haben und an die, welche sich ihre Nachfolger, die modernen Ingenieure, zu stellen wagen, denen die Antike nichts zu vergleichen hat. Das sind nicht Ausnahmen, das ist der Geist dieser Kultur, ihre praktische Lebensgesinnung, neben der sich die vielbewunderte attische Lebendigkeit mit ihren vorsichtigen Idealen von Maß und Haltung etwas schattenhaft ausnimmt.
Das ist der Grund, weshalb die „Mitleidsmoral“ im faustischen Norden immer respektiert, zuweilen von Denkern angezweifelt, zuweilen gewünscht, aber niemals realisiert worden ist. Kant hat sie mit Entschiedenheit abgelehnt. In der Tat steht sie in innerstem Widerspruch zum kategorischen Imperativ, der den Sinn des Lebens in der Tat, nicht im Fühlen sieht. Die Beweisführung Nietzsches ist noch deutlicher, allerdings sehr gegen seine Absicht. Was er Sklavenmoral nennt und unter welcher ganz unzutreffenden Bezeichnung er „das Christentum“ in Bausch und Bogen kritisiert, ist ein Phantom. Seine Herrenmoral ist eine Realität. Sie brauchte nicht erst entworfen zu werden; sie ist vorhanden. Nimmt man die romantische Borgiamaske hinweg und jene nebelhaften Visionen vom Übermenschen, so bleibt der faustische Mensch selbst übrig, wie er heute existiert, als Typus einer energischen, imperativischen, hochintellektuellen Zivilisation. Wir haben da ganz einfach den Realpolitiker, den Geldmagnaten, den großen Ingenieur und Organisator. „Eine höhere Art Menschen, welche sich, dank ihrem Übergewicht von Wollen, Wissen, Reichtum und Einfluß, des demokratischen Europas bedienen als ihres gefügigsten und beweglichsten Werkzeuges, um die Schicksale der Erde in die Hand zu bekommen, um am ‚Menschen‘ selbst als Künstler zu gestalten. Genug, die Zeit kommt, da man über Politik umlernen wird.“ So heißt es in einer der Nachlaßaufzeichnungen, die viel konkreter sind als die ausgeführten Werke. „Wir[S. 480] müssen entweder politische Fähigkeiten züchten oder durch die Demokratie zugrunde gehen, die uns die mißglückten älteren Alternativen aufgezwungen haben“, heißt es bei Shaw (Mensch und Übermensch). Shaw, der vor Nietzsche die praktische Schulung und den geringern Grad von Ideologie voraus hat, so beschränkt sein philosophischer Horizont erscheint, hat in „Major Barbara“ in der Gestalt des Milliardärs Undershaft das Übermenschenideal in die unromantische Sprache der neuern Zeit übertragen, aus der es, auf dem Umweg über Malthus und Darwin, auch bei Nietzsche wirklich stammt. Diese Tatsachenmenschen großen Stils sind es, welche heute den Willen zur Macht und damit die faustische Ethik überhaupt repräsentieren. Der Schluß des zweiten Teils vom Faust erschließt den tieferen Zusammenhang. Diese früheste dichterische Konzeption des zivilisierten Europäers ist noch heute nicht wieder erreicht worden. Hier findet sich nichts Negatives. Tat, Wille, Überwindung ist alles. Es gibt einen Punkt, wo Philanthropie abgeschmackt wird. Menschen dieser Art werfen ihre Millionen nicht zur Befriedigung eines uferlosen Wohltuns hinaus, für die Träumer, „Künstler“, Schwachen, Schlechtweggekommenen; sie verwenden sie für die, welche als Material für die Zukunft mitzählen. Sie verfolgen mit ihm ein Ziel. Sie schaffen ein dynamisches Zentrum, das die Grenzen des persönlichen Daseins überdauert. Auch das Geld kann Ideen entwickeln und Geschichte machen. So hat Rhodes, in dem sich ein sehr bedeutungsvoller Typus des 21. Jahrhunderts ankündigt, sein Vermögen testamentarisch angelegt. Es ist flach und beweist die Unfähigkeit, Geschichte innerlich zu begreifen, wenn man das literarische Geschwätz populärer Sozialethiker und Humanitätsapostel nicht von den wahren ethischen Instinkten der westeuropäischen Zivilisation zu unterscheiden weiß.
Der Sozialismus — in seinem höchsten Sinne, nicht in dem der Gasse — ist wie alles Faustische ein exklusives Ideal, das seine Volkstümlichkeit nur einem vollkommenen Mißverständnis (auch unter den Wortführern) verdankt, daß er nämlich ein Inbegriff von Rechten, nicht von Pflichten, daß er eine Beseitigung, nicht eine Verschärfung des kantischen Imperativs, ein Nachlassen, nicht ein Höherspannen der Richtungsenergie[S. 481] sei. Jene triviale Oberflächentendenz auf Fürsorge, Wohlfahrt, „Freiheit“, Humanität, das Glück der Meisten enthält nur das Negative der Idee, sehr im Gegensatz zum antiken Epikuräismus, dem der glückselige Zustand tatsächlich Kern und Summe alles Ethischen war. Gerade hier liegen äußerlich sehr verwandte Stimmungen vor, die im einen Falle nichts, im andern alles bedeuten. Man kann aus diesem Gesichtspunkt den Inhalt der antiken Ethik ebenfalls als Philanthropie bezeichnen, die der einzelne sich selbst, seinem σῶμα, angedeihen läßt. Hier hat man die Autorität des Aristoteles auf seiner Seite, der genau in diesem Sinne das Wort φιλάνθρωπος gebraucht, an dem sich die besten Köpfe der klassizistischen Zeit, Lessing vor allem, abgemüht haben. Aristoteles bezeichnet die Wirkung der attischen Tragödie auf attische Zuschauer als philanthropisch. Ihre Peripetie erlöst ihn vom Mitleid mit sich selbst. Was bedeutet für uns das populäre Wohltun? Ein faustisches Mitleid mit aller Welt befriedigen, eine ins Weite gehende Erregung des Gemütes stillen, kurz: Katharsis. Das ist Nietzsches Sklavenmoral, nämlich eine Moral mit negativen, antidynamischen Tendenzen. Eine Theorie von Herren- und Sklavenmoral gab es auch im frühen Hellenismus, bei Kallikles z. B., wie sich versteht in streng leiblich-euklidischem Sinne. Das Ideal der ersten ist Alkibiades, der genau das tat, was ihm augenblicklich für seine Person zweckmäßig erschien, Landesverrat, Betrug, Verleumdung nicht ausgeschlossen, eine Lebenshaltung, für die es seinen Zeitgenossen am Talent, sicher nicht am guten Willen fehlte. Man hat ihn als Typus antiker Kalokagathie empfunden und bewundert. Odysseus, die epische Inkarnation des griechischen Menschen, ist ihm ähnlich. Protagoras ist noch deutlicher in seinem berühmten, ganz ethisch gemeinten Satze, daß der Mensch — jeder einzelne für sich — das Maß der Dinge sei. Das ist die Herrenmoral einer statuenhaften Seele.
Für die abendländische Seele kann jene hedonistische Tendenz — denn der Philanthrop faustischen Stils, der Allerweltssozialist, ist Hedonist für „die andern“ — bestenfalls den Sinn einer Befreiung zugunsten ernsterer Notwendigkeiten haben, der Befreiung von trivialleiblichen und sachlichen Beschränkungen[S. 482] der wirtschaftlichen und sozialen Zustände nämlich, insofern sie einer ins Unendliche und Abstrakte greifenden Wirksamkeit im Wege sind. Dies ist der tiefste und von ihrem Urheber nicht entfernt begriffene Sinn der Phrase, daß Eigentum Diebstahl ist. Eigentum — damit war der Besitz im populären Sinne, das Greifbare und Nahe gemeint, das auch der Grieche und Römer als solches, als χρῆμα und res empfunden hat, ein Begriff von statischem Gehalt, der in der Tat vom abendländischen Wirtschaftsleben mehr und mehr und unvermerkt verneint wird. Damit ist das antieuklidische und funktionale Weltgefühl zum schärfsten Ausdruck gelangt.[106] Daß mit dem endlichen Verfall und Erstarren unsres Seelentums — nach einem Höhepunkt intellektueller, sozialistischer Daseinsgestaltung, von deren Schroffheit nach Form und Tendenz, von deren Tyrannei, mit welcher der allgemeine Wille zur Macht auf jedem einzelnen lastet, sich schwerlich heute jemand einen Begriff macht — zuletzt doch die negative Seite allein übrig bleiben und Europa, wie Goethe fürchtete, als „Lazarett von Medizinern“ in Erscheinung treten wird, ist unwahrscheinlich. Der Endzustand der dynamischen Entwicklung wird ein äußerst positiver Ägyptizismus, ein auf die Spitze getriebenes Mandarinentum sein, in dem jeder Sklave, Beamter, ein funktionales Element ist, eine politisch-geistige Form, auf welche die seelische Verwandtschaft der faustischen zur ägyptischen und chinesischen Kultur schließen läßt, etwas Starres, Unfruchtbares, voller Plan und Ziel, aber nichts weniger als „human“ oder „liberal“ im heutigen hoffnungsvollen Sinne.
Das Phänomen der Ethik steht, ganz morphologisch betrachtet, dem der Logik gegenüber. Das sind die zwei möglichen Arten, ein Weltgefühl geistig zu realisieren, sich zur Welt in Beziehung zu setzen. Erinnern wir uns des letzten und äußersten Gegensatzes im wachen menschlichen Bewußtsein, der am Anfang durch die Urworte Werden und Gewordnes bezeichnet[S. 483] war. Von ihm aus begreift man das Verhältnis von Ethik und Logik. Ethisch ist die Form des Werdens, des Lebens, logisch die des Gewordnen, des Erkannten. Das Merkmal der Richtung, wie es durch die Worte Zeit, Schicksal, Zukunft angedeutet wird, liegt allem Ethischen zugrunde, das Merkmal der Ausdehnung — mittels der Ursymbole des Raumes, des Körpers — dem Logischen. Die tiefe Beziehung, ja Identität von Denken und Ausdehnung oder, wenn man will, von Geist und Objekt ist niemals zweifelhaft gewesen. Eine gleiche besteht zwischen Leben und Richtung. Ethik und Logik verhalten sich wie das Mögliche zum Wirklichen, wie das Leben zum Tode. Die Logik ist starr. Sie macht erstarren. Sie gilt nur im Bereich des Erstarrten. Man nennt das ihre ewigen Gesetze. Die Ethik hat keine Gesetze. Sie lebt. Sie gestaltet das Leben. In dieser Klarheit ist der Gegensatz zweier Formenwelten, welche das gesamte bewußte Sein ohne Rest unter sich verteilen, nur im höhern Menschentum vorhanden. Der Urmensch bleibt in dunklen Gebräuchen und Vorstellungen befangen. Sein Logisches, sein Denken, Erkennen, Verstehen bewegt sich in ebenso ungeordneten Bahnen, wie seine Sitte in bruchstückhaften Andeutungen einer ornamentalen — zeremoniellen — Struktur. Erst innerhalb reifer, durchgeistigter Kulturen erhält das Leben wie das Denken einen ganz bestimmten und innerlich notwendigen Stil. Das große Rätsel des Lebens, das gefühlte Gerichtetsein, die Idee eines Schicksals kleidet sich in ein Moralproblem und gleichzeitig das Rätsel der Erkenntnis, des Begreifens der äußern Welt im Sinne des Tiefenerlebnisses in ein erkenntnistheoretisch-logisches. Aus diesem Grunde unterschied Kant eine praktische und eine theoretische Vernunft, womit er den Geltungsbereich von Schicksal und Kausalität, von Lebendigem und Starrem, also das formspendende Prinzip des Werdens und des Gewordnen meinte. Er gelangt dort zum kategorischen Imperativ, der Grundform aller faustischen Moralen, hier zur Idee des Raumes als der Form a priori unsrer schöpferischen Anschauung, womit, wie wir sahen, das faustische Ursymbol, das Welterlebnis des westeuropäischen Menschen bezeichnet war. Was beiden Gedanken gemeinsam ist und was ihnen ihre unbezwingliche Gewalt über den modernen Geist verleiht, ist das in ihnen ruhende[S. 484] Grundgefühl des Willens zur Macht, der ethisch wie logisch der Welt seine Gestalt aufzuprägen entschlossen ist.
Man fühlt, wie eine Logik nicht ohne System sein kann, mehr noch, daß sie durch und durch System ist und nichts außerdem, denn Erkanntes und Ausgedehntes sind identisch und Zahlen wie Begriffe besitzen streng extensiven Charakter. Anderseits hat die Wortverbindung „ethisches System“ etwas Widersinniges und Unnatürliches. So gewiß alles Logische räumlich, starr, mechanisch, so gewiß ist alles Ethische reine, lebendige Gestalt. Man kann sie physiognomisch schildern, dramatisch, musikalisch, aber man kann sie nicht in ein Schema bringen. Das unterscheidet Menschenkenntnis von Naturerkenntnis. Die große Kunst und nicht die Wissenschaft wird immer die untrügliche Offenbarung der ethischen Gestalt einer Seele sein. Dies ist der Grund, weshalb Theorien moralischen Inhalts immer ein unzulängliches Bild der Moral geben und weshalb sie auf die lebendige Erscheinung alles Menschlichen ohne Einfluß sind. Eine Ethik als Lehrmeinung vortragen heißt das Wesen der Ethik mißverstehen. Sie bildet nicht, sie ist nur der Ausdruck einer Bildung. Sie ist nicht Vorbild und Ziel, sondern Form und Art des sich entwickelnden Seins. Ich erinnere wieder an den Gegensatz zweier Welten, der Geschichte und der Natur, in deren Bilde das Werden oder das Gewordne vorwaltet. Die Geschichte, das sich Vollendende, besitzt eine ethische, die Natur, das Vollendete, eine logische Struktur. Ethik und Logik: so stehen sich Organisches und Mechanisches, Schicksal und Kausalität, Physiognomik und Systematik, Lebenserfahrung und wissenschaftliche Erfahrung gegenüber. Gut und böse — das ist die gestaltende Polarität des Lebensgefühls; wahr und falsch ist die des Weltbewußtseins. In seinen ethischen Instinkten, die sich im Stil des äußern Lebens, im Tragischen, selbst in der leiblichen Erscheinung, am unvollkommensten sicherlich in Begriffen und Thesen offenbaren, berührt der Mensch das Mögliche in sich, das nach Gestaltung drängt, die ewige Zukunft; in der Logik formt er das Wirkliche, das sich geistig gestaltet hat, das Fremde, dem Leben bereits entfremdete, die ewige Vergangenheit.
Es ist die Gefahr des gebornen Denkers wie Kant und Aristoteles, die Ethik zu logisieren, sie aus Begriffen, Schlüssen,[S. 485] Gesetzen aufzubauen, ebenso wie er die lebendige Geschichte — zugunsten eines Systems — mechanisiert. In keiner systematischen Philosophie findet die wirkliche Geschichte Platz. Das haben hundert mißglückte Versuche, noch zuletzt der gewaltigste von allen, der Hegels, bewiesen. Die Gefahr des Dichters wie Plato, Goethe, Schelling, der kein System konstruiert, sondern Lebendiges nachbildet, ist es, die Logik zu ethisieren, wie er die Natur in ein phantastisches Wesen auflöst und Begriffe durch Bilder verdrängt. Diese letzte, die ethische Durchdringung der Natur, bezeichnet auch den Geist jugendlicher Kulturen, die von Leben überströmen wie die Zeiten Plotins und Dantes. Das erste, der Trieb nämlich, die Ethik logisch, die Geschichte mechanisch, beide also künstlich und verstandesmäßig, als tote Objekte zu gestalten, ist ein Symptom sterbender, in zivilisierter Form erstarrender Kulturen. Wir werden sehen, daß Stoizismus und Sozialismus im engern Sinne logisierte, aus einem Mangel, nicht aus der Fülle erwachsene Ethiken sind, nicht Lebensformen, die man hat, sondern solche, die man braucht. Sie entstehen in der Nachbarschaft zahlloser Tendenzen, die auch das Historische, den Staat— „Gesellschaftsordnung“ ist ein bezeichnendes Wort dafür — künstlich in Szene setzen, konstruieren wollen. Leben und Konstruktion aber schließen sich aus. Logisch, anorganisch, mechanisch ist das Gewordene, das nicht mehr Lebende, der Tod. Ethische Probleme, die wirklich als Probleme, als Fragen und Verlegenheiten, aufgestellt und empfunden werden, verraten, daß das Leben selbst fraglich geworden ist.
Die Weltsehnsucht der abendländischen Seele knüpft sich an das Bild des raumbeherrschenden Willens, wie die der hellenischen an das Ideal vollkommener, ruhender Leiblichkeit. Deshalb wurde das Problem der Willensfreiheit,[107] das in dieser energischen Fassung nur der faustische Mensch in sich[S. 486] trägt und in dem sich seine ganze metaphysische Leidenschaft nach dem Grenzenlosen, nach Überwindung alles Nur-Sinnlichen, nach Verneinung aller Schranken seines Machtgefühls, nach Geltung und Wirksamkeit ans Licht des wachen Bewußtseins drängt, unser ethisches Hauptproblem, um das sich alle einzelnen Systeme kristallisieren. Es liegt, wenn auch noch so tief verhüllt, jedem unsrer ethischen Weltaspekte, auch den Charaktertragödien Shakespeares im Gegensatz zum Attitüdendrama des Sophokles, auch der sozialistischen Gegenwartsstimmung, die ganz in eine individualistische Farbe getaucht ist, zugrunde. Die innere Gewißheit eines freien Willens ist der gesamten Porträtmalerei seit Lionardo wesenhaft. Rembrandt hat sein ganzes Leben an dies große Mysterium gewandt, und schon Michelangelos Sklaven vom Juliusgrabmal lassen es ahnen. Die Musik Bachs und Beethovens ist die der fromm geglaubten und der düster bezweifelten Willensfreiheit. Der attischen Plastik nackter Leiber ist dieser Wesenskern des faustischen Menschen völlig fremd. Hier gibt es keinen Willen. Hier gibt es also auch kein Bedürfnis, ihm ideelle oder wirkliche Schranken aus dem Wege zu räumen. Die Polis ist nicht das politische Ideal von Menschen, denen dies Problem das schwerste von allen ist. Der freie Wille als „Form der inneren Anschauung“, mit Kant zu reden, steht in einer tiefen Beziehung zur Einsamkeit des faustischen Ich, zum Monologischen seines Daseins und seiner gesamten künstlerischen Äußerungen, wovon die apollinische Seele nichts besitzt.
Als Nietzsche das Wort „Umwertung aller Werte“ zum ersten Male niederschrieb, hatte endlich die seelische Bewegung dieser Jahrhunderte, in deren Mitte wir leben, ihre Formel gefunden. Umwertung aller Werte — das ist der innerste Charakter jeder Zivilisation. Sie beginnt damit, alle Formen der voraufgegangenen Kultur umzuprägen, anders zu verstehen, anders zu handhaben. Sie erzeugt nicht mehr, sie deutet nur um. Darin liegt das Negative aller Zeitalter dieser Art. Sie setzen den eigentlichen Schöpfungsakt voraus. Sie treten nur eine Erbschaft[S. 487] von großen Wirklichkeiten an. Blicken wir auf die späte Antike und prüfen wir dort, wo das entsprechende Ereignis liegt: es hat sich innerhalb des hellenistisch-römischen Stoizismus, innerhalb des langen Todeskampfes der apollinischen Seele also zugetragen. Gehen wir von Epiktet und Mark Aurel zurück auf Sokrates, den geistigen Vater der Stoa, in dem zuerst die Verarmung des antiken, großstädtisch und intellektuell gewordnen Lebens ans Licht trat: zwischen ihnen liegt die Umwertung aller antiken Seinsideale. Blicken wir auf Indien. Als König Asoka lebte, um 300 v. Chr., war die Umwertung des brahmanischen Lebens vollzogen; man vergleiche die vor und nach Buddha niedergeschriebenen Teile des Vedanta. Und wir? Innerhalb des ethischen Sozialismus in dem hier festgelegten Sinne, als der Grundstimmung der erlöschenden faustischen Seele, ist diese Umwertung eben heute im Gange. Rousseau ist der Ahnherr dieses Sozialismus. Rousseau steht neben Sokrates und Buddha, den anderen ethischen Wortführern großer Zivilisationen. Seine Ablehnung aller großen Kulturformen, aller bedeutungsvollen Konventionen, seine berühmte „Rückkehr zur Natur“, sein praktischer Rationalismus gestatten keinen Zweifel. Jeder von ihnen hat eine tausendjährige Innerlichkeit zu Grabe getragen. Sie predigen das Evangelium der Menschlichkeit, aber es ist die Menschlichkeit des intelligenten Stadtmenschen, der die Stadt und mit ihr die Kultur satt hat, dessen „reine“ Vernunft nach einer Erlösung von ihr und ihrer gebietenden Form, von ihren Härten, von ihrer innerlich nicht mehr erlebten und deshalb verhaßten Symbolik sucht. Die Kultur wird dialektisch vernichtet. Lassen wir die großen Namen des 19. Jahrhunderts vorüberziehen, an die sich für uns dies mächtige Phänomen knüpft: Schopenhauer, Hebbel, Wagner, Nietzsche, Ibsen, Strindberg, so überblicken wir das, was Nietzsche in dem fragmentarischen Vorwort zu seinem unvollendeten Hauptwerk beim Namen nannte, die Heraufkunft des Nihilismus. Sie ist keiner der großen Kulturen fremd. Sie gehört mit innerster Notwendigkeit zum Greisenalter dieser mächtigen Organismen. Sokrates war Nihilist, Buddha war es. Es gibt eine ägyptische, arabische, chinesische so gut wie eine westeuropäische Decadence. Es handelt sich nicht um politische und wirtschaftliche,[S. 488] nicht einmal um religiöse oder künstlerische Verwandlungen an sich. Es handelt sich überhaupt nicht um Greifbares, nicht um materielle Fakta, sondern um das Wesen einer Seele, die ihre Möglichkeiten restlos verwirklicht hat. Man wende nicht die großen Leistungen gerade des Hellenismus und der westeuropäischen Modernität ein. Sklavenwirtschaft und Maschinenindustrie, „Fortschritt“ und Ataraxia, Alexandrinismus und moderne Wissenschaft, Pergamon und Bayreuth, soziale Zustände, wie sie die Politeia des Aristoteles und das Kapital von Marx voraussetzen, sind lediglich Symptome im historischen Oberflächenbilde. Es handelt sich nicht um das äußere Leben, um Lebenshaltung, Institutionen, Sitten, sondern um die Tiefe, um den innern Tod. Für die Antike trat er zur Römerzeit ein. Für uns gehört er der Zeit um 2000 an.
Kultur und Zivilisation — das ist der lebendige Leib eines Seelentums und seine Mumie. So unterscheidet sich das westeuropäische Dasein vor 1800 und nach 1800, das Leben in Fülle und Selbstverständlichkeit, dessen Gestalt von innen heraus gewachsen und geworden ist, und zwar in einem mächtigen Zuge von den Kindertagen der Gotik an bis zu Goethe und Napoleon, und jenes späte, künstliche, wurzellose Leben unsrer großen Städte, dessen Formen der Intellekt konstruiert. Kultur und Zivilisation — das ist ein aus der Landschaft geborener Organismus und der aus seiner Erstarrung hervorgegangene Mechanismus. Hier erscheint wieder der Unterschied von Werden und Gewordensein, von Seele und Gehirn, von Ethischem und Logischem, endlich von gefühlter Historie — das ist die Ehrfurcht vor Satzung und Tradition — und erkannter Natur — das ist die vermeintliche Natur, die reine, gleichmachende, vom Bann der großen Form erlösende, zu welcher man zurückkehren will. Buddha verneint den historischen Unterschied von Brahmanen und Tschandala, die Stoiker den von Hellenen, Sklaven und Barbaren, Rousseau den von Privilegierten und Leibeignen. Der Kulturmensch lebt nach innen, der zivilisierte Mensch nach außen, im Raume, unter Körpern und „Tatsachen“. Was der eine als Schicksal empfindet, erscheint dem andern als Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Man ist von nun an Materialist in einem, nur für die Zivilisation gültigen Sinne, ob[S. 489] man es will oder nicht, und ob buddhistische, stoische, sozialistische Lehren sich idealistisch geben oder nicht.
Dem gotischen und dorischen Menschen, dem Menschen der Ionik und des Barock wird die ganze ungeheure Formenwelt von Kunst, Religion, Sitte, Staat, Wissen, Gesellschaft leicht. Er trägt und verwirklicht sie, ohne sie zu kennen. Er besitzt dem Symbolischen der Kultur gegenüber dieselbe ungezwungene Meisterschaft, wie sie Mozart in seiner Kunst besaß. Kultur ist das Selbstverständliche. Das Gefühl einer Fremdheit unter diesen Formen, das einer Last, welche die Freiheit des Schaffens aufhebt, die Nötigung, das Vorhandene rationalistisch zu prüfen, der Zwang des feindseligen Nachdenkens sind die ersten Symptome einer ermattenden Seele. Erst der Kranke fühlt seine Glieder. Daß man eine „natürliche“ Religion konstruiert und sich gegen Kulte und Dogmen auflehnt, daß ein Naturrecht den historischen Rechten entgegengestellt wird, daß man in der Kunst Stile „entwirft“, weil der Stil nicht mehr ertragen und gemeistert wird, daß man den Staat als „Gesellschaftsordnung“, als Mechanismus sieht, den man ändern könne, sogar ändern müsse (und neben Rousseaus contrat social stehen völlig gleichbedeutende Erzeugnisse der Zeit des Aristoteles), das alles beweist, daß etwas endgültig zerfallen ist. Die Weltstadt selbst steht als Extrem von Anorganischem inmitten der Kulturlandschaft da, deren Menschentum sie von seinen Wurzeln löst, an sich zieht und verbraucht.
Wissenschaftliche Welten sind oberflächliche Welten, praktische, seelenlose, rein extensive Welten. Sie liegen den Anschauungen des Buddhismus, Stoizismus und Sozialismus zugrunde.[108] Das Leben nicht mehr mit kaum bewußter, wahlloser Selbstverständlichkeit leben, es als gottgewolltes Schicksal hinnehmen, sondern es problematisch finden, es auf Grund intellektueller Einsichten in Szene setzen, „zweckmäßig“, „vernunftgemäß“ — das ist in allen drei Fällen der Hintergrund. Das Gehirn regiert, weil die Seele abdankte. Kulturmenschen leben unbewußt, Tatsachenmenschen leben bewußt. Das Leben selbst[S. 490] ist eine „Tatsache“. Das im Boden wurzelnde Bauerntum vor den Toren der großen Städte, die jetzt — skeptisch, praktisch, künstlich — allein die Zivilisation repräsentieren, zählt nicht mehr mit. „Volk“ — das ist jetzt Stadtvolk, anorganische Masse, etwas Fluktuierendes. Der Bauer ist nicht Demokrat — denn auch dieser Begriff gehört zum mechanischen, städtischen Dasein —, folglich übersieht, belächelt, verachtet, haßt man ihn. Er ist nach dem Schwinden der alten Stände, Adel und Priestertum, der einzige organische Mensch, eine übriggebliebene Reminiszenz der Kultur. Er findet weder im stoischen noch im sozialistischen Denken einen Platz.
So ruft der Faust des ersten Teils der Tragödie, der leidenschaftliche Forscher in einsamen Mitternächten, folgerichtig den des zweiten Teils und des neuen Jahrhunderts hervor, den Typus einer rein praktischen, weitschauenden, nach außen gerichteten Tätigkeit. Hier hat Goethe psychologisch die ganze Zukunft Westeuropas vorweggenommen. Das ist Zivilisation an Stelle von Kultur, der äußere Mechanismus statt des innern Organismus, der Intellekt als das seelische Petrefakt an Stelle der erloschenen Seele selbst. So wie Faust am Anfang und Ende der Dichtung, stehen sich innerhalb der Antike der Hellene zur Zeit des Perikles und der Römer zur Zeit Cäsars gegenüber.
Solange der Mensch einer in Vollendung begriffenen Kultur einfach vor sich hin lebt, natürlich und selbstverständlich, hat sein Leben eine wahllose Haltung. Das ist seine instinktive Moral, die sich in tausend umstrittene Formeln verkleiden mag, die man aber selbst nicht bestreitet, weil man sie hat. Sobald das Leben ermüdet, sobald man — auf dem künstlichen Boden großer Städte, die jetzt geistige Welten für sich sind — eine Theorie braucht, um es zweckmäßig in Szene zu setzen, sobald das Leben Objekt der Betrachtung geworden ist, wird die Moral zum Problem. Kulturmoral ist die Moral, welche man hat, zivilisierte die, welche man sucht. Die eine ist zu tief, um auf logischem Wege erschöpft zu werden, die andre ist eine Funktion der Logik. Noch bei Kant und Plato ist die Ethik bloße[S. 491] Dialektik, ein Spiel mit Begriffen, die Abrundung eines metaphysischen Systems. Man hätte sie nicht nötig gehabt. Der kategorische Imperativ ist lediglich die abstrakte Fassung dessen, was für Kant gar nicht in Frage stand. Von Zenon und Schopenhauer an gilt das nicht mehr. Da mußte als Regel des Seins gefunden, erfunden, erzwungen werden, was instinktiv nicht mehr gesichert war. An dieser Stelle beginnt die zivilisierte Ethik, die nicht der Reflex des Lebens auf die Erkenntnis, sondern der Reflex der Erkenntnis auf das Leben ist. Man fühlt etwas Künstliches, Seelenloses und Halbwahres in all diesen erdachten Systemen, welche Epochen dieser Art füllen. Das sind nicht mehr innerlichste, beinahe überirdische Schöpfungen, die ebenbürtig neben den großen Künsten stehen. Jetzt verschwindet alle Metaphysik großen Stils, alle reine Intuition vor dem einen, was plötzlich nottut, vor der Konzeption einer praktischen Moral, die das Leben regeln soll, weil es sich selbst nicht mehr regeln kann. Die Philosophie war bis auf Kant, Aristoteles und den Vedanta eine Folge mächtiger Weltsysteme gewesen, in denen die formale Ethik einen bescheidnen Platz fand. Sie wird jetzt Moralphilosophie, mit einer Metaphysik als Folie. Die erkenntnistheoretische Leidenschaft tritt den Vorrang an die praktische Notdurft ab: Sozialismus, Stoizismus, Buddhismus sind Philosophien dieses Stils. Damit ist die Zivilisation eingeleitet. Das Leben war rein organisch gewesen, notwendigster und erfüllter Ausdruck einer Seele; es wird jetzt anorganisch, seelenlos unter der Vormundschaft des Verstandes. Man hat dies — und darin liegt der typische Irrtum im Selbstgefühl aller Zivilisationen — als wachsende Vollendung empfunden. Aber dieser Geist des weltstädtischen Menschentums stellt keine Erhöhung des Seelischen dar, sondern den Rest, der hervortritt, nachdem die ganze organische Fülle des Übrigen erstorben und zerfallen ist.
Die Welt statt aus der Höhe, wie Äschylus, Plato, Dante, Goethe, unter dem Gesichtspunkt der alltäglichen Notdurft und andrängenden Wirklichkeit betrachten, das nenne ich die Vogelperspektive des Lebens mit der Froschperspektive vertauschen. Und eben das ist der Abstieg von der Kultur, zur Zivilisation. Jede Ethik formuliert den Blick der Seele auf ihr[S. 492] Schicksal: heroisch oder praktisch, groß oder gemein, männlich oder greisenhaft. Und so unterscheide ich eine tragische und eine Plebejermoral. Die tragische Moral einer Kultur kennt und begreift die Schwere des Seins, aber sie zieht daraus das Gefühl des Stolzes, es zu tragen. So empfanden Äschylus, Shakespeare und die Denker der brahmanischen Philosophie, so Dante und der germanische Katholizismus. Das liegt in dem wilden Schlachtchoral des Luthertums: „Ein’ feste Burg ist unser Gott“ und das klingt selbst noch in der Marseillaise nach. Die Plebejermoral des Epikur und der Stoa, der Sekten der Buddhazeit, des 19. Jahrhunderts macht einen Schlachtplan zurecht, das Schicksal zu umgehen. Sie sieht in der Welt nicht Gott, sondern einen Inbegriff von Tatsachen. Schicksal — das ist für sie der vom Gehirn zu ermittelnde Nexus von Ursache und Wirkung. Was sie unter Geschichte begreift, lehrt dementsprechend die materialistische Geschichtsauffassung. Es ist eine höchst zweckmäßige Lebensauffassung, welche von nun an die große Vergangenheit unpraktisch findet, sie verhöhnt und belächelt. Darin hatte Nietzsche sicher recht: die attische Tragödie entsprang der Überfülle des Lebens. Das Unvermeidliche mit Würde tragen, dem Schicksal, den Göttern gegenüber Mann und Held bleiben — das war apollinisch gefühlt. Hier hätte er weiter gehen und die Zeiten vergleichen sollen. Was Äschylus groß tat, das tat die Stoa klein. Das war nicht mehr Fülle, sondern Armut, Kälte und Leere des Lebens und die Römer haben diese intellektuelle Kälte und Leere nur zum Großartigen gesteigert. Und dasselbe Verhältnis besteht zwischen dem ethischen Pathos der großen Meister des Barock, Shakespeare, Bach, Kant, Goethe, dem männlichen Willen, innerlich Herr der natürlichen Dinge zu sein, weil man sie tief unter sich weiß, und dem greisenhaften Willen der europäischen Modernität, sie sich — in Gestalt der Fürsorge, der Humanität, des Weltfriedens, der Technik, des Zwangsstaates, des Glückes der meisten — äußerlich aus dem Wege zu schaffen, weil man sich mit ihnen auf derselben Ebene weiß. Auch das ist Wille zur Macht im Gegensatz zur antiken Duldung des Unabwendbaren; auch darin liegt Leidenschaft und Hang zum Unendlichen, aber es ist ein Unterschied zwischen metaphysischer und materieller Größe im Überwinden.[S. 493] Die Tiefe fehlt, das, was der frühere Mensch Gott nannte. Das bedeutet der Niedergang der westeuropäischen Poesie von der Gestaltung letzter Weltgeheimnisse zur Tendenzpoesie dieser Tage mit ihren ephemeren Lösungen sozialer und sexueller Oberflächenprobleme, die das Maximum dessen darstellen, was man noch begreift. Das faustische Weltgefühl der Tat, wie es von den Staufen und Welfen bis auf Friedrich den Großen, Goethe und Napoleon in jedem großen Menschen wirksam war, verflachte zu einer Philosophie der Arbeit, wobei es für das seelische Niveau gleichgültig ist, ob man sie verteidigt oder verurteilt. Der Kulturbegriff der Tat und der zivilisierte — seelenlose — Begriff der Arbeit verhalten sich genau so wie die Haltung des äschyleischen Prometheus zu der des Diogenes. Der eine ist ein Dulder, der andere ist faul. Galilei, Kepler, Newton brachten es zu Taten, der moderne Physiker leistet eine Arbeit. Plebejermoral, triviale Wirklichkeitsmoral auf der Basis des alltäglichen Daseins und des „gesunden Menschenverstandes“ ist es, was trotz aller großen Worte von Schopenhauer bis zu Shaw jeder Lebensbetrachtung zugrunde liegt. Hebbel und Nietzsche, die dem zu widersprechen scheinen, sind nicht Offenbarungen einer echten tragischen Moral; sie wollen es nur sein. Eine Sache verteidigen oder bekämpfen — das sind nur verschiedene Ausdrucksformen derselben innern Bedingungen. Wer heute die Philosophie der Arbeit verneint, ist kein verspäteter Mediceer, sondern ein Snob. Wer das schrankenlose Recht des einzelnen auf den Schild hebt, gibt dem Sozialismus nur eine pikante Wendung. Auch Nietzsche ist ein Dekadent, ein Sozialist, ein Arbeiter. Er hat selbst keinen Zweifel darüber gelassen. Seine Lehre (die von seiner persönlichen Haltung sehr verschieden ist) ist Gegensatz und Umkehrung von etwas anderm, das dennoch zu Recht besteht, nichts innerlich Ursprüngliches. Sein aristokratischer Geschmack, der durch seine darwinistisch-physiologischen Neigungen jeden Augenblick in Frage gestellt wird, ist nichts weniger als wahllos und selbstverständlich, ist vielmehr das gewaltsame Pathos eines verspäteten Faust auf südlichen Bergen, der mit aller Leidenschaft des Nordens sein Schicksal verleugnen, der vom Plebejertum loskommen will, das er in allen Gliedern spürt.
[S. 494]
Der Abstieg von der Vogel- zur Froschperspektive in den großen Fragen des Lebens verkleidet sich in die Maske jener berühmten „Rückkehr zur Natur“, die jede Kultur in einer eignen Gestalt kennt und deren faustische Fassung Rousseau gegeben hat. Man braucht nicht notwendig an soziale Wandlungen zu denken, auch die Kunst vollzieht eine Rückkehr zur Natur. Man vergegenwärtige sich, wie dem Auftreten der ionischen neben der dorischen Säulenordnung — dem Übergang von heroischer Größe zu bürgerlicher Anmut, von der antiken Gotik zum antiken Rokoko — der weitere Abstieg zur korinthischen Säule, der zivilisierten Erfindung des Kallimachos, folgt. Auch das ist Rückkehr zur Natur, die das unverhüllte Motiv der Pflanze wieder heraufrief als Zeichen pflanzenhaften Daseins, zugleich ein Symptom sinkender Gestaltungskraft, die diesen letzten schöpferischen Geschmack der Antike neben die klassizistische Baukunst der Goethezeit, das Empire, stellt. Die groß gesehene, groß empfundene Natur, das Weltbild, das durch und durch von Seele erfüllt ist, beginnt der „natürlichen“, brutalen, begriffenen Natur zu weichen. Was die Antike durch die historische Folge der drei Säulenordnungen mit seltener Klarheit gestaltete, ist der Weg von früher zu später Kultur und von da zur Zivilisation, der Weg von der Kunst als Religion zur Kunst als Wissenschaft.
Wenn im Bereiche der Kunst irgendwo der Begriff Natur auftaucht, so stellt er jedesmal einen Gegenbegriff im eigentlichsten Sinne dar, die geistige Negation von etwas, wogegen das Leben sich auflehnt, eine Größe, die der Widerspruch geprägt und gestaltet hat. Die „Natur“ der Empfindsamen bedeutete eine schüchterne Auflehnung gegen den großen Stil, den man nicht mehr ertrug. Die Natur Rousseaus ist bereits ein Bild, das als Negation der Kultur überhaupt konzipiert ist. Was die große Stadt, die vornehme Gesellschaft, der absolute Staat, die Metaphysik, die formstrenge Kunst nicht sind — das ist Natur. „Kultur“ erscheint jetzt als die große Krankheit des natürlichen Menschen. Der Philosoph, der Politiker, der Künstler hassen sie, und weil die Jahrhunderte hoher Kultur Geschichte im höchsten Sinne, die eigentliche Geschichte des Menschen[S. 495] sind, so empfindet man diese eingebildete Natur als das Antihistorische, als das, was die Gehirne von dem Alpdruck der großen Vergangenheit befreit. Folgerichtig gehört zu ihr neben der träumerischen Sehnsucht nach Alpengipfeln, Urwäldern und Wüsten jener antihistorische Naturmensch, der den contrat social voraussetzt und der von der städtisch-rationalistischen Einbildungskraft als die fleischgewordene Plebejermoral aus lauter Negationen der tragischen Moral konzipiert wurde. Ob man es will oder nicht, die Vorstellung dieses Menschen liegt der gesamten praktischen Philosophie der ethischen Periode zugrunde. Er ist der geheime Held aller Sozialdramatik von Hebbel bis Ibsen, die mit ihren sozialen und sexuellen Problemen die eigentliche Negation des wahrhaft Tragischen ist. Er ist auch der Held jeder politischen und wirtschaftlichen „Gesellschaftsordnung“, die an Stelle historischer Staatsgebilde in zivilisierten Köpfen spukt. Es ist ein und dasselbe, was die Sophisten in Athen, die Sankhyaphilosophen am Ganges, die Sensualisten in London und Paris innerhalb ihrer Epoche zur Erscheinung bringen. Man empfand die große, allumfassende, den ganzen Reichtum der Seele spiegelnde Form als Last. Man predigte — in allen drei Fällen — die „natürlichen Rechte“ des Menschen gegenüber der Tradition, das heißt gegenüber der nicht mehr zu ertragenden Größe seiner Vergangenheit, das Recht auf die Froschperspektive in Lebensfragen gegenüber der Vogelperspektive der Vorfahren. Daher jener tiefe, rationalistische Haß gegen Autorität und Satzung, jene revolutionäre Sucht — auch bei Nietzsche, auch bei Buddha — sozial, politisch, künstlerisch Gewachsenes zu vermeiden, zu verachten oder zu vernichten und die anorganischen Resultate wissenschaftlicher Analyse an seine Stelle zu setzen, was man in wunderlicher Verdrehung der Fakta als den Ersatz von Künstlichem durch Natürliches bezeichnete, kurz die innere Auflehnung gegen den Makrokosmos, den Inbegriff der Kultur, den der „letzte Mensch“ nicht mehr als eigen empfindet und deshalb in seinen äußeren historischen Resten haßt. Darin liegt die Identität der faustischen „Umwertung aller Werte“ mit dem apollinischen Ideal des Diogenes, die sich lediglich als eine streng dynamische und streng statische Fassung des Nihilismus unterscheiden.
[S. 496]
Jede Kultur hat also ihre eigene Art zu sterben und nur die eine, die aus ihrem ganzen Leben mit tiefster Notwendigkeit folgt. Deshalb sind Buddhismus, Stoizismus, Sozialismus morphologisch gleichwertige Phänomene.
Auch der Buddhismus, dessen letzten Sinn man bisher immer mißverstanden hat. Das ist keine puritanische Bewegung wie der Islam und der Jansenismus, keine Reformation wie die dionysische Strömung gegenüber dem Apollinismus und das Luthertum dem Katholizismus gegenüber, keine neue Religion, überhaupt keine Religion wie die der Veden und des Apostels Paulus,[109] sondern eine letzte rein praktische Weltstimmung müder Großstadtmenschen, die eine abgeschlossene Kultur im Rücken und keine Zukunft vor sich haben; er ist das Grundgefühl der indischen Zivilisation und deshalb mit dem Stoizismus und Sozialismus „gleichzeitig“ und gleichwertig. Die Quintessenz dieser durchaus weltlichen, nicht metaphysischen Gesinnung findet sich in der berühmten Predigt von Benares „Die vier heiligen Wahrheiten vom Leiden“, durch welche der philosophierende Prinz seine ersten Anhänger gewann. Ihre Wurzeln liegen in der rationalistisch-atheistischen Sankhyaphilosophie, deren Theorie stillschweigend vorausgesetzt wird, ganz wie die Sozialethik des 19. Jahrhunderts aus dem Sensualismus und Materialismus des 18. und die Stoa trotz ihrer flachen Verwertung Heraklits von Demokrit, Protagoras und den Sophisten stammt. Die Allmacht der Vernunft ist in jedem Falle der Ausgangspunkt der moralischen Überlegung. Von Religion ist keine Rede. Nichts kann religionsfremder sein als diese Systeme in ihrer ursprünglichen Gestalt. Was aus ihnen in den letzten Stadien der Zivilisation wird, steht hier nicht in Frage.
Der Buddhismus lehnt alles Nachdenken über Gott und die kosmischen Probleme ab. Nur das Selbst, nur die Einrichtung des wirklichen Lebens ist ihm wichtig. Auch eine Seele wird[S. 497] nicht anerkannt. Wie der westeuropäische Psychologe der Gegenwart — und mit ihm der Sozialist — den innern Menschen als Empfindungsbündel, als Häufung chemo-elektrischer Energien abtut, so der indische der Buddhazeit. Der Lehrer Nagasena beweist dem König Milinda, daß die Teile des Wagens, auf dem er fährt, nicht der Wagen selbst und „Wagen“ nur ein Wort ist — ebenso stehe es mit der Seele. Die seelischen Phänomene werden als Skandhas, Haufen, bezeichnet, die vergänglich sind. Das entspricht durchaus den Vorstellungen der Assoziationspsychologie. Es ist viel Materialismus in der Lehre Buddhas. (Es versteht sich, daß jede Kultur ihre eigne, durch ihr gesamtes Weltgefühl in allen Einzelheiten bedingte Art von Materialismus besitzt.) Wie sich der Stoiker den heraklitischen Begriff des Logos aneignet, um ihn materiell zu verflachen, wie der Sozialismus in seinen darwinistischen Grundlagen Goethes tiefen Begriff der Entwicklung (durch Hegels Vermittlung) mechanisch veräußerlicht, so der Buddhismus den brahmanischen Begriff des Karma, des unsrer Denkweise kaum zugänglichen Seinsprinzips, das man oft genug ganz materialistisch als Weltstoff behandelt findet. Noch ein andres Element ist in ihm fühlbar, obwohl man es nie darin gefunden hat: das, was Sokrates und die deutschen Romantiker als Ironie bezeichnen, jene seltsame feine Blüte einer Dialektik, die ihrer selbst müde ist und die bestürzt und schmerzlich lächelnd ihr Werk, das zertrümmerte Weltbild betrachtet.
Wir haben drei Formen des Nihilismus vor uns. Die Ideale von gestern, die großen religiösen, künstlerischen, staatlichen Formen sind abgetan, nur daß selbst dieser letzte Akt der Kultur, ihre Selbstverneinung, noch einmal das Ursymbol ihres ganzen Daseins zum Ausdruck bringt. Der faustische Nihilist, Ibsen wie Nietzsche, Marx wie Wagner, zertrümmert die Ideale, der apollinische, Epikur wie Antisthenes und Zenon, läßt sie vor seinen Augen zerfallen, der indische zieht sich vor ihnen in sich selbst zurück. Der Stoizismus ist auf ein Sichverhalten des einzelnen gerichtet, auf sein statuenhaftes, rein gegenwärtiges Sein, ohne Beziehung auf Zukunft und Vergangenheit oder auf andre. Der Sozialismus ist die dynamische Behandlung des gleichen Themas: dieselbe pessimistische Tendenz nicht auf die Größe, sondern die praktische Not des Lebens, aber mit[S. 498] einem mächtigen Zug ins Ferne auf die gesamte Zukunft und die gesamte Masse der Menschen erstreckt, die dem Prinzip unterworfen werden sollen; der Buddhismus, den nur ein religionspsychologischer Dilettant mit dem Christentum vergleichen kann,[110] ist durch die Worte abendländischer Sprachen kaum wiederzugeben. Es ist erlaubt, von einem stoischen Nirwana zu reden und auf die Gestalt des Diogenes zu verweisen; auch der Begriff eines sozialistischen Nirwana ist zu rechtfertigen, sofern man die Flucht vor dem Kampf ums Dasein ins Auge faßt, wie die europäische Müdigkeit sie in die Schlagworte Weltfrieden, Humanität und Verbrüderung aller Menschen kleidet. Aber nichts von dem reicht an den unheimlich tiefen Begriff des buddhistischen Nirwana heran, der in unserm Denkvermögen nicht zu realisieren ist. Es scheint, daß die Seele alter Kulturen in ihren letzten Verfeinerungen und sterbend wie eifersüchtig auf ihr eigenstes Eigentum, ihren Gehalt an Form, auf das mit ihr geborene Ursymbol ist. Es gibt nichts im Buddhismus, das „christlich“ sein könnte, nichts im Stoizismus, das im Islam von 1000 n. Chr. vorkommt, nichts was Konfuzius mit dem Sozialismus gemein hätte. Der Satz: si duo faciunt idem, non est idem, der an der Spitze jeder historischen Betrachtung stehen sollte, die es mit lebendigem, nie sich wiederholendem Werden und nicht mit logisch, kausal und zahlenmäßig ergreifbarem Gewordnen zu tun hat, gilt ganz besonders von diesen, eine Kulturbewegung abschließenden Äußerungen. In allen Zivilisationen wird ein durchseeltes Sein von einem durchgeistigten abgelöst, aber dieser Geist ist in jedem einzelnen Falle von andrer Struktur und der Formensprache einer andern Symbolik unterworfen. Gerade bei aller Einzigkeit des Seins, das in der Tiefe, im Unbewußten wirkend diese späten Gebilde der historischen Oberfläche schafft, ist deren Verwandtschaft der historischen Stufe nach von entscheidender Bedeutung. Was sie zum Ausdruck bringen, ist verschieden, daß sie es so zum Ausdruck bringen, kennzeichnet sie als „gleichzeitige“[S. 499] Phänomene. Stoisch wirkt der Verzicht Buddhas, buddhistisch der stoische Verzicht auf das volle resolute Leben. Auf das Verhältnis der Katharsis des attischen Dramas zur Idee des Nirwana war schon hingewiesen worden. Man hat das Gefühl, als sei der Sozialismus, obwohl ein ganzes Jahrhundert sich schon seiner ethischen Durchbildung widmete, noch heute nicht in der klaren, harten, resignierten Fassung, die seine endgültige sein wird. Vielleicht werden die ersten Jahrzehnte nach dem großen Kriege ihm die reife Formel geben, wie sie Chrysipp der Stoa gab. Aber stoisch wirkt schon heute — in den höheren Sphären — seine Tendenz zur Selbstzucht und Entsagung aus dem Bewußtsein einer großen Bestimmung heraus, das römisch-preußische, höchst unpopuläre Element in ihm, und buddhistisch seine Geringschätzung eines augenblicklichen Behagens (des „carpe diem“); epikuräisch erscheint sicherlich das populäre Ideal, dem er ausschließlich die Wirksamkeit nach unten verdankt, jener Kultus der ἡδονή, nicht des einzelnen für sich, sondern der Ganzheit.
Gemeinsam ist die Lebensgestaltung aus dem Bewußtsein statt aus dem Unbewußten. Jetzt liegt das verinnerlichte Leben weit zurück, das mit dem wahllosen Ausdruck eines Weltgefühls zusammenfiel. Hier ist kein Ausdruck mehr nötig und möglich, denn die Seele hat sich erschöpft und das in ihr liegende Mögliche ist restlos Wirklichkeit geworden. Aber der Trieb besteht fort und ergreift das durchgeistigte Bewußtsein und so entstehen Formen einer ganz andren Art von menschlichem Dasein, ein Leben voller Kausalität statt von einem Schicksal getragen, nach Grundsätzen der Zweckmäßigkeit geregelt statt von innerer Notwendigkeit gestaltet, erkannt statt gefühlt. Es gibt keinen größeren Gegensatz als den zwischen einem zivilisierten und einem Kulturmenschen. Selbst der primitive Mensch ist dem der dorischen und gotischen Zeit innerlich nicht so fremd.
Jede Seele hat Religion. Das ist nur ein andres Wort für ihr Dasein. Alle lebendigen Formen, in denen sie sich ausspricht, alle Künste, Dogmen, Kulte, metaphysische, mathematische Formenwelten, jedes Ornament, jede Säule, jeder Vers, jede Idee ist im Tiefsten religiös und muß es sein. Von nun an kann es das nicht mehr sein. Das Wesen aller Kultur ist Religion,[S. 500] folglich ist das Wesen aller Zivilisation Irreligion. Auch das sind zwei Worte für ein und dieselbe Erscheinung. Wer das nicht im Schaffen Manets gegen Velasquez, Wagners gegen Gluck, Lysipps gegen Phidias, Theokrits gegen Pindar herausfühlt, der weiß nichts vom Besten der Kunst. Religiös ist noch die Baukunst des Rokoko selbst in ihren „weltlichsten“ Schöpfungen. Irreligiös sind die Römerbauten, auch die Tempel der Götter. Mit dem Pantheon, der Urmoschee mit dem eindringlich magischen Gottgefühl ihres Innenraums, ist das einzige Stück religiöser Baukunst in das alte Rom geraten. Die Weltstädte selbst sind den alten Kulturstädten gegenüber, Alexandria gegen Athen, Berlin gegen Nürnberg, in allen Einzelheiten bis in das Straßenbild, die Sprache, den trocken intelligenten Zug der Gesichter[111] hinein irreligiös (was man nicht mit antireligiös zu verwechseln hat). Und irreligiös, seelenlos sind demnach auch diese ethischen Weltstimmungen, die durchaus in die Formenwelt der Weltstadtphänomene gehören. Der Sozialismus ist das irreligiös gewordene faustische Lebensgefühl; das besagt auch das vermeintliche („wahre“) Christentum, das der Sozialist so gern im Munde führt und unter dem er etwas wie eine „dogmenlose Moral“ versteht. Irreligiös sind Stoizismus und Buddhismus im Verhältnis zur homerischen und vedischen Religion und es ist ganz Nebensache, ob der römische Stoiker den Kaiserkult billigt und ausübt, der spätere Buddhist seinen Atheismus mit Überzeugung bestreitet, der Sozialist sich freireligiös nennt oder auch „weiterhin an Gott glaubt“.
Dies Erlöschen der lebendigen inneren Religiosität, welche auch den unbedeutendsten Zug des Daseins gestaltet und erfüllt, ist es, was im historischen Weltbilde als die Wendung der Kultur zur Zivilisation erscheint, als das Klimakterium der Kultur, wie ich es früher nannte, als der Moment, wo die seelische Fruchtbarkeit einer Art von Mensch für immer erschöpft ist und die Konstruktion an Stelle der Zeugung tritt. Faßt man das Wort Unfruchtbarkeit in seiner vollen ursprünglichen Schwere, so bezeichnet es das ganze Schicksal des weltstädtischen Gehirnmenschen[S. 501] und es gehört zum Bedeutsamsten der geschichtlichen Symbolik, daß diese Wendung sich nicht nur im Erlöschen der großen Kunst, der großen Denksysteme, des großen Stils, sondern auch ganz materiell in der Kinderlosigkeit und dem Rassentod der zivilisierten, vom Lande abgelösten Schichten ausspricht, ein Phänomen, das in der römischen Kaiserzeit viel bemerkt und beklagt, aber notwendigerweise nicht gemildert werden konnte. Dieses Faktum und seine Folgen für die Geschlechter der Nachgeborenen auszudrücken ist die Aufgabe und der Sinn aller „modernen“ Philosophien seit Buddha, Zenon und Schopenhauer. Und daraus folgt weiter: Wie jede Zivilisation eine eigne ethische Fassung ihrer Existenz besitzt, so hat sie auch nur die eine. Es ist die verstandesmäßige und zweckmäßige, aus der Not, nicht der Fülle geborene Fassung dessen, was bisher im Unbewußten wirksam gewesen war. Das Heraufheben des Unbewußten — Schicksalhaften, Tragischen — an das Licht des geistigen Bewußtseins, wo es zum logischen und kausalen Mechanismus erstarrt: das ist innerhalb einer jeden Philosophie (deren Geschichte jedesmal die Biographie eines Organismus mit Geburt, Jugend, Alter und Tod ist) der Abschluß der metaphysischen und der Anbruch der weltstädtisch-ethischen Periode. Wie ein und dasselbe Weltgefühl sich in der brahmanischen, ionischen, Barockmetaphysik in vielfachen realistischen und idealistischen Konzeptionen offenbart, ohne daß die einzelnen Denker etwas in der Tiefe wirklich Verschiedenes hätten ausdrücken wollen und können, so ist es ein und dasselbe Ideal des bewußten Lebens, das die gesamte Geistigkeit einer Zivilisation in tausend Verkleidungen beschäftigt. Man muß den Stoizismus als Lehrmeinung und als allgemeinen Geist der Zeit unterscheiden. Im letzten Falle schließt er auch Epikur, die Akademiker, Skeptiker und Zyniker ein. Das Ideal des abgeklärten, mit sich allein beschäftigten Weisen ist ihnen gemeinsam. Es sind lediglich Unterschiede des persönlichen Geschmacks und Temperaments innerhalb der antiken Menschlichkeit, die es so oder so formulieren. Und dasselbe gilt im Abendlande. Schopenhauer und Nietzsche, Mitleidsmoral und Herrenmoral, der verneinte und bejahte Wille zum Leben: das ist im tiefsten dasselbe und nur im gedanklichen Stil verschieden. Die Tendenz[S. 502] zum Anarchismus, wie man sie etwa bei Stirner und Ibsen findet, ist lediglich eine Nuance des allgemeinen Sozialismus. Es gehört zu den Unterschieden des privaten Charakters, ob man das faustische Weltgefühl, den Weltanspruch des Ich, das sich mit dem Unendlichen eins weiß, vom Ich oder vom Unendlichen aus, subjektiv oder objektiv, idealistisch oder realistisch also, in eine wissenschaftliche Ordnung bringt. Das erste führt zu einer anarchistischen (individualistischen), das andre zu einer sozialistischen (kollektivistischen) Grundstimmung in Fragen des äußeren Lebens. Die Beschaffenheit des Lebens selbst wird dadurch nicht berührt.
Mit dem Anbruch einer Zivilisation ist das Sittliche also aus einer Gestalt des Herzens zu einem Prinzip des Kopfes geworden, aus einem schlechthin vorhandenen Phänomen zu einem Mittel und Objekt, das man handhabt. Es offenbart sich nicht mehr durch jeden Zug des Lebens, es wird begründet und befolgt.
Angesichts dieser neuen intellektuellen Bildungen darf man über ihr lebendiges Substrat nicht im Zweifel sein, den „neuen Menschen“ nämlich, als der er hoffnungsvoll von allen Niedergangszeiten empfunden worden ist. Es ist der formlos in den großen Städten fluktuierende Pöbel an Stelle des Volkes, die wurzellose städtische Masse, οἱ πολλοί, wie man in Athen sagte, an Stelle des mit der Natur verwachsenen, selbst auf dem Boden der Städte noch bäuerlichen Menschentums einer Kulturlandschaft. Es ist der Agorabesucher Alexandrias und Roms und sein „Zeitgenosse“, der heutige Zeitungsleser; es ist der „Gebildete“, jenes Kunstprodukt einer nivellierenden städtischen Erziehung durch Schule und Öffentlichkeit, damals wie heute; es ist der antike und abendländische Mensch der Theater und Vergnügungsorte, des Sports und der Literatur des Tages. Diese spät erscheinende Masse und nicht „die Menschheit“ ist Objekt der stoischen und sozialistischen Propaganda, und man könnte ihr gleichbedeutende Erscheinungen des ägyptischen Neuen Reiches, des buddhistischen Indien, des konfuzianischen China zur Seite stellen.
Dem entspricht eine charakteristische Form der öffentlichen Wirksamkeit, die Diatribe. Zuerst als spätantike Erscheinung[S. 503] betrachtet, gehört sie zu den Wirkungsformen jeder Zivilisation. Durch und durch dialektisch, praktisch, plebejisch, ersetzt sie die bedeutsame, weithin wirkende Gestalt großer Menschen durch schrankenlose Agitation der Kleinen, aber Klugen, Ideen durch Zwecke, Symbole durch Programme. Das Expansive jeder Zivilisation, der imperialistische Ersatz der Zeit durch den Raum, kennzeichnet auch sie: die Quantität ersetzt die Qualität, die Verbreitung die Vertiefung. Man verwechsle diese hastige Aktivität nicht mit dem faustischen Willen zur Macht. Sie verrät nur, daß ein schöpferisches Innenleben zu Ende und eine geistige Existenz nur nach außen, im Raume, nur materiell aufrecht zu erhalten ist. Die Diatribe gehört notwendig zur „Religion der Irreligiösen“; sie ist deren „Seelsorge“. Sie erscheint als indische Predigt, als antike Rhetorik, als abendländischer Journalismus. Sie wendet sich an die Meisten, nicht an die Besten. Sie wertet ihre Mittel nach der Zahl der Erfolge. Sie setzt anstelle des Denkertums alter Zeiten die intellektuelle männliche Prostitution in Rede und Schrift, wie sie alle Säle und Plätze der Weltstädte füllt und beherrscht. Rhetorisch ist die gesamte Philosophie des Hellenismus, journalistisch der Roman Zolas wie das Drama Ibsens. Man verwechsle diese geistige Prostitution nicht mit dem ursprünglichen Auftreten des Christentums. Die christliche Mission ist in ihrem Wesenskern beinahe immer mißverstanden worden. Aber das Urchristentum, die magische Religion des Stifters, dessen Seele dieser brutalen Aktivität ohne Takt und Tiefe gar nicht fähig war, ist erst durch die hellenistische Praxis des Paulus — bekanntlich unter schroffstem Widerspruch der Urgemeinde — in die lärmende städtische demagogische Öffentlichkeit des Imperium Romanum hineingezogen worden. Mag seine hellenistische Bildung noch so oberflächlich gewesen sein (er war und blieb Jude, nicht Stoiker), sie hat ihn nach außen zu einem Gliede der antiken Zivilisation gemacht. Paulus hat nur die Richtung, nicht die Form seiner Wirksamkeit gewechselt: das bedeutet der Tag von Damaskus. Das „Gehet hin in alle Welt und lehret alle Völker“, gleichviel wem die Worte in den Mund gelegt sind, ist ein Satz von spätantikem, stoischem, zivilisiertem Gepräge, der nicht, wie das früheste Christentum in seiner abgelegenen[S. 504] primitiven Landschaft, eine ertagende Kultur, sondern eine über formlosen Menschenmassen verscheidende Zivilisation kennzeichnet, und der damals als praktische Maxime in alle Zeitreligionen, Isis- und Mithraskult, Neuplatonismus und Manichäismus eingedrungen war, sobald sie aus ihrer östlichen Heimat auf antiken Boden traten. Nicht das Christentum hat sich mittels der Diatribe der antiken Welt bemächtigt, die Antike hat es durch sie sich angeeignet. „Alle Völker“, — damit war durchaus nicht die bäuerliche Bevölkerung des flachen Landes gemeint, die in keiner Zivilisation mitzählt. Christus hatte Fischer und Bauern an sich gezogen, Paulus hielt sich an die Agora der großen Städte und also an die großstädtische Form der Propaganda. Das Wort Heide (paganus) verrät noch heute, auf wen sie zuletzt wirkte. Wie verschieden ist Paulus von Bonifacius! Der tief germanische Bonifaciustyp bedeutet in seiner faustischen Leidenschaft, in Wäldern und einsamen Tälern, etwas streng Entgegengesetztes und ebenso die heitren Zisterzienser mit ihrem Landbau und die Deutschordensritter im slawischen Osten. Das war wieder Jugend, Aufblühen, Sehnsucht inmitten einer bäuerlichen Landschaft. Erst im 19. Jahrhundert erscheint die Diatribe auf diesem mittlerweile gealterten Boden mit allem, was ihr wesenhaft ist, mit der großen Stadt als Basis und der Masse als Publikum. Das echte Bauerntum fällt für den Sozialismus so wenig in den Kreis der Betrachtung wie für Buddha und die Stoa. Erst hier, in den Städten des europäischen Westens, findet der Paulustyp wieder seinesgleichen, mag es sich nun um sektenhafte christliche oder antikirchliche, soziale oder biologische Interessen, um Freidenkertum oder ephemere Religionsstiftereien handeln.
Zenon und Buddha in Ehren. Auch König Asoka und Mark Aurel, mit denen nach Jahrhunderten die letzte Weltstimmung auf den Thron gelangte, gehören zu den posthumen Menschen von innerer Kultur. Aber wir haben auch in beiden Fällen das Bild der Wirkung ins Breite, eben jene buddhistische und stoische Propaganda mit den Scharen platter, schmutziger, zudringlicher Salonphilosophen und Wanderredner, den Massen seichter Flugschriften und Volksbücher, den schlechten Manieren, der gewöhnlichen Gesinnung, den journalistischen Tiraden. Bei[S. 505] Lukian findet man die berühmte Satire, die Wort für Wort auf Indien und die Gegenwart paßt.
Alle antike Philosophie nach Plato und Aristoteles ist Rhetorik. Aller Sozialismus im weitesten Sinne, von Schopenhauers Aufsätzen bis zu Shaws Essais, Nietzsche nicht ausgenommen, ist nach Form und Absicht Journalismus. Die gesamte soziale Dramatik, die Schillers sittliche Leidenschaft ins Leben gerufen hat (die „Schaubühne als moralische Anstalt“ bis auf Ibsen und Strindberg herab), die populäre Naturwissenschaft mit ihren sozialethischen, in die Tierwelt projizierten Hinterabsichten, der sich rasch in humane Stimmungen auflösende Rest von protestantischem Christentum ist es. Der Dichter wird Journalist, der Priester wird Journalist, der Gelehrte wird Journalist. Wie tief diese Form einer jeden zivilisierten Ethik begründet ist, beweist Nietzsche, dem die Zarathustragestalt unter den Händen zu einem Wanderprediger geriet.
Nichts ist für diese entschiedene Wendung zum äußeren Leben, das allein übrig geblieben ist, dem biologischen Faktum, dem das Schicksal nur noch in der Form von objektiven Tatsachen und Kausalitätsbeziehungen erscheint, bezeichnender als das ethische Pathos, mit dem man sich nun einer Philosophie der Verdauung, der Ernährung, der Hygiene zuwendet, Alkoholfragen und Vegetarismus werden mit religiösem Ernste behandelt, augenscheinlich das Gewichtigste an Problemen, zu dem der „neue Mensch“ sich aufschwingen kann. So entspricht es der Froschperspektive dieser Generationen. Religionen, die an der Schwelle großer Kulturen entstehen wie die homerische und vedische, das Christentum Jesu und das faustische der ritterlichen Germanen hätten es unter ihrer Würde befunden, zu Fragen der Art herabzusteigen. Jetzt steigt man zu ihnen hinauf. Der Buddhismus ist ohne dergleichen nicht denkbar. Im Kreise der Sophisten, des Antisthenes, der Stoiker und Skeptiker gewinnt es große Bedeutung. Schon Aristoteles hat über die Alkoholfrage geschrieben, eine ganze Reihe von Philosophen über den Vegetarismus und es besteht zwischen der apollinischen und der faustischen Farce nur der Unterschied, daß der Zyniker die eigne Verdauung, Shaw die Verdauung „aller Menschen“ in sein theoretisches Interesse zieht. Der eine entsagt, der andere[S. 506] verbietet. Man weiß, wie Nietzsche sich noch im Ecce homo darin gefällt, in Fragen dieser Art zu dilettieren.
Überblicken wir noch einmal den Sozialismus als das faustische Beispiel einer zivilisierten, einer intellektuellen, logisierten, von Kausalitäten statt vom Schicksal erfüllten Ethik. Was seine Freunde und Feinde von ihm sagen, daß er die Gestalt der Zukunft oder daß er ein Zeichen des Niederganges sei, ist gleich richtig. Wir alle sind Sozialisten, ohne es zu wissen. Wir tragen ihn als Lebensgefühl in uns, ob wir wollen oder nicht. Und selbst der Widerstand gegen ihn trägt seine Form.
Alle antiken Menschen der späten Zeit waren Stoiker, ohne es zu wissen. Das ganze römische Volk, als Körper, als Individualität, hat eine stoische Seele; als Zenon lebte, war der populus Romanus, dies Volk von Soldaten und Beamten mit einer Götterwelt, in der es nur Götterpflichten, nüchterne, praktische, keine göttlichen Abenteuer gibt, eben in der Bildung begriffen. Der echte Römer, gerade der, welcher es am entschiedensten bestritten hätte, ist in einem strengeren Grade Stoiker, als es je ein Grieche hätte sein können: er lebte noch in einer Art ursprünglicher Barbarei, als das antike Dasein sich ihr wieder näherte; ihm fehlt der innere Rest von Kultur, der die Reinheit des zivilisierten Typus verdunkelt. Die lateinische Sprache, durch und durch praktisch und prosaisch, ist die mächtigste Schöpfung des Stoizismus geblieben.[112]
Erinnern wir uns des allgemeinen Grundgedankens, daß Geschichte und Natur Gegensätze sind, daß wir, als Ausdruck und Verwirklichung unsres Seelischen zwei Welten als Möglichkeiten besitzen, die eine die Natur, vom Gewordnen und Erkannten aus gestaltet, von Gesetz, Zahl, Grenze, Logik, gesättigt, durch und durch System, Mechanismus, Ursache und Wirkung, die andre die Geschichte, unmittelbarer Ausdruck des Werdens und Lebens, erschaut, nicht erkannt, von einer andern Logik und Notwendigkeit, die nicht in Worte zu fassen[S. 507] ist, der des Schicksals. Beide stehen einander gegenüber wie Leben und Tod, Richtung und Ausdehnung, ewige Zukunft und ewige Vergangenheit.
Der Zivilisation liegt das Gefühl der Natur, der schon gewordnen, abgeschlossenen, erkannten, toten Welt zugrunde. Der Schritt von einer Kultur zur Zivilisation läßt sich als die Metamorphose der Historie in naturhafte Formen bezeichnen. Dies ist der geheimste Sinn jener „Rückkehr zur Natur“, zur starren, vernunftmäßigen, gesetzmäßigen Natur nämlich, der Wendung vom Schicksal zum Kausalen. Der faustische Mensch des zivilisierten Stadiums, dessen Welt sich als ein Unendliches kausaler Zusammenhänge repräsentiert, für den sich in Ursache und Wirkung, Mittel und Zweck ihr Wesen erschöpft, ist Sozialist. Das ist die Form seiner geistigen Existenz.
Der Sozialismus ist das überhaupt erreichbare Maximum eines Lebensgefühls unter dem Aspekt von Zwecken. Denn die bewegte Richtung des Seins, in den Worten Zeit und Schicksal fühlbar, bildet sich, sobald sie starr, bewußt, erkannt ist, in den Mechanismus von Mittel und Zweck um. Richtung ist das Lebendige, Zweck das Tote. Faustisch ist die Leidenschaft des Vordringens, sozialistisch der mechanische Rest, der „Fortschritt“. Sie verhalten sich wie der Leib zum Skelett. Dies ist zugleich der Unterschied des Sozialismus vom Buddhismus und Stoizismus, die mit den Idealen des Nirwana und der Ataraxia ebenso mechanisch gestimmt sind, aber nicht die dynamische Leidenschaft der dritten Dimension, den Willen zum Unendlichen, das Pathos der Ausdehnung kennen.
Der Sozialismus ist — trotz seiner oberflächlichen Illusionen — kein System des Mitleids, der Humanität, des Friedens und der Fürsorge, sondern des Willens zur Macht. Alles andere ist Selbsttäuschung. Das Ziel ist durchaus imperialistisch: Wohlfahrt, aber im expansiven Sinne, nicht der Kranken, sondern der Tatkräftigen, denen man die Freiheit des Wirkens geben will, ungehemmt durch die Widerstände des Besitzes, der Geburt, der Tradition. Gefühlsmoral, Moral auf den Nutzen hin ist bei uns nie der letzte Instinkt, so oft es sich die Träger dieser Instinkte einbilden. Man wird immer an die Spitze der moralischen Modernität Kant, in diesem Falle den Schüler Rousseaus stellen[S. 508] müssen, dessen Ethik das Motiv des Mitleids ablehnt und den Satz prägt: „Handle so, daß —“. Alle Ethik dieses Stils will Ausdruck des Willens zum Unendlichen sein und dieser Wille fordert Überwindung des Augenblicks, der Gegenwart, der Vordergründe des Lebens. An Stelle der sokratischen Formel: „Wissen ist Tugend“ setzte schon Bacon den Spruch: „Wissen ist Macht“. Der Stoiker nimmt die Welt, wie sie ist: Der Sozialist will sie der Form, dem Gehalte nach organisieren, umprägen, mit seinem Geiste erfüllen. Der Stoiker paßt sich an. Der Sozialist befiehlt. Die ganze Welt soll die Form seiner Anschauung tragen — so läßt sich die Idee der „Kritik der reinen Vernunft“ ins Ethische umsetzen. Das ist der letzte Sinn des kategorischen Imperativs, den er aufs Politische, Soziale, Wirtschaftliche anwendet: Handle so, als ob die Maxime deines Handelns durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte. Und diese tyrannische Tendenz ist selbst den flachsten Erscheinungen der Zeit nicht fremd.
Der Sozialismus ist zweitens eine seelische Dynamik. Nicht die Haltung und Gebärde, die Wirksamkeit soll gestaltet werden. Das Leben kommt nur in Betracht, insofern es Tat ist. Und erst so, durch die Mechanisierung des organischen Prinzips der Tat, entsteht die Idee der Arbeit als der zivilisierten Form faustischen Wirkens. Diese Moral, der Drang, dem Leben die denkbar aktivste Form zu geben, ist stärker als die Vernunft, deren Moralprogramme, sie mögen noch so geheiligt, inbrünstig geglaubt, leidenschaftlich verteidigt sein, nur insoweit wirken, als sie in der Richtung dieses Dranges liegen oder in ihr mißverstanden werden. Im übrigen bleiben sie Worte. Man unterscheide in aller Modernität wohl die populäre (antik empfundene, statische) Seite, das süße Nichtstun, die Sorge um Gesundheit, Glück, Sorglosigkeit, den allgemeinen Frieden, kurz das vermeintlich Christliche von dem höheren Ethos, das nur die Tat wertet, das den Massen — wie alles Faustische — weder verständlich noch erwünscht ist, die großartige Idealisierung des Zweckes und also der Arbeit. Will man dem römischen „Panem et circenses“, dem letzten epikuräisch-stoischen Lebenssymbol, das entsprechende Symbol des Nordens zur Seite stellen, so muß es das Recht auf Arbeit sein, das schon dem durch und[S. 509] durch preußisch empfundenen, heute europäisch gewordnen Staatssozialismus Fichtes zugrunde liegt und das in den letzten, furchtbarsten Stadien dieser Entwicklung in der Pflicht zur Arbeit gipfeln wird.
Endlich das Napoleonische in ihm, das aere perennius, der Wille zur Dauer, der Zukunft. Der ahistorische apollinische Mensch sah auf ein goldenes Zeitalter zurück; das enthob ihn des Nachdenkens über das Kommende. Der Sozialist — der sterbende Faust — ist der Mensch der historischen Sorge, des Künftigen, das er als Aufgabe und Ziel empfindet, demgegenüber das Glück des Augenblicks verächtlich wird. Der antike Geist mit seinen Orakeln und Vogelzeichen will die Zukunft nur wissen, der abendländische will sie schaffen. Das dritte Reich ist das germanische Ideal, ein ewiges Morgen, an das alle großen Menschen von Dante bis Nietzsche und Ibsen — Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer, wie es im Zarathustra heißt — ihr Leben knüpften. Alexanders Leben war ein wundervoller Rausch, ein Traum, in dem das homerische Zeitalter noch einmal heraufbeschworen wurde; Napoleons Leben war eine ungeheure Arbeit, nicht für sich, nicht für Frankreich, sondern für die Zukunft überhaupt.
An dieser Stelle greife ich zurück und erinnere noch einmal daran, wie verschieden die großen Kulturen sich das Wesen der Weltgeschichte vorgestellt haben: Der antike Mensch sah nur sich, seine Geschicke als ruhende Nähe und fragte nicht nach dem Woher und Wohin. Universalhistorie ist ihm ein unmöglicher Begriff. Das ist die statische Geschichtsauffassung. Der magische Mensch sieht Geschichte als das große Weltdrama zwischen Schöpfung und Untergang, das Ringen zwischen Seele und Geist, Gut und Böse, Gott und Teufel, eine streng begrenzte Aktion mit einer einmaligen Katastrophe als Höhepunkt: der Erscheinung des Erlösers. Der faustische Mensch sieht in der Geschichte eine gespannte Entwicklung auf ein Ziel. Die Reihe: Altertum — Mittelalter — Neuzeit ist eine dynamische Idee. Er kann sich Geschichte gar nicht anders vorstellen, und wenn dies nicht Weltgeschichte an sich und überhaupt, sondern das Bild einer Weltgeschichte faustischen Stils ist, das mit der westeuropäischen Kultur beginnt und aufhört, wahr und vorhanden[S. 510] zu sein, so ist der Sozialismus die logische, praktische Krönung dieser Vorstellung. In ihm erhält das Bild den von der Gotik an vorbereiteten Abschluß.
Und hier wird der Sozialismus — im Gegensatz zum Stoizismus und Buddhismus — tragisch. Es ist bedeutsam, daß Nietzsche von höchster Klarheit ist, sobald es sich um die Frage handelt, was zertrümmert, was umgewertet werden soll; er verliert sich in nebelhafte Allgemeinheiten, sobald das Wozu, das Ziel in Rede steht. Seine Kritik der Dekadence ist tief, seine Übermenschenlehre ist eine Marotte. Und dasselbe gilt von Ibsen — von Brand und Rosmersholm, Julian Apostata und Baumeister Solneß —, von Hebbel, von Wagner, von allen. Und darin liegt eine tiefe Notwendigkeit, denn von Rousseau an gibt es für den faustischen Menschen nichts mehr zu hoffen. Hier ist etwas zu Ende. Die nordische Seele hat ihre innern Möglichkeiten erschöpft und es blieb nur noch der dynamische Sturm und Drang, wie er sich in welthistorischen Zukunftsvisionen äußert, die mit Jahrtausenden messen, der Trieb, die schöpferische Leidenschaft, eine geistige Daseinsform ohne Inhalt. Diese Seele war Wille, Kraft und nichts andres; sie brauchte ein Ziel für ihre Kolumbussehnsucht; sie mußte einen Gehalt ihrer Wirksamkeit sich wenigstens vortäuschen, und so findet der feinere Beobachter einen Zug von Hjalmar Ekdal in aller Modernität, auch in ihren höchsten Erscheinungen. Ibsen hat es die Lebenslüge genannt. Nun, etwas von ihr liegt in der gesamten Geistigkeit der westeuropäischen Zivilisation, insoweit sie auf eine religiöse, künstlerische, philosophische Zukunft, ein immaterielles Ziel, ein drittes Reich sich richtet, während in der tiefsten Tiefe ein dumpfes Gefühl nicht schweigen will, daß diese ganze Wirksamkeit Schein, die verzweifelte Selbsttäuschung einer historischen Seele ist. Aus dieser tragischen Situation — der Umkehrung des Hamletmotivs — ist Nietzsches gewaltsame Konzeption der Ewigen Wiederkunft hervorgegangen, an die er niemals mit gutem Gewissen geglaubt hat, die er aber trotzdem festhielt, um seine Verkünderrolle zu retten. Auf dieser Lebenslüge ruht Bayreuth, das etwas sein wollte im Gegensatz zu Pergamon, das etwas war. Und ein Zug dieser Lüge haftet dem gesamten politischen, wirtschaftlichen, ethischen Sozialismus an, der gewaltsam über den vernichtenden[S. 511] Ernst seiner Resultate schweigt, um die Illusion eines letzten Glückszustandes zu retten.
Es bleibt noch ein Wort über die Geschichte der Philosophie zu sagen, deren Morphologie ein Problem darstellt, das nicht einmal entdeckt, geschweige denn gelöst worden ist.
Es gibt keine Philosophie überhaupt; jede Kultur hat ihre eigne; sie ist ein Teil ihres symbolischen Gesamtausdruckes, ein Stück verwirklichten Seelentums. Sie entspricht als Phänomen den Formenwelten der Mathematik und der großen Künste. Ihre Konzeptionen stehen neben den entscheidenden Werken der Kunst, der Divina Comedia, dem Parzeval, den Tragödien des Äschylus. Ihre Systeme haben Stil. Sie sind trotz der äußeren Verknüpfung mit wissenschaftlicher Erfahrung freie Geburten schöpferischer Geister. Jede Kultur hat aber auch ihre Philosophie des Aufstiegs und des Niedergangs, eine metaphysische Periode, wo das Leben noch Chaos in sich hat und aus einer Überfülle heraus weltgestaltend wirkt, und eine ethische, wo das erschöpfte Leben auf sich selbst Bedacht nehmen und den Rest von Gestaltungskraft auf die Fragen des Tages verwenden muß. Die erste gehört zu den höheren Wirkungen einer Kultur: die brahmanische, ionische, Barockphilosophie. Die zweite ist zivilisierter Natur und beschränkt ihre Gültigkeit auf den Bannkreis der großen Städte und die Wesensform des intellektuellen Menschen. In der einen offenbart sich das Leben, die andre nimmt das Leben — von außen — zum Objekt. In der ersten finden wir von Anaximander bis auf Plato und von Descartes bis auf Kant herab eine dichte Reihe großer Gestalter. In ihnen durchdringt das apollinische und faustische Seelentum das All und sucht sich seiner Geheimnisse zu bemächtigen. So sehr die Logik mit ihren feinsten Mitteln zur Anwendung kommt, all diesen Schöpfungen von tiefster Selbstverständlichkeit liegt eine Intuition zugrunde, der sich alles fügt. Noch das kantische System ist in seinen letzten Zügen geschaut und danach erst durch logische und systematische Prinzipien fixiert und geordnet worden.
[S. 512]
Ein Beweis ist das Verhältnis zur Mathematik, deren Sinn als einer unmittelbaren Intuition des Gewordnen — durch die Konzeption der Idee einer Zahl, deren Typus immer nur einer einzigen Kultur wesenhaft ist — hier zum erstenmal festgestellt wurde. Wer nicht in die Formenwelt der Zahlen eingedrungen ist, wer sie nicht als Symbole in sich erlebt, ist kein Metaphysiker. In der Tat waren es die großen Philosophen des Barock, Descartes, Pascal, Hobbes, Leibniz, welche die Analysis geschaffen haben, und das Entsprechende gilt von den Vorsokratikern und Plato. Leibniz ist neben Newton und Gauß, Plato und Pythagoras sind neben Archimedes Gipfel der mathematischen Entwicklung. Aber schon Kant ist als Mathematiker ohne Bedeutung. Er ist in die letzten Feinheiten der damaligen Infinitesimalrechnung so wenig eingedrungen, als er Leibnizens Axiomatik begriffen hat. Darin ist er seinem „Zeitgenossen“ Aristoteles gleich, der ebenfalls Dilettant in mathematicis war, und von nun an zählt kein Philosoph in der Mathematik mehr mit. Kant ist sehr unglücklich in der Heranziehung von geometrischen Beweisen für seine Erkenntnistheorie, und die Kritik der reinen Vernunft verrät, daß ihm nur die Elementarmathematik wirklich lebendig ist, zum großen Schaden seiner Raum- und Zeittheorie, die eine Prüfung durch die schwersten Fragen der Infinitesimalrechnung erfordert hätte. Fichte, Hegel, Schelling endlich sind völlig unmathematisch, so gut wie Zenon und Epikur. Schopenhauer ist schwach bis zur Borniertheit, von Nietzsches gelegentlichen seltsamen Leistungen ganz zu schweigen. Aber auch das ist „Rückkehr zur Natur“. Mit der Formenwelt der Zahlen ging eine große Konvention verloren. Seitdem fehlt es nicht nur an einer Tektonik der Systeme, es fehlt auch an dem, was man den großen Stil des Denkens nennen darf. Schopenhauer hat sich selbst einen Gelegenheitsdenker genannt. Man erinnere sich der Beziehung der Mathematik zur Plastik und Musik. Kant und Plato bezeichnen die Schwelle. Die „Philosophie ohne Mathematik“ beginnt. Die Ethik ist im Begriff, über ihren Rang als Teil einer abstrakten Theorie hinauszuwachsen. Von nun an ist die Ethik die Philosophie, welche die andern Gebiete sich einverleibt, das heißt: nicht der Makrokosmos, sondern das praktische Leben rückt in den Mittelpunkt der Betrachtung. Der[S. 513] Horizont ist eng geworden. Die Leidenschaft des reinen Denkens sinkt. Die Metaphysik, Herrin von gestern, wird zur Dienerin von heute. Sie hat nur noch das Fundament zu bilden, das eine praktische Gesinnung trägt. Und das Fundament wird immer überflüssiger. Man vernachlässigt, man verspottet das Metaphysische, das Unpraktische, die „Steine statt des Brotes“. Bei Schopenhauer ist es das vierte Buch, um dessentwillen die drei ersten da sind. Kant glaubte nur, daß es bei ihm so wäre. In der Tat ist ihm noch die reine, nicht die praktische Vernunft Mittelpunkt der Schöpfung. Genau so scheidet sich die antike Philosophie vor und nach Aristoteles: dort ein groß aufgefaßter Kosmos, kaum bereichert durch eine formale Ethik, hier die Ethik selbst, als Programm, als Not, auf der Basis einer nebenher und flüchtig konzipierten Metaphysik. Und man fühlt, daß die logische Gewissenlosigkeit, mit der zum Beispiel Nietzsche derlei Theorien schnell hinwirft, gar nicht imstande ist, den Wert seiner eigentlichen Philosophie herabzusetzen.
Bekanntlich ist Schopenhauer (Neue Paralipomena § 656) nicht von seiner Metaphysik zum Pessimismus, sondern vom Pessimismus, der ihn in seinem 17. Jahre überfiel, zur Konstruktion seines Systems gekommen. Shaw, ein sehr merkwürdiger Zeuge, macht im Ibsenbrevier darauf aufmerksam, daß man bei Schopenhauer — wie er sich ausdrückt — sehr wohl seine Philosophie annehmen kann, während man seine Metaphysik ablehnt. Damit ist instinktiv das gesondert, wodurch er der erste Denker der neuen Zeit war, und das, was einer veralteten Tradition nach damals zu einer vollständigen Philosophie gehörte. Niemand würde diese Trennung bei Kant vornehmen. Sie würde auch nicht gelingen. Bei Nietzsche aber läßt sich leicht feststellen, daß seine „Philosophie“ durchaus ein inneres, sehr frühes Erlebnis war, während er seinen Bedarf an Metaphysik an der Hand einiger Bücher schnell und mangelhaft genug herstellte und nicht einmal seine ethische Lehre exakt darzustellen vermochte. Genau dieselbe Überlagerung einer lebendigen, zeitgemäßen und einer von der Gewohnheit geforderten metaphysischen Gedankenschicht läßt sich bei Epikur und den Stoikern nachweisen. Diese Erscheinung gestattet über das Wesen einer zivilisierten Philosophie keinen Zweifel.
[S. 514]
Die Metaphysik hat ihre Möglichkeiten erschöpft. Die Weltstadt hat das Land endgültig überwunden und ihr Geist bildet sich jetzt eine eigne, notwendigerweise nach außen gerichtete, mechanistische, seelenlose Theorie. Mit einem gewissen Rechte sagt man von nun an Gehirn statt Seele. Und da im westeuropäischen Gehirn der Wille zur Macht, die tyrannische Richtung auf die Zukunft, auf Organisation der Gesamtheit nach praktischem Ausdruck verlangt, so nimmt die Ethik, je mehr sie ihre metaphysische Vergangenheit aus den Augen verliert, nationalökonomischen Charakter an. Die von Hegel und Schopenhauer ausgehende Philosophie der Gegenwart, soweit sie den Geist der Zeit repräsentiert — was Lotze und Herbart z. B. nicht tun — ist Gesellschaftskritik.
Die Aufmerksamkeit, welche der Stoiker dem eigenen Körper, dem σῶμα, zuwendet, widmet der abendländische Mensch dem Gesellschaftskörper. Es ist kein Zufall, daß aus der Schule Hegels der Sozialismus (Marx, Engels), der Anarchismus (Stirner) und die Problematik des sozialen Dramas (Hebbel) hervorgingen. Der Sozialismus ist die ins Ethische, und zwar ins Imperativische umgewandte Nationalökonomie. Solange es eine Metaphysik großen Stils gab, bis auf Kant, blieb die Nationalökonomie eine Wissenschaft. Sobald „Philosophie“ gleichbedeutend mit praktischer Ethik wurde, trat sie an Stelle der Mathematik als Normativ des Weltdenkens.
Es steht dem Philosophen nicht frei, seine Stoffe zu wählen, so wenig die Philosophie immer und überall dieselben Stoffe hat. Es gibt keine ewigen Fragen, es gibt nur Fragen, die aus dem Dasein eines historisch-individuellen Menschentums, einer einzelnen Kultur heraus gefühlt und gestellt werden. „Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis“ — das gilt auch von jeder echten Philosophie als dem geistigen Ausdruck dieses Daseins, als der Verwirklichung seelischer Möglichkeiten in einer Formenwelt von Begriffen, Gedanken, Intuitionen, zusammengefaßt in der lebendigen Erscheinung ihres Urhebers. Eine jede ist vom ersten bis zum letzten Wort, vom abstraktesten Thema bis zum persönlichsten Charakterzuge ein Gewordnes, aus der Seele in die Welt, aus dem Reiche der Freiheit in das der Notwendigkeit, aus dem unmittelbar Lebendigen ins Räumlich-Logische[S. 515] projiziert, reines Symbol einer historisch begrenzten Art des Menschlichen und mithin vergänglich, von bestimmtem Tempo, von bestimmter Lebensdauer. Deshalb liegt eine strenge Notwendigkeit in der Wahl des Themas. Jede Epoche hat ihr eignes, das für sie und keine andre bedeutend ist. Hier sich nicht zu vergreifen, kennzeichnet den gebornen Philosophen. Der Rest der philosophischen Produktion ist belanglos, bloße Fachwissenschaft, langweilige Häufung systematischer und stofflicher Subtilitäten.
Und deshalb ist die Philosophie des 19. Jahrhunderts nur Ethik, nur Gesellschaftskritik in produktivem Sinne und nichts außerdem. Deshalb sind, von Praktikern abgesehen, Dramatiker — das entspricht der faustischen Aktivität — ihre bedeutendsten Vertreter, neben denen kein einziger Kathederphilosoph mit seiner Logik, Psychologie oder Systematik in Betracht kommt. Nur dem Umstande, daß diese Unbedeutenden, bloße Gelehrte, immer auch die Geschichte der Philosophie — und was für eine Geschichte! Eine Summation von Personen und „Ergebnissen“ — geschrieben haben, verdankt man es, daß niemand heute weiß, was Geschichte der Philosophie ist und was sie sein könnte.
Die tiefe organische Einheit im Denken dieser Epoche ist deshalb noch nie durchschaut worden. Man kann ihren philosophischen Kern dadurch auf eine Formel bringen, daß man sich fragt, inwiefern Shaw der Schüler und Vollender Nietzsches ist. Diese Beziehung ist zunächst durchaus nicht ironisch gemeint. Unter einem Denker verstehe ich den, der seine Zeit repräsentiert, indem er ihren lebendigen Inhalt (der mit dem aktuellen wenig oder nichts zu tun hat) in endgültige geistige Formen bringt. In seiner Analyse des Griechentums ist Nietzsche nur insoweit Denker und nicht Philologe oder Plauderer, als er unter dieser Maske sein Problem der Decadence gestaltet. In seinen Komödien ist Shaw nur insoweit Denker und nicht bloß Nationalökonom und Journalist, als seine Probleme auch in antiker Fassung hätten erscheinen können. Man muß nur ihr Wesentliches von ihrer äußern Tendenz zu unterscheiden wissen. Shaw ist der einzige Denker von Bedeutung, der konsequent in der Richtung des echten Nietzsche fortgeschritten ist, als produktiver Kritiker der abendländischen Moral nämlich, wie er andrerseits[S. 516] als Dichter die letzten Konsequenzen Ibsens zog und den Rest künstlerischer Gestaltung in seinen Stücken zugunsten praktischer Diskussionen aufgab, wobei „Denker“ und „Dichter“ bei diesem letzten und schon ein wenig epigonenhaften Glied der Reihe nun doch mit der nötigen Ironie gesagt wird, selbst wenn man die Differenz zwischen deutschem und englischem Geist, zwischen dem Ausklang einer posthumen, fast unterirdischen Kultur, die eben in Nietzsche überraschend ans Licht trat, und einer in sich vollendeten, rein gehirnlichen Zivilisation, zwischen einer Vogelperspektive, zu der immer wieder der Flug genommen, und der Froschperspektive, die mit borniertem Behagen eingehalten wird, vorher subtrahiert hat.
Nietzsche ist in allem und jedem, soweit nicht der verspätete Romantiker in ihm Stil, Klang und Haltung seiner Philosophie bestimmt hat, ein Schüler materialistischer Jahrzehnte gewesen. Was ihn an Schopenhauer leidenschaftlich anzog, ohne daß es ihm oder irgendjemand anders bis zum heutigen Tage zum Bewußtsein gekommen wäre, ist dasjenige Element seiner Lehre, durch welches er die Metaphysik großen Stils zerstörte, durch das er seinen Meister Kant unfreiwillig parodiert hat, die Wendung aller tiefen Begriffe des Barock ins massiv Greifbare und Mechanistische. Kant redet in unzulänglichen Worten, hinter denen sich eine gewaltige, schwer zugängliche Intuition verbirgt, von der Welt als Erscheinung; Schopenhauer nennt das die Welt als Gehirnphänomen. In ihm vollzieht sich die Wendung der tragischen Philosophie zum philosophischen Plebejertum. Es genügt, eine Stelle zu zitieren. In der „Welt als Wille und Vorstellung“ (II, Kapitel 19) heißt es: „Der Wille, als das Ding an sich, macht das innere, wahre und unzerstörbare Wesen des Menschen aus: an sich selbst ist er jedoch bewußtlos. Denn das Bewußtsein ist bedingt durch den Intellekt, und dieser ist ein bloßes Akzidens unseres Wesens; denn er ist eine Funktion des Gehirns, welches, nebst den ihm anhängenden Nerven und Rückenmark, eine bloße Frucht, ein Produkt, ja insofern ein Parasit des übrigen Organismus ist, als es nicht direkt eingreift in dessen inneres Getriebe, sondern dem Zweck der Selbsterhaltung bloß dadurch dient, daß es die Verhältnisse desselben zur Außenwelt reguliert.“ Das ist genau das Grundprinzip des[S. 517] seichtesten Materialismus. Nicht umsonst war Schopenhauer, wie einst Rousseau, zu den englischen Sensualisten in die Lehre gegangen. Dort lernte er Kant im Geiste der großstädtischen, aufs Zweckmäßige gerichteten Modernität mißverstehen. Der Intellekt als Werkzeug des Willens zum Leben,[113] als Waffe im Kampf ums Dasein, das, was Shaw in eine groteske dramatische Form und Bergson in ein epigonenhaftes, aus deutschen Denkern zusammengestelltes System gebracht hat, dieser Weltaspekt Schopenhauers war es, der ihn beim Erscheinen von Darwins Hauptwerk (1859) mit einem Schlage zum Modephilosophen machte. Er war im Gegensatz zu Schelling, Hegel und Fichte der einzige, dessen metaphysische Formeln dem geistigen Mittelstand ohne Schwierigkeit eingingen. Seine Klarheit, auf die er stolz war, ist in jedem Augenblick in Gefahr, sich als Trivialität zu enthüllen. Hier konnte man, ohne auf Formeln zu verzichten, die eine Atmosphäre von Tiefsinn und Exklusivität um sich breiteten, die gesamte zivilisierte Weltanschauung sich zu eigen machen. Sein System ist antizipierter Darwinismus, dem die Sprache Kants und die Begriffe der Inder nur zur Verkleidung dienten. In seinem Buche „Über den Willen in der Natur“ (1835) finden wir schon den Kampf um die Selbstbehauptung in der Natur, den menschlichen Intellekt als die wirksamste Waffe in ihm, die Geschlechtsliebe als die unbewußte Wahl[114] aus biologischem Interesse.
Es ist die gesamte Lehre, die Darwin auf dem Umweg über Hegel und Malthus mit sensationellem Erfolge in das Bild der Tierwelt hineininterpretierte. Die nationalökonomische Herkunft des Darwinismus — die man erst künftig verstehen wird, wenn die Menschen nicht mehr Darwinisten aus Instinkt sind, bevor die „Entstehung der Arten“ sie zu solchen aus Überzeugung macht — wird glänzend bewiesen durch die Tatsache, daß dieses System, von der Menschenähnlichkeit höherer Tiere[S. 518] aus gedacht, schon auf die Pflanzenwelt nicht mehr paßt und in Albernheiten ausartet, wenn man es mit seiner Willenstendenz (Zuchtwahl, mimicry) auch auf primitive organische Formen anwenden will. Beweisen nennt der abendländische Biologe, eine Auswahl von Tatsachen so ordnen und bildhaft so erklären, daß sie seinem historisch-dynamischen Grundgefühl „Entwicklung“ entspricht. Der „Darwinismus“, d. h. jene Summe sehr verschiedenartiger und einander widersprechender Ansichten, deren Gemeinsames lediglich die Anwendung des Kausalprinzips auf Lebendiges, also Methode, nicht Resultat ist, war schon im 18. Jahrhundert in allen Einzelheiten bekannt. Die Affentheorie verteidigt Rousseau schon 1754. Von Darwin stammt nur das manchesterliche System, dessen Popularität sich aus dem latenten politischen Gehalt erklärt.
Hier offenbart sich die geistige Einheit des Jahrhunderts. Von Schopenhauer bis zu Shaw haben alle, ohne es zu ahnen, dasselbe Prinzip in Form gebracht. Sie werden alle vom Entwicklungsgedanken geleitet, auch die, welche wie Hebbel nichts von Darwin wußten, und zwar nicht in seiner tiefen Goetheschen, sondern in seiner flachen zivilisierten Fassung, mag sie nun nationalökonomisches oder biologisches Gepräge tragen. Auch innerhalb der Entwicklungsidee, die durch und durch faustisch ist, die im strengsten Gegensatz zur zeitlosen aristotelischen Entelechie einen leidenschaftlichen Drang der unendlichen Zukunft entgegen offenbart, einen Willen, ein Ziel, die a priori die Form unserer Naturanschauung darstellt und als Gesetz gar nicht erst entdeckt zu werden brauchte, weil sie dem faustischen Geiste — und ihm allein — immanent ist, vollzog sich die Wandlung der Kultur zur Zivilisation. Bei Goethe, der darin zum Barock gehört, ist sie erhaben, bei Darwin flach, bei Goethe organisch, bei Darwin mechanisch, bei jenem Erlebnis und Intuition, bei diesem Erkenntnis und Gesetz. Dort heißt sie innere Vollendung, hier „Fortschritt“. Darwins Kampf ums Dasein, den er in die Natur hinein, nicht aus ihr herauslas, ist nur die plebejische Fassung jenes Urgefühls, das in Shakespeares Tragödien die großen Wirklichkeiten gegeneinander bewegt. Was dort als Schicksal innerlich angeschaut, gefühlt und in Gestalten verwirklicht wurde, das wurde hier als Kausalnexus[S. 519] begriffen und in ein utilitarisches Oberflächensystem gebracht. Und dies System, nicht jenes Urgefühl, liegt den Reden Zarathustras, der Tragik der „Gespenster“, der Problematik des Nibelungenringes zugrunde. Nur daß Schopenhauer, an den Wagner sich hielt, als der erste der Reihe seine eigne Erkenntnis entsetzt wahrnahm — dies ist die Wurzel seines Pessimismus, der in der Tristanmusik den höchsten Ausdruck fand —, während die Späteren, Nietzsche voran, sich an ihr, etwas gewaltsam zuweilen, begeisterten.
In Nietzsches Bruch mit Wagner, diesem letzten Ereignis des deutschen Geistes, über dem Größe liegt, verbirgt sich sein Wechsel des Lehrmeisters, sein Schritt von Schopenhauer zu Darwin, von der metaphysischen zur physiologischen Formulierung desselben Weltgefühls, von der Verneinung zur Bejahung des Aspekts, den beide anerkennen, nämlich des Willens zum Leben, der mit dem Kampf ums Dasein identisch ist. In „Schopenhauer als Erzieher“ bedeutet Entwicklung noch inneres Reifen; der Übermensch ist das Produkt einer mechanischen „Evolution“. So ist der Zarathustra ethisch aus einem unbewußten Widerspruch gegen den Parsifal, künstlerisch durchaus von diesem bestimmt, aus der Eifersucht eines Verkünders auf den andern, entstanden.
Aber Nietzsche war auch Sozialist, ohne es zu wissen. Nicht seine Schlagworte, seine Instinkte waren sozialistisch, imperativisch, praktisch, auf das physiologische „Heil der Menschheit“ gerichtet, woran Goethe und Kant nie gedacht hatten. Materialismus, Sozialismus, Darwinismus sind nur künstlich und an der Oberfläche trennbar. So war es möglich, daß Shaw den Tendenzen der Herrenmoral und der Züchtung des Übermenschen nur eine kleine und sogar konsequente Wendung zu geben brauchte, um im dritten Akte von „Mensch und Übermensch“, einem der wichtigsten und bezeichnendsten Werke am Ausgang der Epoche, die eigentliche Maxime seines Sozialismus zu erhalten. Shaw hat da nur ausgesprochen, aber rücksichtslos, klar, mit dem vollen Bewußtsein einer Trivialität, was ursprünglich, mit aller Theatralik Wagners und aller Verschwommenheit der Romantik, in den nicht ausgeführten Teilen des Zarathustra gesagt werden sollte. Man muß nur die notwendigen praktischen,[S. 520] aus der Struktur des gegenwärtigen öffentlichen Lebens folgenden Voraussetzungen und Konsequenzen der Gedankengänge Nietzsches zu finden wissen. Er bewegt sich in unbestimmten Wendungen wie „neue Werte“, „Übermensch“, „Sinn der Erde“ und hütet oder fürchtet sich, das genauer zu fassen. Shaw tut es. Nietzsche bemerkt, daß die darwinistische Idee des Übermenschen den Begriff der Züchtung heraufruft, aber er bleibt bei der klangvollen Phrase stehen. Shaw fragt weiter — denn es hat keinen Zweck, darüber zu reden, wenn man nichts tun will —, wie das zu geschehen hat, und er kommt dazu, die Verwandlung der Menschheit in ein Gestüt zu verlangen. Aber das ist lediglich die Konsequenz Zarathustras, zu der er selbst nur nicht den Mut, sei es auch den Mut der Geschmacklosigkeit, hatte. Wenn man von Züchtung redet, einem extrem materialistischen und utilitarischen Begriff, der die Ehe zu einer sexuellen Institution im Interesse einer Gesamtheit und im Hinblick auf ein physiologisches Ziel macht, so ist man eine Antwort darauf schuldig, wer zu züchten hat, wen, wo und wie. Allein Nietzsches romantische Abneigung, die höchst prosaischen sozialen Konsequenzen zu ziehen, seine Furcht, poetische Utopien durch Konfrontierung mit tatsächlichen Verhältnissen einer Kraftprobe auszusetzen, ließen ihn darüber schweigen, daß seine ganze positive Lehre, wie sie aus dem Darwinismus stammt, auch den Sozialismus, und zwar den sozialistischen Zwangsstaat als Mittel voraussetzt, daß jeder systematischen Züchtung einer Klasse höherer Menschen eine streng sozialistische Gesellschaftsordnung voraufgehen muß und daß diese „dionysische“ Idee, da es sich um eine gemeinsame Aktion und nicht um eine Privatangelegenheit abseits lebender Denker handelt, demokratisch ist, mag man sie wenden, wie man will. Damit hat die ethische Dynamik des „Du sollst“ ihren Gipfel erreicht: um der Welt die Form seines Willens aufzuerlegen, opfert der faustische Mensch sich selbst.
Schon Schopenhauer hatte vom Herdenmenschen als der Fabrikware der Natur gesprochen. Die Züchtung des Übermenschen folgt aus dem Begriff der Zuchtwahl. Nietzsche war, seit er Aphorismen schrieb, ein Schüler Darwins, aber Darwin selbst hatte den Entwicklungsgedanken des 18. Jahrhunderts[S. 521] durch nationalökonomische Tendenzen umgeprägt, die er von seinem Lehrer Malthus nahm und in das höhere Tierreich projizierte. Der Darwinismus ist eine sozialpolitische Konzeption. Malthus hatte die Fabrikindustrie von Lancaster studiert, und man findet das ganze System, statt auf Tiere auf Menschen angewendet, schon in Buckles Geschichte der englischen Zivilisation (1857).
Und so stammt die „Herrenmoral“ dieses letzten Romantikers auf einem merkwürdigen, aber für den Sinn der Zeit höchst bezeichnenden Wege aus der Quelle aller intellektuellen Modernität, der Atmosphäre der englischen Maschinenindustrie. Der Macchiavellismus, den Nietzsche als Renaissancephänomen etwas zu oft pries und dessen Verwandtschaft mit Darwins Begriff des mimicry man nicht übersehen sollte, war damals tatsächlich der im „Kapital“ von Marx — dem andern berühmten Jünger von Malthus — behandelte und die Vorstufe dieses seit 1867 erscheinenden Grundbuches des politischen (nicht des ethischen) Sozialismus, die Schrift „Zur Kritik der politischen Ökonomie“, erschien gleichzeitig mit Darwins Hauptwerk. Das ist die Genealogie der Herrenmoral. Der „Wille zur Macht“, ins Reale, Politische, Nationalökonomische übersetzt, findet seinen stärksten Ausdruck in Shaws „Major Barbara“. Sicherlich ist Nietzsche als Persönlichkeit der Gipfel dieser Reihe von Ethikern, aber hier reicht Shaw, der Parteipolitiker, als Denker an ihn heran. Der Wille zur Macht ist heute durch die beiden Pole des öffentlichen Lebens, die Arbeiterklasse und die großen Geld- und Gehirnmenschen, viel entschiedener vertreten als je durch einen Borgia. Der Milliardär Undershaft in dieser besten Komödie Shaws ist Übermensch. Nur hätte Nietzsche, der Romantiker, sein Ideal nicht wieder erkannt. Er sprach stets von einer Umwertung, einer Philosophie der Zukunft, also doch zunächst der westeuropäischen und nicht chinesischen oder afrikanischen Zukunft, aber wenn seine immer in dionysischer Ferne verschwimmenden Gedanken sich wirklich einmal zu greifbaren Gebilden verdichteten, so erschien ihm der Wille zur Macht unter dem Bilde von Dolch und Gift und nicht von Streiks und der Energie des Geldes. Trotzdem hat er erzählt, daß die Idee ihm zuerst im Kriege von 1870 und beim Anblick[S. 522] preußischer Regimenter, die zur Schlacht marschierten, aufgegangen sei.
Die gesamte Dramatik dieser Epoche ist nicht mehr Dichtung im alten, im Kultursinne, sondern praktische Konstruktion, Debatte und Beweisführung: die Schaubühne wurde durchaus als „moralische Anstalt betrachtet“. Selbst Nietzsche neigte wiederholt zu dramatischer Fassung seiner Gedanken. Richard Wagner hat in seiner Nibelungendichtung, vor allem in der frühesten Fassung um 1850, seine sozialrevolutionären Ideen niedergelegt, und Siegfried ist auf dem Umwege über künstlerische und außerkünstlerische Einwirkungen noch im vollendeten „Ring“ eine Inkarnation des „vierten Standes“, der Fafnirhort des Kapitalismus, Brünhilde des „freien Weibes“ geblieben. Die Musik zur geschlechtlichen Zuchtwahl, deren Theorie, die „Abstammung der Arten“, 1859 erschien, findet sich eben damals im dritten Akte des Siegfried und im Tristan. Es ist kein Zufall, daß Wagner, Hebbel und Ibsen beinahe gleichzeitig die Dramatisierung des Nibelungenstoffes unternahmen. Hebbel, als er in Paris Schriften von Fr. Engels kennen lernt, drückt sein Erstaunen darüber aus (Brief vom 2. April 1844), daß er das soziale Prinzip der Zeit, wie er es damals in einem Drama „Zu irgendeiner Zeit“ darstellen wollte, ganz ebenso aufgefaßt habe wie der Verfasser des kommunistischen Manifestes, und bei seiner ersten Bekanntschaft mit Schopenhauer (Brief vom 29. März 1857) überrascht ihn auch die Verwandtschaft der „Welt als Wille und Vorstellung“ mit wichtigen Tendenzen, die er seinem Holofernes und „Herodes und Mariamne“ zugrunde gelegt hatte. Hebbels Tagebücher, deren wichtigster Teil zwischen 1835 und 1845 niedergeschrieben wurde, sind eine der tiefsten philosophischen Leistungen des Jahrhunderts, ohne daß er sich dessen bewußt gewesen wäre. Man würde nicht erstaunt sein, ganze Sätze von ihm wörtlich bei Nietzsche zu finden, der ihn nie gekannt und nur in seinen besten Momenten erreicht hat.
Ich gebe hier eine Übersicht über die wirkliche Philosophie des 19. Jahrhunderts, deren einziges und eigenstes Thema die Konzeption des Willens zur Macht in einer zivilisiert-intellektuellen Gestalt, als Wille zum Leben, Lebenskraft, als praktisch-dynamisches Prinzip, als Begriff oder dramatische Gestalt ist.[S. 523] Die mit Shaw abgeschlossene Epoche repräsentiert das Klimakterium der abendländischen Geistigkeit und entspricht darin der antiken zwischen 350 und 250. Der Rest ist, mit Schopenhauer zu reden, Professorenphilosophie der Philosophieprofessoren.
1819 Schopenhauer „Welt als Wille und Vorstellung“: der Wille zum Leben zum erstenmal als einzige Realität („Urkraft“) in den Mittelpunkt gestellt, aber noch unter dem Eindruck des voraufgegangenen Idealismus zur Verneinung empfohlen.
1836 Schopenhauer „Über den Willen in der Natur“: Antizipation des Darwinismus, metaphysisch verkleidet.
1840 Proudhon „Qu’est-ce que la Propriété!“ (Grundlage des Anarchismus).
1841 Hebbel „Judith“: erste dramatische Konzeption des „neuen Weibes“ und des Übermenschen (Holofernes). — Feuerbach, Wesen des Christentums.
1844 Engels „Umriß der Kritik einer Nationalökonomie“: Grundlage der materialistischen Geschichtsauffassung. — Hebbel „Maria Magdalena“: das erste soziale Drama.
1847 Marx „Misère de la Philosophie“ (Synthese von Hegel und Malthus). Diese Jahre die entscheidende Epoche, mit welcher die Nationalökonomie die Sozialethik und Biologie zu beherrschen beginnt.
1848 Wagner „Siegfrieds Tod“: Siegfried als sozialethischer Revolutionär, der Fafnirhort als Symbol des Kapitalismus.
1850 Wagner „Kunst und Klima“: das Sexualproblem.
1850–58 Wagners, Hebbels und Ibsens Nibelungendichtungen.
1859 ein symbolisches Zusammentreffen: Darwin „Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl“ (Anwendung der Nationalökonomie auf die Biologie) und „Tristan und Isolde“. — Marx „Zur Kritik der politischen Ökonomie“.
1865 Dühring „Wert des Lebens“, selten genannt, aber von höchstem Einfluß auf die nächste Generation.
1867 Ibsen „Brand“ und das „Kapital“ von Marx.
1878 Wagner „Parsifal“: erste Auflösung des Materialismus in Mystizismus.
1879 Ibsen „Nora“.
[S. 524]
1881 Nietzsche „Morgenröte“: Übergang von Schopenhauer zu Darwin, die Moral als biologisches Phänomen.
1883 der „Zarathustra“: der Wille zur Macht, aber romantisch-philologisch verkleidet.
1886 „Rosmersholm“ (die „Adelsmenschen“) und „Jenseits von Gut und Böse“.
1887/88 Strindberg „Vater“ und „Fräulein Julie“.
1890 der nahende Abschluß der Epoche: die religiösen Werke Strindbergs, die symbolistischen Ibsens.
1896 Ibsen „John Gabriel Borkman“.
1898 Strindberg „Nach Damaskus“.
Seit 1900 die letzten Erscheinungen.
1903 Weininger „Geschlecht und Charakter“: der einzige ernste Versuch, Kant durch Beziehung auf Wagner und Ibsen innerhalb dieser Epoche wiederzubeleben.
1903 Shaw „Mensch und Übermensch“: letzte Synthese von Darwin und Nietzsche.
1905 Shaw „Major Barbara“: der Typus des Übermenschen auf seinen wirtschaftspolitischen Ursprung zurückgeführt.
Damit hat sich, nach der metaphysischen Periode, auch die ethische erschöpft. Der ethische Sozialismus, von Fichte, Hegel, Humboldt vorbereitet, hatte die Zeit seiner leidenschaftlichen Größe um die Mitte des 19. Jahrhunderts. An dessen Ende war er schon im Stadium der Wiederholungen angelangt und das 20. Jahrhundert hat, unter Beibehaltung des Wortes Sozialismus, an Stelle einer ethischen Philosophie, die nur Epigonen als unvollendet erscheint, eine Praxis wirtschaftlicher Tagesfragen gesetzt. Die Weltstimmung des Abendlandes wird eine sozialistische bleiben, aber ihre Theorie hat aufgehört Problem zu sein. Es besteht die Möglichkeit einer dritten und letzten Art westeuropäischer Philosophie: die eines historisch-psychologischen Skeptizismus. Das Geheimnis der Welt erscheint nacheinander als Erkenntnisproblem, Wertproblem, Formproblem. Kant sah die Ethik als Erkenntnisgegenstand, das 19. Jahrhundert sah die Erkenntnis als Gegenstand einer Wertung. Der Skeptiker würde beide lediglich als historische Phänomene betrachten.
[104] Nach dem, was über das Fehlen prägnanter Worte für „Wille“ und „Raum“ in den antiken Sprachen und die tiefere Bedeutung dieser Lücken bemerkt worden ist, wird es nicht auffallen, daß auch der Unterschied von Tat und Tätigkeit (Handlung, Geschehen) sich weder im Griechischen noch im Lateinischen exakt wiedergeben läßt.
[105] „Wer Ohren hat zu hören, der höre“ — darin liegt kein Machtanspruch. So hat die abendländische Kirche ihre Mission nicht aufgefaßt. Die „Heilsbotschaft“ Jesu, die des Mani, der Mithrasreligion, der Neuplatoniker und all der benachbarten spätantik-syrischen Kulte sind geheimnisvolle Wohltaten, die man erweist, nicht aufdrängt. Das junge Christentum ahmte, nachdem es in die antike Welt eingeströmt war, lediglich die Mission der späten Stoa nach. Man mag Paulus zudringlich finden und man hat die stoischen Wanderprediger so gefunden, wie die Zeitliteratur beweist; gebieterisch treten sie nicht auf. Man kann ein entlegenes Beispiel hinzufügen und die Ärzte der magischen Art, die ihre geheimnisvollen Arkana anpriesen, den abendländischen gegenüberstellen, die ihrem Wissen Gesetzeszwang verliehen (Impfzwang, Trichinenschau usw.).
[106] Im Zarathustra heißt es („Von der schenkenden Tugend“): Aufwärts geht unser Weg, von der Art hinüber zur Über-Art. Aber ein Grauen ist uns der entartende Sinn, welcher spricht: „Alles für mich.“ Diese Stelle ist rein sozialistisch und darwinistisch, aber gewiß nicht hellenisch — „dionysisch — gedacht.“
[107] Dies ist die Formel der Barockphilosophie von Descartes bis Kant. Die gotische Philosophie gestaltete das gleiche Gefühl zur Frage nach dem Primat des Willens oder der Vernunft. Duns Scotus hat hier im Namen des nordischen, des dynamischen Lebensgefühls, den Satz „Voluntas est superior intellectu“ der magisch-augustinischen Meinung des Thomas von Aquino entgegengestellt. Schon hier kündigt sich die Konzeption Schopenhauers von der Welt als Wille und Vorstellung oder der Welt als Lebenskraft und dem Intellekt als deren Werkzeug (Schelling, Nietzsche) an.
[108] Der erste beruht auf dem atheistischen System des Sankhya, der zweite durch Sokrates’ Vermittlung auf der Sophistik, der dritte auf dem englischen Sensualismus.
[109] Erst nach Jahrhunderten hat man aus der buddhistischen Lebensbetrachtung, die weder einen Gott noch eine Metaphysik anerkennt, durch Zurückgreifen auf die längst erstarrte brahmanische Theologie das Surrogat einer Religion gemacht.
[110] Und es müßte erst gesagt werden, ob mit dem Christentum der Kirchenväter oder mit dem der Kreuzzüge, denn dies sind zwei verschiedene Religionen unter derselben dogmatisch-kultischen Gewandung. Der gleiche Mangel an historisch-psychologischem Feingefühl tritt in dem beliebten Vergleich des heutigen Sozialismus mit dem Urchristentum zutage.
[111] Man beachte die auffallende Ähnlichkeit vieler Römerköpfe mit denen heutiger Tatsachenmenschen amerikanischen Stils und, wenn auch nicht so deutlich, mit manchen ägyptischen Porträtköpfen des Neuen Reichs.
[112] Das Latein des 3. Jahrhunderts v. Chr. war noch eine bewegliche farbenreiche Bauernsprache.
[113] Auch die äußerst moderne Idee, daß die unbewußten, instinkthaften Lebensakte Vollkommenes bewirken, während der Intellekt es nur zu stümperhaften Leistungen bringt, findet sich bei ihm (Band II, Kap. 20).
[114] Im Kapitel „Zur Metaphysik der Geschlechtsliebe“ (II, 44) ist der Gedanke der Zuchtwahl als des Mittels zur Erhaltung der Gattung in vollem Umfang vorweggenommen.
[S. 525]
[S. 527]
In einer berühmt gewordnen Rede sagte Helmholtz 1869: „Das Endziel der Naturwissenschaft ist, die allen Veränderungen zugrunde liegenden Bewegungen und deren Triebkräfte zu finden, also sich in Mechanik aufzulösen.“ In Mechanik, das bedeutet die Zurückführung aller qualitativen Eindrücke auf unveränderliche quantitative Grundwerte, auf Ausgedehntes also und dessen Ortsveränderung; das bedeutet weiterhin, wenn man sich des Gegensatzes von Werden und Gewordnem, Erlebtem und Erkanntem, von Gestalt und Gesetz, Bild und Begriff erinnert, die Zurückführung des Naturbildes auf eine einheitliche, zahlenmäßige Ordnung von meßbarer Struktur. Die eigentliche Tendenz aller Mechanik geht auf eine geistige Besitzergreifung durch Messung; sie ist deshalb genötigt, das Wesen der Erscheinung in einem System konstanter, der Messung restlos zugänglicher Elemente zu suchen, deren wichtigster nach der Definition von Helmholtz mit dem — der Sphäre des Lebens entnommenen — Worte Bewegung bezeichnet wird.
Dem Physiker erscheint diese Definition unzweideutig und erschöpfend; dem Skeptiker, der die Psychologie dieser wissenschaftlichen Überzeugung verfolgt, nicht. Dem einen ist die gegenwärtige Mechanik ein folgerichtiges System von klaren eindeutigen Begriffen und ebenso einfachen als notwendigen Beziehungen, dem andern ist sie eine die Struktur des westeuropäischen Geistes bezeichnende Illusion, allerdings von höchster Konsequenz des Aufbaus und stärkster intellektueller Wirksamkeit. Daß durch alle praktischen Resultate und Entdeckungen nichts für die absolute Geltung der Theorie bewiesen wird, versteht sich von selbst. Den meisten erscheint „die“ Mechanik allerdings als die selbstverständliche Fassung von Natureindrücken, aber sie scheint es nur. Denn was ist Bewegung? Daß alles Qualitative auf die Bewegung unveränderlicher, gleichartiger[S. 528] Massenpunkte zurückführbar sei — ist das nicht schon ein rein faustisches, kein allgemein menschliches Postulat? Archimedes z. B. fühlte durchaus nicht das Bedürfnis, mechanische Einsichten auf Bewegung zu reduzieren. Ist Bewegung überhaupt eine rein mechanische Größe? Ist sie ein Wort für eine Art von Anschauung oder ein abstrakter Begriff? Und wenn es der Physik wirklich eines Tages gelänge, ihr vermeintliches Ziel zu erreichen und alles sinnlich Erfaßbare in ein lückenloses System gesetzmäßig fixierter Bewegungen und der in ihnen wirksamen Energien zu bringen, wäre sie damit in der Erkenntnis auch nur um einen Schritt vorwärts gekommen? Ist die Formensprache der Mechanik darum weniger dogmatisch? Enthält sie nicht vielmehr die Symbolik der halbmystischen Urworte, welche die Erfahrung beherrschen statt aus ihr hervorzugehen, gerade in ihrer schärfsten Fassung? Was ist Kraft? Was ist eine Ursache? Was ist ein Prozeß? Ja — hat die Physik überhaupt, selbst auf Grund ihrer eigenen Definitionen, eine eigentliche Aufgabe? Besitzt sie ein durch alle Jahrhunderte gültiges Endziel? Besitzt sie, um ihre Resultate auszusprechen, auch nur eine unanfechtbare Gedankengröße?
Die Antwort kann vorweggenommen werden. Die heutige Physik, als bloße Wissenschaft, an sich und vom Standpunkt des Forschers aus betrachtet, mag ein genau bestimmbares Thema haben; als historisches Phänomen ist die Physik nach Aufgabe, Methode und Resultat Ausdruck und Verwirklichung eines einzelnen Seelentums, Element eines Makrokosmos, jedes ihrer Ergebnisse ein Symbol. Was die Physik, die ja lediglich im Geiste einzelner Kulturmenschen existiert, durch diese zu finden vermeint, lag der Art und Weise ihres Suchens schon zugrunde. Ihre Entdeckungen sind dem eigentlichen Gehalte nach, außerhalb der Formeln, selbst im Kopfe so vorsichtiger Forscher, wie es J. R. Mayer, Faraday und Hertz waren, rein intuitiver Natur. Angesichts aller physikalischen Exaktheit unterscheide man in einem Naturgesetz wohl zwischen unbenannten Zahlen und deren Benennung, zwischen einer bloßen Formel und deren theoretischem Sinn. Die Formeln zwar stellen allgemein logische Werte dar, reine Zahlen, objektive Raum- und Grenzmomente [S. 529]also, aber Formeln sind stumm. Der Ausdruck s = gt22 bedeutet gar nichts, solange ich bei den Buchstaben nicht an bestimmte Worte und deren Bildsinn denke. Kleide ich die toten Zeichen aber in Worte, gebe ich ihnen Fleisch, Körper, Leben, eine sinnliche Weltbedeutung überhaupt, so habe ich die Schranken einer bloßen Ordnung überschritten. Θεωρία heißt Bild, Vision. Erst sie macht aus einer mathematischen Formel ein wirkliches Naturgesetz. Alles Exakte an sich ist sinnlos; der Sinn gehört nicht mehr dem Erkennen, sondern dem unmittelbaren Lebensgefühl. Und eben die Theorien, nicht die reinen Zahlen sind die Quintessenz aller Naturerkenntnis. Die unbewußte Sehnsucht jeder echten Wissenschaft, die — es sei noch einmal gesagt — lediglich im Geiste von Kulturmenschen existiert, richtet sich auf das Begreifen, das Durchdringen und Umfassen des naturhaften Weltganzen, nicht auf die messende Tätigkeit an sich, die immer nur eine Freude unbedeutender Köpfe gewesen ist. Zahlen sollten stets nur der Schlüssel zum Geheimnis sein. Um der Zahlen selbst willen hätte kein bedeutender Mensch jemals Opfer gebracht.
Zwar sagt Kant an einer bekannten Stelle: „Ich behaupte, daß in jeder besonderen Naturlehre nur so viel eigentliche Wissenschaft angetroffen werden könne, als darin Mathematik anzutreffen ist.“ Gemeint ist die reine Grenzsetzung in der Sphäre des Gewordnen, insofern sie als Gesetz, Formel, Zahl, System erscheint, aber ein Gesetz ohne Worte, eine Zahlenreihe als bloße Ablesung der Angaben von Meßinstrumenten ist ohne Sinn, ist als geistiger Akt in vollkommener Reinheit nicht einmal vollziehbar. Jedes Experiment, jede Beobachtung wächst aus einer mehr als mathematischen Gesamtanschauung hervor. Jede Erfahrung ist, sie mag sonst sein was sie will, auch ein schöpferischer Akt. Alle benannten Gesetze sind belebte, durchseelte Ordnungen, vom innersten Gehalte einer und nur einer Kultur erfüllt. Will man von Notwendigkeit reden, da sie eine Forderung aller exakten Forschung ist, so liegt eine doppelte vor: eine Notwendigkeit im Seelischen und Schöpferischen, insofern aller symbolische Gehalt, jede Wissenschaft als historische Erscheinung ein Schicksal ist, und eine Notwendigkeit im Gewordnen, für die uns Westeuropäern der Name Kausalität[S. 530] geläufig ist. Mögen die reinen Zahlen einer physikalischen Formel eine logische Notwendigkeit darstellen, das Vorhandensein, die Entstehung, die Lebensdauer einer Theorie ist ein Schicksal.
Jede Tatsache, selbst die einfachste, enthält bereits eine Theorie. Eine Tatsache ist ein Vorgang des wachen Bewußtseins, und alles hängt davon ab, ob es ein Mensch der Antike oder des Abendlandes, der Gotik oder des Barock ist, für den sie „vorliegt“. Der Physiker von heute vergißt zu leicht, daß schon Worte wie Größe, Lage, Prozeß, Zustandsänderung, Körper spezifisch abendländische Bilder darstellen, die dem antiken oder arabischen Denken und Weltgefühl gänzlich fremd sind, die aber den Charakter der wissenschaftlichen Tatsachen als solcher, die Art des Erkanntwerdens vollkommen beherrschen, ganz zu schweigen von komplexen Begriffen wie Arbeit, Spannung, Wirkungsquantum, Wärmemenge, Wahrscheinlichkeit,[115] welche jeder für sich eine physikalische Gesamtanschauung in nuce enthalten. Wir empfinden derartige gedankliche Bildungen als Resultate einer vorurteilsfreien Forschung, unter Umständen als endgültige. Ein feiner Kopf aus der Zeit des Archimedes würde nach gründlichem Studium der modernen theoretischen Physik versichert haben, es sei ihm unbegreiflich, wie jemand so willkürliche, groteske und verworrene Vorstellungen als Wissenschaft und noch dazu als notwendige Konsequenzen der vorliegenden Tatsachen ansprechen könne. Wissenschaftlich gerechtfertigte Folgerungen seien vielmehr — und er würde seinerseits auf Grund derselben „Tatsachen“, der mit seinem Auge gesehenen und in seinem Geiste gestalteten Tatsachen nämlich, Theorien entwickelt haben, denen unsre Physiker mit erstauntem Lächeln zugehört hätten.
Welches sind denn die Grundvorstellungen, die sich im Gesamtbilde der heutigen Physik mit innerer Folgerichtigkeit entwickelt haben? Polarisierte Lichtstrahlen, wandernde Ionen, die fliehenden und geschleuderten Gasteilchen der kinetischen[S. 531] Gastheorie (die heute den Schwerpunkt der mechanischen Naturanschauung darstellt), magnetische Kraftfelder, elektrische Ströme und Wellen — sind das nicht sämtlich faustische Visionen, faustische Symbole von engster Verwandtschaft mit der romanischen Ornamentik, der gotischen Tektonik, den Wikingerfahrten in unbekannte Meere, der Sehnsucht des Kolumbus und Kopernikus nach dem Unendlichen? Ist diese Formen- und Bilderwelt nicht in tiefster Kongruenz mit den gleichzeitigen Künsten, der perspektivischen Ölmalerei und der kontrapunktischen Instrumentalmusik erwachsen? Ist das nicht unsre seelische Dynamik, der Wille zur Macht, der das eigne innere Seinsgefühl visionär in das vorgestellte Leben der Umwelt projiziert hat?
Und insofern behaupte ich, daß allem „Wissen“ von der Natur, auch dem exaktesten, ein religiöser Glaube zugrunde liegt. Die reine Mechanik, auf welche die Natur zurückzuführen die Physik als ihr Endziel bezeichnet, ein Ziel, dem diese Bildersprache dient, setzt ein Dogma voraus, durch welches sie geistiges Eigentum der abendländischen Kulturmenschheit und nur dieser ist. Es gibt keine Wissenschaft ohne unbewußte Voraussetzungen, über welche der Forscher keine Macht besitzt, und zwar Voraussetzungen, welche sich bis in die frühesten Tage der erwachenden Kultur zurückführen lassen. Es gibt keine Naturwissenschaft ohne eine voraufgegangene Religion. In diesem Punkte besteht kein Unterschied zwischen katholischer und materialistischer Naturanschauung: sie sagen dasselbe mit andern Worten. Auch die atheistische Wissenschaft hat Religion; die moderne Mechanik ist Stück für Stück ein Abbild christlicher Dogmen.
Keine Wissenschaft ist nur System, nur Gesetz, Zahl und Ordnung; jede ist als historisches Phänomen ein lebendiger, in denkenden Menschen sich verwirklichender, vom Schicksal einer Kultur bestimmter Organismus. In der modernen Physik liegt nicht nur eine logische, sondern auch eine historische Notwendigkeit. Sie ist nicht nur Sache der Intelligenz, sondern auch der Rasse. Diese Notwendigkeit im Werden und Vergehen,[S. 532] welche die individuelle Formensprache, das spezifisch Faustische nach Gehalt und Bedeutung bestimmt, ist wohl zu unterscheiden von der Gruppe unbedingter Verstandesbegriffe a priori, die nach Kants Ansicht die bloße sinnliche Wahrnehmung zu einer allgemeingültigen Erfahrung machen. Die Allgemeingültigkeit in diesem Umfange, über alle einzelnen Kulturen hinaus, ist eine Illusion. Es gibt gerade in diesen tiefsten Vorbedingungen der Naturerkenntnis etwas, das der einzelnen Kultur als solcher zukommt. „Natur“ ist eine Funktion der jeweiligen Kultur.
Ich betrachte demnach ein physikalisches Weltbild als die Nachwirkung, den Ausdruck einer Religion, den zivilisiertesten, seelenlosesten ohne Zweifel, den spätesten von allen, insofern die Frühzeit jeder Kultur, die Dorik, das Zeitalter des Plotin und Origenes, die Gotik von dieser kühlen, streng intellektuellen Fassung weit entfernt ist und in der homerischen, der frühchristlich-orientalischen, der katholisch-germanischen Weltidee das ausgebildet hat, dessen letzte Gestalt in der abstrakten Formenwelt der jeweiligen naturwissenschaftlichen Systeme erscheint. Jede Physik — das Wort in einem freiem Sinne genommen — setzt nicht nur eine bestimmte Religion voraus, sie ist in jedem Zuge von ihr abhängig und bedingt; sie ist ihr letztes Lebenszeichen.
Das Vorurteil des auf die Höhe der Ionik und des Barock gelangten städtischen Menschen bringt das Phänomen der exakten Wissenschaft in einen hochmütigen Gegensatz zur voraufgehenden Religion, als die überlegene Stellung zu den Dingen, im Alleinbesitz der wahren Erkenntnismethoden und am Ende berechtigt, die Religion selbst (ihre „Vorstufe“) empirisch und psychologisch zu erklären, zu „überwinden“. Nun zeigt die Geschichte, daß „Wissenschaft“ ein spätes und vorübergehendes Phänomen ist, dem Herbst und Winter großer Kulturen angehörend, im antiken, wie im indischen, chinesischen, arabischen Seelentum von der Lebensdauer weniger Jahrhunderte, innerhalb deren sich ihre Möglichkeiten erschöpfen. Die antike Wissenschaft ist zwischen den Schlachten von Cannä und Actium erloschen. Danach ist es möglich, das Ende der abendländischen Naturwissenschaft vorauszuberechnen.
[S. 533]
Nichts berechtigt dazu, dieser geistigen Formenwelt den Vorrang vor andern zu geben. Jede Wissenschaft ruht wie jeder Mythus, jeder religiöse Glaube überhaupt auf einer Innern Gewißheit; ihre Bildungen sind von anderm Bau und Klang, ohne prinzipiell verschieden zu sein. Alle Einwände, welche die Naturwissenschaft gegen die Religion richtet, treffen sie selbst. Es ist ein großes Vorurteil, jemals an Stelle „anthropomorpher“ Vorstellungen „die Wahrheit“ setzen zu können. Andre als anthropomorphe Vorstellungen gibt es überhaupt nicht. „Der Mensch schuf Gott nach seinem Bilde“ — so gewiß das von jeder historischen Religion gilt, so gewiß gilt es von jeder physikalischen, vermeintlich noch so gut begründeten Theorie. Eine jede ist selbst Mythus und in jedem ihrer Züge anthropomorph präformiert. Es gibt keine reine Naturwissenschaft, es gibt nicht einmal eine Naturwissenschaft, die als allgemein menschlich bezeichnet werden könnte.
Jede Kultur hat sich eine eigne gebildet, die für sie allein wahr ist und es nur so lange bleibt, als die Kultur lebendig und im Verwirklichen ihrer innern Möglichkeiten begriffen ist. Ist eine Kultur zu Ende und damit das schöpferische Element, die Bildkraft, die Symbolik erloschen, so bleiben „leere“ Formeln, Gerippe von toten Systemen übrig, die ganz buchstäblich als sinnlos und wertlos empfunden, mechanisch beibehalten oder verachtet und vergessen werden. Man denke an die Wissenschaften des spätesten Altertums. Zahlen, Formeln, Gesetze bedeuten nichts, sind nichts. Sie müssen einen Leib haben, den ihnen ein lebendes Menschentum verleiht, indem es in ihnen und durch sie lebt, sich zum Ausdruck bringt, sie innerlich in Besitz nimmt. Und deshalb gibt es keine absolute Physik, nur einzelne, auftauchende und schwindende Physiken innerhalb einzelner Kulturen.
Physik ist die intellektuelle Formulierung des Naturgefühls, das jeder Kulturmensch besitzt. Ein Naturgefühl — das hatten wir den Griechen abgestritten, weil das ihre so anders geartet war, daß wir es als solches nicht erkannten. Unser Naturgefühl, in Malerei, Musik und Lyrik immer wieder ausgesprochen, eine mächtige Leidenschaft für Fernen und Horizonte und nur insofern für Landschaften, Himmel, Wolken, Wälder, Gebirge,[S. 534] Meere, als sie Träger und Ausdruck eines Unendlichen sind, ist der strenge Gegensatz zum antiken, das sich an schöne nackte Einzelformen, an das Nahe, Greifbare, Gegenwärtige hält und gerade darum das Auge vor dem Grenzenlosen der freien Landschaft verschließt. Die „Natur“ des antiken Menschen fand ihr höchstes Symbol in der nackten menschlichen Statue, nicht im Landschaftsgemälde; aus ihr erwuchs folgerichtig die mechanische Statik, die Physik der Nähe; aus der unsren die mechanische Dynamik, die Physik der Ferne: zur apollinischen Natur gehören die Vorstellungen von Stoff und Form und die Entelechie des Aristoteles, zur faustischen die Bilder der Fernkräfte, der Kraftfelder, des Potentials.
Die Grundworte der antiken Naturphilosophie, ἄπειρον, ἀρχή, μορφή, ὕλη u. a. sind sämtlich in abendländischen Sprachen unübersetzbar und darum geistig nicht genau nachzuerleben. Wir haben ganz andre Worte, in deren elementarem Gehalt unser Weltgefühl kristallisiert, und mithin eine ganz andre „Natur“. Das πάντα ῥεῖ Heraklits (wobei man an den Leib eines Tanzenden denken sollte, dessen Erscheinung „im Fluß“ ist) mit Bewegung, die ἀρχή mit Urstoff oder Ursprung übersetzen heißt das wirklich Apollinische daraus beseitigen und den leeren Rest, das Wort, mit einem fremden, abendländischen Sinn ausfüllen. Man denke über den Unterschied des πάντα ῥεῖ eines antiken Grundgefühls, vom „Prozeß“ (von procedere, vorschreiten) unserer Dynamik nach. Die antike Ethik ging auf eine vollkommene Haltung, die faustische auf Tat, intellektualisiert als „Fortschritt“, materialisiert als Arbeit, öffentlich geworden als Sozialismus. Das kehrt hier im physikalischen Bilde wieder. Unsre Idee der Bewegung hat eine Tendenz, eine Richtung zum Unendlichen, ein Ziel; der antike Sinn der Bewegung ist lediglich ἀλλοίωσις, Veränderung. Unser Lebensgefühl hat den Willen zur Macht, ein Extrem von Aktivität, zum Mittelpunkt. Das ist der Sinn der Gottesidee von den Tagen der Gotik an, im Gegensatz zum Gotte des arabischen Christentums. Das mußte mithin der Ausgang aller physikalischen Theorie werden. Wie Schicksal zur Kausalität, wie Organisches zum Mechanischen, so verhält sich das Machtgefühl der faustischen Seele, ihr Wille, ihr Gott, zum Kraftbegriff ihrer[S. 535] Physik, den sie als ihr Symbol geschaffen hat und der mit ihr erlöschen wird.
Man hatte den historischen Zusammenhang bisher so formuliert, daß „bei den Griechen“ sich die Anfänge der wissenschaftlichen Physik fänden, daß „im Mittelalter“ alles verschüttet gewesen sei und nur die Araber einiges für die Chemie getan hätten, bis „in der Neuzeit“ endlich ein Wiedererwachen des wissenschaftlichen Geistes erfolgte.
In der Tat hatte der antike Geist seine äußere Welt in einer Statik greifbarer Körper geordnet. Das war die Physik als Plastik. Der arabische Geist suchte in seiner Welt, wie sie dem Isis- und Mithrasglauben, dem Neuplatonismus und der Gnosis, dem frühen Christentum der Apokalypse, des Origenes und des Konzils von Nicäa zugrunde liegt, die magische Substanz dieser Körper zu ergründen und der „Stein der Weisen“ war ein Jahrtausend hindurch das Symbol einer ganz anders gearteten, aber in sich geschlossenen und durchaus folgerichtigen Naturwissenschaft. Die euklidische Geometrie verhält sich zur arabischen Algebra wie die Physik, für welche Empedokles seine berühmten vier Elemente aufstellte, die nichts andres waren als die vier möglichen, sichtbaren, greifbaren, rein gegenwärtigen Zustände von Einzeldingen,[116] zur Alchymie der orientalischen Landschaft, die demgegenüber das Bild des chemischen Elementes schuf, jene Art magischer Stoffe, die aus den Dingen erscheinen und wieder in ihnen verschwinden, die sogar den Einflüssen der Gestirne unterliegen. Die Alchymie enthält den tiefen wissenschaftlichen Zweifel an der plastischen Wirklichkeit der Dinge, der σώματα griechischer Mathematiker, Physiker und Dichter, die sie auflöst, zerstört, um das Geheimnis ihres Wesens zu finden. Ein tiefer Unglaube an die Gestalt, in welcher die Natur erscheint, die Gestalt, welche den Griechen Inbegriff aller Wirklichkeit war, offenbart sich.[S. 536] Der Streit um die Person Christi auf allen frühen Konzilen, der zu den arianischen und monophysitischen Spaltungen führte, ist ein alchymistisches Problem. Es wäre keinem antiken Physiker eingefallen, die Dinge zu erforschen, indem er ihre anschauliche Form verneinte oder vernichtete. Es gibt deshalb keine antike Chemie, so wenig es eine antike Theorie über das Göttliche in der substantiellen Erscheinung des Apollo oder der Aphrodite gab.
Die chemische Methode ist das Zeichen eines neuen Weltgefühls. Ihre Erfindung knüpft sich an den Namen jenes rätselhaften Hermes Trismegistos, der in Alexandria gleichzeitig mit Plotin und Diophant, dem Begründer der Algebra, gelebt hat. Mit einem Schlage ist die mechanische Statik, die apollinische Naturwissenschaft zu Ende. Und wieder gleichzeitig mit der endgültigen Emanzipation der faustischen Mathematik durch Newton und Leibniz befreite sich auch die abendländische Chemie von ihrer arabischen, magischen Form durch Stahl (1660–1734) und dessen Phlogistontheorie. Die eine wie die andre wird reine Analysis. Schon Paracelsus (1493–1541) hatte die magische Tendenz, Gold zu machen, in eine arzneiwissenschaftliche umgewandelt. Man spürt darin ein verändertes Weltgefühl. Robert Boyle (1626–1691) hat dann die analytische Methode und damit den westeuropäischen Begriff des Elements geschaffen. Aber man täusche sich darüber nicht: Was man die Begründung der modernen Chemie nennt, deren Epochen durch die Namen Stahl und Lavoisier bezeichnet werden, ist nichts weniger als eine Ausbildung chemischer Gedanken, sofern man darunter arabische, alchymistische Naturanschauungen versteht. Sie ist das Ende der eigentlichen Chemie, ihre Auflösung in das umfassende System der Dynamik, ihre Einordnung in diejenige mechanische Naturanschauung, welche das Barock durch Galilei und Newton begründet hatte. Die Elemente des Empedokles bezeichnen ein äußeres Sichverhalten, die Elemente der Akademie von Cordova ein geheimnisvolles Wunder, die Elemente der Verbrennungstheorie Lavoisiers (1777), die der Entdeckung des Sauerstoffs (1771) folgte, eine dem menschlichen Willen unterworfene Formeinheit. Durch unsere Analysen und Synthesen wird die Natur nicht befragt[S. 537] oder überredet, sondern bezwungen. Die moderne Chemie ist ein Kapitel der modernen Physik der Tat.
Was wir Statik, Chemie, Dynamik nennen, historische Bezeichnungen ohne tieferen Sinn für die heutige Naturwissenschaft, sind die drei physikalischen Systeme der apollinischen, magischen und faustischen Seele, jedes in seiner Kultur erwachsen, jedes in seiner Geltung auf eine Kultur beschränkt. Dem entsprechen die Mathematiken der euklidischen Geometrie, der Algebra, der Analysis und die Künste der Statue, der Arabeske, der Fuge. Will man die drei Arten der Physik — denen jede andre Kultur wieder eine andre zur Seite setzen könnte und müßte — ihrer Methode nach unterscheiden, so hat man eine mechanische Ordnung von Zuständen, von geheimen Kräften, von Prozessen.
Nun hat die Tendenz des menschlichen Geistes, das Naturbild auf möglichst einfache quantitative Formeinheiten zurückzuführen, welche vergleichende Urteile, Messungen, Zählungen, kurz mechanische Wertungen gestatten, in der antiken und abendländischen Physik jedesmal zu einer Atomlehre geführt (von der höchst komplizierten arabischen, wie sie einen Streitpunkt der Schulen von Bagdad und Basra bildete, soll hier abgesehen werden). Der tiefsymbolische Unterschied beider Theorien ist aber unbeachtet geblieben.
Die antiken Atome sind Miniaturformen, die abendländischen sind Minimalquanta, d. h. dort ist die Anschaulichkeit, die Nähe Grundbedingung des Bildes, hier ist sie es nicht. Die atomistischen Vorstellungen der modernen Physik, zu denen auch die Elektronentheorie und die Quantenhypothese der Thermodynamik gehören, setzen mehr und mehr jene — rein faustische — innere Anschauung voraus, die auch auf manchen Gebieten der höheren Mathematik wie den nichteuklidischen Geometrien oder der Gruppentheorie gefordert wird und die dem Laien nicht zur Verfügung steht. In der Tat ist heute die Atomvorstellung um so flacher und falscher, je populärer sie auftritt, wie in den dilettantischen Büchern der Häckelschule, die vom Gehalte moderner physikalischer Theorien nicht[S. 538] das mindeste begriffen hat. Ein Quantum ist ein Ausgedehntes, abgesehen vom sinnlichen Augenschein, eine Abstraktion, welche die Beziehung auf Auge und Tastgefühl meidet, für die das Wort Gestalt keinen Sinn besitzt, eine Art Form also, die einem Griechen, einem geborenen Plastiker, gar nicht vorstellbar war. Der antike Physiker prüft das Aussehen, der abendländische die Wirksamkeit dieser letzten Elemente des Gewordnen. Das bedeuten die polaren Begriffe dort von Stoff und Form, hier von Kapazität und Intensität.
Ich hatte hervorgehoben, daß Erkenntnis ein Gewordensein für den Geist ist, daß ferner Erkennen sich als ein Begrenzen (Abgrenzen, Einfassen, Einteilen) darstellt. Nun, die Begrenzung in einem bestimmten Sinne bis zum äußersten getrieben führt immer und im Naturdenken jeder Kultur auf „Atome“, ein Non plus ultra der Begrenztheit, ihren Inbegriff und ihr Optimum. Die Atome der Logik sind die Begriffe, die Atome der Mathematik sind die Zahlen (Größen in der antiken, Beziehungen in der abendländischen Mathematik).
Es folgt daraus, daß in diesen letzten Möglichkeiten sich die Symbolik der einzelnen Kultur, des einzelnen Geistes mit voller Schärfe herausstellt. Die Atome des Leukippos und Demokrit (σχήματα) sind ausschließlich nach Gestalt und Größe verschieden, rein plastische Einheiten und nur in diesem Sinne, wie der Name sagt, „unteilbar“. Die Atome der Barockphysik, deren „Unteilbarkeit“ einen ganz andern, höchst immateriellen Sinn angenommen hat, sind, was jeder philosophisch geschulte Physiker zugeben wird, den Monaden Leibnizens wesensverwandt, letzte, in infinitesimaler Weise theoretisch begrenzte Einheiten von Wirkung, abstrakte Kraftpunkte also. Es ist gesagt worden, daß ein Atom, wie es der moderne Physiker sich vorstellt, ein komplizierteres Gebilde als eine Dynamomaschine ist.
Gäbe es eine literarisch und theoretisch entwickelte indische oder ägyptische Physik, so würden sie mit Notwendigkeit einen ganz andern Atomtypus hervorgebracht haben, dessen Geltung für sie allein zwingend gewesen wäre.
Die Atome der Ionik und des Barock, der hellenistischen und der heutigen westeuropäischen Physik unterscheiden sich[S. 539] wie Plastik und Musik, wie die Kunst der extremen Körperlichkeit und der extremen körperlosen Bewegtheit. Die Statue ist ganz Leib, Ruhe und Nähe, die Fuge, wie das Wort verrät, Flucht, Bewegtheit, Raum, Ferne. Der apollinische Mensch empfand den Kosmos als den Inbegriff leibhafter, mit dem Auge zu beherrschender Dinge — ob in Ruhe oder Bewegung, eine zweite Frage. Für das Weltsystem des faustischen Menschen aber ist sie die erste und dann erst kommt die Frage, was bewegt wird. Deshalb ist — das muß mit Entschiedenheit festgestellt werden — „Masse“ ein spezifisch abendländischer Begriff, der erst als Komplement zu dem metaphysischen Hauptbegriff der Kraft entsteht. So oft der Massebegriff seinen Inhalt geändert hat, es geschah immer nur, weil der Kraftbegriff anders definiert worden war. Der Begriff des Äthers verdankt seine Entstehung nur der modernen Energievorstellung. Masse ist, was die Kraft zu ihrer Wirksamkeit — logisch oder im Bilde — braucht, während im πάντα ῥεῖ der Heraklit und den entsprechenden andern Vorstellungen des antiken Weltgefühls das Substrat den unbedingten Vorrang hat. Die Materie ist dem antiken Auge nicht Träger der Bewegung, sondern die Bewegung eine Eigenschaft der Materie. Das Primäre ist dort die Form, hier die Kraft. Ich erinnere an den Gegensatz des apollinischen und faustischen Ursymbols, das dem gesamten Makrokosmos zugrunde liegt: den Gegensatz von Körper und unendlichem Raum. So gewiß der antike Mensch das „zwischen den Dingen“ als das Nichtseiende empfand, so gewiß liegt der modernen Physik das Gefühl zugrunde, daß eben das greifbar Körperliche das Nichtseiende ist und durch die Theorie aufgelöst, nicht bestätigt werden muß.
So wurde endlich die kinetische Gastheorie zum Schwerpunkt der atomistischen Vorstellungen. Von ihr aus erfolgte die Anwendung der dynamischen Atomistik, eine unvermerkte Annäherung an Leibniz, auf die Gebiete der physikalischen Chemie, der strahlenden Wärme, der Radioaktivität und endlich ihre Umgestaltung zur Ionen- und Elektronentheorie.
Es gibt einen Stoizismus und einen Sozialismus der Atome. Das ist die Definition der statisch-plastischen und der dynamisch-kontrapunktischen Atomistik, die ihrer Verwandtschaft[S. 540] zu den Gebilden der zugehörigen Ethik in jedem Gesetze, in jeder Definition Rechnung trägt. Die Menge der verworrenen Atome, duldend, vom Schicksal, vom blinden Zufall gestoßen — wie Ödipus — und im Gegensatz dazu die als Einheit wirkenden Atomsysteme, aggressiv, den Raum energetisch (als „Feld“) beherrschend, Widerstände überwindend — wie Macbeth —, aus diesem Grundgefühl sind beide mechanische Naturbilder entstanden. Nach Leukippos fliegen die Atome „von selbst“ im Leeren herum; Demokrit statuiert lediglich Stoß und Gegenstoß als Form der Ortsveränderung; Aristoteles erklärt die Einzelbewegungen für zufällig; bei Empedokles findet sich die Bezeichnung Liebe und Haß, bei Anaxagoras Zusammentreten und Auseinandertreten. Das alles sind auch Elemente der antiken Tragik. So verhalten sich die Figuren (σώματα) auf der Szene des attischen Theaters. Das sind also auch Daseinsformen der antiken Politik. Da finden wir diese winzigen Städte, politische Atome, in langer Reihe auf Inseln und an Küsten dahingelagert, jede eifersüchtig für sich bestehend und ewig der Anlehnung bedürftig, abgeschlossen und launisch bis zur Karikatur, von den planlosen, ordnungslosen Ereignissen der antiken Geschichte hin und her gestoßen, heute gehoben, morgen vernichtet — und ihnen gegenüber die dynastischen Staaten des 17. und 18. Jahrhunderts, politische Kraftfelder, von den Wirkungszentren der Kabinette und großen Diplomaten aus weitschauend, planmäßig gelenkt und beherrscht. Man versteht den Geist der antiken und abendländischen Geschichte nur aus diesem Gegensatz zweier Seelen; man versteht auch das atomistische Fundament beider Physiken nur aus diesem Vergleich. Galilei, der den Kraftbegriff, und die Milesier, die den Begriff der ἀρχή konzipierten, Demokrit und Leibniz, Archimedes und Helmholtz sind „Zeitgenossen“, Glieder derselben geistigen Stufe verschiedener Kulturen.
Aber die innere Verwandtschaft und Atomistik und Ethik geht weiter. Ich hatte gezeigt, wie die faustische Seele, deren Sein Überwindung des Augenscheins, deren Gefühl Einsamkeit, deren Sehnsucht Unendlichkeit ist, dies Bedürfnis nach Alleinsein, Ferne, Absonderung in all ihre Wirklichkeiten legt, in all ihre öffentlichen, geistigen, künstlerischen Formenwelten.[S. 541] Nietzsche hatte es das Pathos der Distanz genannt, nicht ohne eine tiefe Einsicht durch eine falsche Anwendung zu verderben. Das Pathos der Distanz ist gerade der Antike fremd, in der alles Menschliche der Nähe, Anlehnung, Gemeinsamkeit bedarf. Es unterscheidet den Geist des Barock von dem der Ionik, die Kultur des ancien régime von der des perikleischen Athen. Pathos der Distanz ist in Shakespeare, in Rembrandt, in Bach, in Napoleon, nicht in Sophokles, Phidias oder Alexander. Und dies Pathos, das den heroischen Täter vom heroischen Dulder unterscheidet, erscheint im Bilde der abendländischen Physik wieder: als Spannung. Das ist es, was in der Anschauung Demokrits nicht enthalten war. Das Prinzip von Stoß und Gegenstoß enthält die Negation einer raumbeherrschenden, mit dem Raume identischen Kraft. Im Bilde der antiken Seele fehlt dementsprechend das Element des Willens. Zwischen antiken Menschen, Staaten, Weltanschauungen besteht keine innere Spannung, trotz Zank, Neid und Haß, kein tiefes Bedürfnis nach Abstand, Alleinsein, Überlegenheit — folglich besteht sie auch nicht zwischen den Atomen des antiken Kosmos. Das Prinzip der Spannung — entwickelt in der Potentialtheorie —, in antike Sprachen und also Gedanken vollkommen unübertragbar, ist für die moderne Physik grundlegend geworden. Es enthält eine Interpretation des Begriffs der Energie (des Willens zur Macht im Weltall) und ist deshalb für uns ebenso notwendig als für antike Menschen unmöglich.
Die Atomlehre ist demnach ein Dogma, keine Erfahrung. In sie hat die Kultur, durch den Geist ihrer großen Physiker, ihr Wesen, sich selbst gelegt. Daß es eine Ausgedehntheit an sich gibt, unabhängig vom spezifischen Formgefühl des Erkennenden, ist eine Illusion. Man glaubt das Leben ausschalten zu können; man vergißt, daß eine Erkenntnis nicht nur ein Inhalt, sondern auch ein lebendiger Akt ist.
Die entscheidende Bedeutung des Tiefenerlebnisses, das mit dem Erwachen einer Seele und also mit der Schöpfung der ihr zugehörigen äußeren Welt identisch ist, war an einer früheren[S. 542] Stelle nachgewiesen worden. Danach liegt in der bloßen Sinnesempfindung nur Länge und Breite; durch den lebendigen, mit innerster Notwendigkeit sich vollziehenden Akt der Deutung, der wie alles Lebendige Richtung, Bewegtheit, Nichtumkehrbarkeit besitzt — das Bewußtsein davon macht den eigentlichen Gehalt des Wortes Zeit aus —, wird die Tiefe hinzugefügt und somit die Wirklichkeit, die Welt geschaffen. Das Leben selbst geht als dritte Dimension in das Erlebte ein. Der Doppelsinn des Wortes Ferne, als Zukunft und als Horizont, verrät den tiefern Sinn dieser Dimension, welche erst die Ausdehnung als solche hervorruft. Das erstarrte Werden ist das Gewordene, das erstarrte Leben die Raumtiefe des Erkannten. Descartes und Parmenides stimmen darin überein, daß Denken und Sein (Ausdehnung) identisch sind. Cogito, ergo sum ist lediglich eine Formulierung des Tiefenerlebnisses. Hier kommt das Ursymbol der einzelnen Kultur zur Geltung. Die vollzogene Ausdehnung ist danach im antiken Bewußtsein von sinnlicher, körperhafter Gegenwart, im abendländischen von steigender räumlicher Transzendenz, so daß nach und nach die ganz unsinnliche Polarität von Kapazität und Intensität im Unterschied von der antik-optischen: Stoff und Form herausgearbeitet wird.
Aber daraus folgt, daß innerhalb des Erkannten und Gewordenen die lebendige Zeit nicht noch einmal erscheinen kann. Das Gewordene ist ein Mechanismus, in anorganische Form verwandeltes Organische. Die physikalische, gedachte, meßbare Zeit, eine bloße Dimension, ist ein Mißgriff. Es fragt sich nur, ob er zu vermeiden ist oder nicht. Man setze in irgendeinem physikalischen Gesetz dafür das Wort Schicksal ein und man wird fühlen, daß innerhalb der reinen „Natur“ von Zeit nicht die Rede ist. Die Formenwelt der Physik reicht genau so weit wie die verwandten der Zahlen und der Begriffe, und wir hatten gesehen, daß, trotz Kant, zwischen mathematischer Zahl und Zeit nicht die geringste, wie immer geartete Beziehung besteht.
Und hier wird die Physik zum zweitenmal dogmatisch. In den Worten Zeit und Schicksal ist für den, der sie instinktiv gebraucht, das Leben selbst in seiner tiefsten Tiefe berührt, das ganze Leben, das vom Erlebten nicht zu trennen ist. Die Physik aber, der Verstand, muß sie trennen. Das Erlebte an[S. 543] sich, losgelöst vom lebendigen Akt des Betrachters, Objekt geworden, tot, anorganisch, starr — das ist jetzt die Natur als Mechanismus, das heißt als etwas mathematisch zu Erschöpfendes. In diesem Sinne ist Naturerkenntnis eine messende Tätigkeit.
Folglich kennt sie die Zeit nur als Strecke; folglich ist sie gezwungen, die Bewegung als eine mathematisch fixierbare Größe, als Benennung zu den im Experiment gewonnenen und in Formeln niedergelegten reinen Zahlen aufzufassen. „Die Physik ist die vollständige und einfache Beschreibung der Bewegungen“ (Kirchhoff). Das ist immer ihre Absicht gewesen. Aber eine Bewegung innerhalb der verstandesmäßig aufgefaßten Natur ist nichts anderes als jenes metaphysische Etwas, in dem das Erleben des Beobachters selbst, durch welches erst das Bewußtsein eines kontinuierlichen Nacheinander entsteht, zum Vorschein kommt. Der momentane Erkenntnisakt an sich bewirkt einen zeitlosen und also bewegungsfremden Zustand. Das bedeutet „Gewordensein“. Aus der organischen Reihe dieser Akte erst ergibt sich die Impression einer Bewegung. Der Gehalt dieses Wortes berührt den Physiker nicht als Intellekt, sondern als ganzen Menschen, dessen ständige vitale Funktion nicht die „Natur“, sondern die ganze Welt ist. Dies ist die ewige Verlegenheit aller Physik als des Ausdrucks einer Seele. Alle Physik ist Behandlung des Bewegungsproblems, in dem das Problem des Lebens selbst liegt, nicht als ob es eines Tages lösbar wäre, sondern obwohl es unlösbar ist.
Gesetzt, daß Naturerkenntnis eine feine Art Selbsterkenntnis ist — die Natur als Bild, als Spiegel des Geistes verstanden —, so ist der Versuch, das Bewegungsproblem zu lösen, der Versuch der Erkenntnis, ihrem eigenen Geheimnis, ihrem Werden auf die Spur zu kommen.
Das vollkommene System der mechanischen Naturanschauung ist eben nicht Physiognomik, sondern System, d. h. reine Ausgedehntheit, logisch und zahlenmäßig geordnet, nichts Lebendiges, sondern etwas Gewordenes und Totes. Dem widerspricht aber die Idee der Bewegung. Sie stammt unmittelbar aus dem[S. 544] Lebensgefühl, sie ist Zeit, Richtung, Schicksal, und so dringt sie als Fremdkörper in die Einheit eines mechanischen Systems, dessen zeitlos starre Folgerichtigkeit sie zerstört.
Die Bewegung gehört, wie das Wort sagt, in das Reich der lebendigen Phänomene, der Gestalten, der Geschichte, nicht der begriffenen anorganischen Natur. Sie ist ein Eindruck von unmittelbar innerer Gewißheit des Gefühls, kein physikalischer Begriff, der jemals erschöpfend definiert werden könnte. Anschauen kann sich die Bewegung; das war Goethes Art, die „lebendige Natur“ fühlend zu erleben; gerade sie führte zu den Phänomenen des bewegten Daseins, zur Physiognomik und blieb dem Bereich des Mathematischen vollkommen fern. Die Folge ist sein Ausspruch: „Die Natur hat kein System, sie hat, sie ist Leben und Folge aus einem unbekannten Zentrum, zu einer nicht erkennbaren Grenze.“ Für den, der Natur nicht erlebt, sondern erkennt, hat sie aber System, ist sie System und nichts weiter, und folglich Bewegung in ihr ein Widerspruch. Sie kann ihn durch eine künstliche Formulierung zudecken, aber in den Grundbegriffen lebt er fort.
Der Eindruck einer Bewegung folgt aus einem Kontinuum von Vorstellungen, aber nicht insofern sie Vorgestelltes sind, sondern indem sie eben jetzt vorgestellt werden. Eine Reihe von Erkenntnissen als Einheit erleben setzt Gedächtnis voraus, und zwar historisches Gedächtnis. Das ist kein ordnender, sondern ein lebendig schöpferischer Akt, kein mechanischer, sondern ein organischer Zusammenhang. Angenommen, wir hätten kein Gedächtnis, so daß jeder Moment für sich, ohne Verknüpfung mit dem vorhergegangenen aufgenommen würde — dann würde uns das Weltbild der Geschichte und also auch der Begriff der Bewegung fehlen. Hier liegt die schwache Stelle der exakten Wissenschaft von der Natur. Hier dringt die Historie in ihr Bild. Die Bewegung ist nicht im Betrachteten, sondern im Betrachter, nicht im Objekt der Physik, sondern im Physiker als historischer Person.
Weil es keine Physik gibt ohne eine Seele, deren historischer Ausdruck sie ist, ohne einen Menschen einer einzelnen Kultur, der sie in sich und durch sie verwirklicht, deshalb ist eine reine, der Form nach fehlerlose Physik unmöglich. Die[S. 545] Bewegung ist der unvermeidliche Faktor, der sie notwendig zerstört. Die Gewohnheiten unsres Denkens hindern uns, das einzusehen. Ich hatte gesagt, daß man für Zeit das Wort Schicksal einsetzen solle, um sich bewußt zu werden, daß die Physik mit dem wahren Gehalt des Wortes nichts zu schaffen hat. Man sage gleichfalls für Bewegung eines physikalischen Systems dessen Älterwerden — es altert wirklich, als Erlebnis eines Beobachters nämlich, in dessen Geist seine ganze Realität enthalten ist — und man wird das Verhängnisvolle des Wortes Bewegung mit seinem unzerstörbaren organischen Gehalt deutlich fühlen. Die Mechanik sollte mit Altern und folglich mit Bewegung nichts zu tun haben. Also — denn ohne das zentrale Bewegungsproblem ist überhaupt keine Naturwissenschaft denkbar — kann es gar keine lückenlos geschlossene Mechanik geben; irgendwo ist der organische Ausgangspunkt des Systems, dort wo das unvermittelte Leben hereinragt — die Nabelschnur, mit der das Geisteskind am mütterlichen Leben, das Gedachte am Denkenden hängt.
Wir lernen hier die Entstehung der faustischen und apollinischen Naturerkenntnis von einer ganz anderen Seite kennen. Es gibt keine reine Natur. Etwas vom Wesen der Historie liegt in jeder. Ist der Mensch ahistorisch wie der Grieche, dessen gesamte Welteindrücke in einer reinen, punktförmigen Gegenwart aufgesaugt werden, so wird das Naturbild statisch, in jedem einzelnen Augenblick in sich selbst abgeschlossen. In der griechischen Physik kommt die Zeit als Größe ebensowenig vor wie im Entelechiebegriff des Aristoteles. Ist der Mensch historisch fühlend, weil das Werden, das den einzelnen Augenblick in eine Richtung, in Vergangenheit und Zukunft auflöst, sich ins Licht des erkennenden Geistes drängt, so entsteht ein dynamisches Bild. Die Zahl, der Grenzwert des Gewordnen, wird im ahistorischen Falle Maß und Größe, im historischen Funktion. Man mißt nur Gegenwärtiges und man verfolgt nur etwas, das Vergangenheit und Zukunft hat, in seinem Verlauf. Dieser Unterschied ist es, der den innern Widerspruch im Bewegungsproblem in der antiken Mechanik verdeckt, in der abendländischen heraustreibt.
Die Geschichte ist ewiges Werden, ewige Zukunft und Bewegtheit also; die Natur ist geworden, also ewige Vergangenheit.[S. 546] Folglich hat hier eine seltsame Umkehrung stattgefunden; die Priorität des Werdens vor dem Gewordnen erscheint aufgehoben. Der aus seiner Sphäre, dem Gewordnen, rückschauende Geist kehrt den Aspekt des Lebens um; aus der Idee des Schicksals, die Ziel und Zukunft in sich hat, wird das mechanisch-extensive Prinzip von Ursache und Wirkung, dessen Schwerpunkt im Vergangenen liegt. Der Geist vertauscht dem Range nach das Leben (Zeit) und das Erlebte (Raum) und versetzt die Zeit als Strecke in ein räumliches Weltsystem. Er hat hier die ungeheuerste Verkehrung im wachen Bewußtsein vollzogen: während aus der Richtung die Ausdehnung, aus dem Leben das Räumliche als Erlebnis, weltbildendes Erlebnis folgt, setzt er den schematisierten „Lebensprozeß“ in seinen starren, vorgestellten Raum hinein — das ist physikalische Bewegung, leblos, teilbar, tot, den Regeln der Mathematik unterworfen. Dem Leben ist der Raum etwas, das als Funktion zum Leben gehört, dem Geiste ist Leben etwas im Raume. Goethes lebendige Anschauung erlebt die Ausdehnung, die Welt als ewig werdend, der geborne Physiker erkennt das Leben als mathematische Bewegung im Raume. Alles Mechanische, das heißt alles Gedachte ist eine prinzipielle Umkehrung von Organischem. Schicksal bedeutet ein Wohin, Kausalität bedeutet ein Woher. Künstlerische Anschauung, Intuition besitzt die Notwendigkeit eines Schicksals. Wissenschaftliches Denken ist, nicht als historisches Phänomen, sondern inhaltlich von kausaler Notwendigkeit. Wissenschaftlich begründen heißt vom Gewordnen und Verwirklichten aus nach „Gründen“ suchen, indem man den mechanisch aufgefaßten „Weg“ — das Werden als Strecke — rückwärts verfolgt. Aber es läßt sich nicht rückwärts leben, nur rückwärts denken. Nicht die Zeit, nicht das Schicksal ist umkehrbar, nur was der Physiker Zeit nennt, was er als teilbare, womöglich negative oder imaginäre „Größe“ in seine Formeln eingehen läßt. Insofern ist das Bewegungsproblem eine Umkehrung des Lebensgefühls und als solche von vornherein unlösbar, wenn man unter Lösung die restlose begrifflich-mathematische Formulierung versteht.
Die Verlegenheit ist immer wieder gefühlt, wenn auch ihrem Ursprung und ihrer Notwendigkeit nach nie begriffen worden.[S. 547] Das dunkle Bewußtsein der Naturerkenntnis, hier an einer Grenze ihrer Möglichkeit zu stehen, sie vielmehr schon überschritten zu haben, war zu allen Zeiten wach. Innerhalb der antiken Naturforschung stellten die Eleaten der Notwendigkeit, die Natur in Bewegungen zu denken, die logische Einsicht entgegen, daß Denken ein Sein, mithin Erkanntes und Ausgedehntes identisch und also Erkenntnis und Werden unvereinbar seien. Ihre Einwände sind nie widerlegt worden und unwiderlegbar, aber sie haben die Entwicklung der antiken Physik, die als Ausdruck der apollinischen Seele unentbehrlich und also über logische Widersprüche erhaben war, nicht gehindert. Innerhalb der von Galilei und Newton begründeten klassischen Mechanik des Barock ist eine einwandfreie Lösung in dynamischem Sinne immer wieder versucht worden. Die Geschichte des Kraftbegriffs, dessen immer neue Definitionen die Leidenschaft des Denkens kennzeichnen, das durch diese Schwierigkeit sich selbst in Frage gestellt sah, ist nichts als die Geschichte der Versuche, die Bewegung mathematisch und begrifflich restlos zu fixieren. Der letzte bedeutende Versuch, der wie alle früheren mit Notwendigkeit mißlang, liegt in der Mechanik von H. Hertz vor.
Hertz hat, ohne die eigentliche Quelle aller Verlegenheit zu finden — das ist noch keinem Physiker gelungen —, versucht, den Begriff der Kraft ganz auszuschalten, mit dem richtigen Gefühl, daß der Fehler aller mechanischen Systeme in einem der Grundbegriffe zu suchen sei. Er wollte das Bild der Physik allein aus den Größen der Zeit, des Raumes und der Masse aufbauen, aber er bemerkte nicht, daß eben die Zeit selbst, die als Richtungsfaktor in den Begriff der Kraft eingegangen ist, das organische Element war, ohne das eine dynamische Theorie sich nicht aussprechen läßt und mit dem eine reine Lösung nicht gelingt. Und abgesehen davon bilden die Begriffe Kraft, Masse und Bewegung eine dogmatische Einheit. Sie bedingen einander so, daß die Anwendung des einen die unvermerkte der beiden andern schon einschließt. Im πάντα ῥεῖ Heraklits ist die ganze apollinische, im Kraftbegriff die ganze abendländische Fassung des Bewegungsproblems enthalten. Der Begriff der Masse ist nur das Komplement zum Kraftbegriff. Newton — eine tief religiöse Natur — brachte lediglich das[S. 548] faustische Weltgefühl zum Ausdruck, als er, um den Sinn der Worte Kraft und Bewegung verständlich zu machen, von Massen als Angriffspunkten der Kraft und Trägern der Bewegung sprach. So hatten die Mystiker des 13. Jahrhunderts Gott und sein Verhältnis zur Welt aufgefaßt. Newton hatte mit seinem berühmten „hypotheses non fingo“ das metaphysische Element abgelehnt, aber seine Konzeption einer Mechanik ist durch und durch metaphysisch. Die Kraft ist im mechanischen Naturbilde des abendländischen Menschen, was der Wille in seinem Seelenbilde und die unendliche Gottheit in seinem Weltbilde ist. Die Grundgedanken seiner Physik standen fest, lange bevor der erste Physiker geboren wurde; sie lagen im frühesten religiösen Weltbewußtsein dieser Kultur.
Damit offenbart sich nun auch der religiöse Gehalt des physikalischen Begriffs der Notwendigkeit. Es handelt sich um die mechanische Notwendigkeit in dem, was wir als Natur geistig besitzen, und man hat nicht zu vergessen, daß dieser Notwendigkeit eine andre, organische, schicksalhafte im Leben selbst zugrunde liegt. Die letzte gestaltet, die erste schränkt ein; die eine folgt aus einer inneren Gewißheit, die andere aus Beweisen: das ist der Unterschied von tragischer und technischer, historischer und physikalischer Logik.
Innerhalb der von der Naturwissenschaft geforderten und vorausgesetzten Notwendigkeit bestehen nun weitere Unterschiede, die sich bis jetzt jeder Aufmerksamkeit entzogen haben. Es handelt sich hier um sehr schwierige Einsichten von unabsehbarer Bedeutung. Eine Naturerkenntnis ist die Funktion eines Verstandes von bestimmter Art, gleichviel wie dieser Zusammenhang von der Philosophie definiert wird. Eine Naturnotwendigkeit steht demnach in Beziehung zur Struktur des zugehörigen Geistes, in dessen Tätigkeit sie sich realisiert, und hier beginnen die historisch-morphologischen Unterschiede. Man kann eine strenge Notwendigkeit in der Natur erblicken, ohne daß sie sich in Naturgesetze formulieren ließe. Das letzte, für uns selbstverständlich, für Menschen andrer Kulturen indessen durchaus nicht, setzt eine ganz besondere und für den[S. 549] faustischen Geist bezeichnende Form des Denkens und mithin des Naturerkennens voraus. An sich liegt die Möglichkeit vor, daß die mechanische Notwendigkeit eine Gestalt annimmt, in der jeder einzelne Fall morphologisch für sich besteht, keiner sich exakt wiederholt und Erkenntnisse also nicht als ständig gültige Formeln erscheinen können. Es würde da die Natur in einem Bilde erscheinen, das sich etwa nach Analogie unendlicher, aber nicht periodischer Dezimalbrüche im Unterschiede von rein periodischen vorstellen ließe. So empfand die Antike. Das Gefühl davon liegt schon ihren physikalischen Urbegriffen zugrunde. Die Eigenbewegung der Atome bei Demokrit z. B. erscheint so, daß ein gesetzmäßiger Bewegungstypus nicht statuiert wird.
Naturgesetze sind Formen des Geistes, in welchen ein Inbegriff von Fällen sich zu einer Einheit höheren Grades zusammenschließt. Aber darin liegt Wille zur Macht; das ist faustisch: der Geist spricht in diesen Formen seine Herrschaft über die Natur aus. Die Welt ist seine Vorstellung, eine Funktion des eignen Ich. Der antike Mensch war, nach Protagoras, nur das Maß, nicht der Schöpfer der Dinge.
Hier zeigt sich, daß das Kausalitätsprinzip in der Form, wie sie für uns selbstverständlich und notwendig ist, wie sie von der Mathematik, Physik und Erkenntnistheorie übereinstimmend als Grundwahrheit behandelt wird, ein abendländisches, genauer ein Barockphänomen ist. Sie kann nicht bewiesen werden, denn jeder Beweis in einer abendländischen Sprache und jede Erfahrung eines abendländischen Menschen setzt sie schon voraus. Es ist kein Zweifel, daß im Begriff der Kraft, der Funktion, des Naturgesetzes überhaupt diese besondere Art von Notwendigkeit schon enthalten ist. Die antike Art, die Natur zu sehen — das alter ego der antiken Art zu sein —, enthält sie aber nicht, ohne daß dadurch eine logische Schwäche in den naturwissenschaftlichen Feststellungen zum Vorschein käme. Denkt man die Aussagen des Demokrit, Anaxagoras und Aristoteles, in denen die ganze Summe antiker Naturanschauungen enthalten ist, genau durch, prüft man vor allem den Gehalt von so entscheidenden Begriffen wie ἀλλοίωσις, ἀνάγκη oder ἐντελέχεια, so sieht man mit Erstaunen in ein völlig anders geartetes,[S. 550] in sich geschlossenes und also für eine bestimmte Art Mensch unbedingt wahres Weltbild, in dem von Kausalität in unserem Sinne nicht die Rede ist. Der Alchimist der arabischen Kultur, der seine magischen Operationen und Betrachtungen aus seinem Weltgefühl gleichfalls „exakt“ durchführt, setzt ebenso eine immanente Notwendigkeit seines Universums voraus, die von dynamischer Kausalität ganz und gar verschieden ist.
Es ist sehr schwierig, sich über diesen Punkt verständlich zu machen. Vielleicht führt die Idee des Tragischen in das Wesen der Unterschiede ein. Das Wort Schicksal bezeichnet ein Urgefühl von etwas Unbeschreiblichem und Unfaßlichem in der Seele ganzer Kulturen, und in jeder ein anderes. Wir sahen, wie es sich in der anekdotischen Tragödie des Sophokles und der biographischen Tragödie Shakespeares offenbart, im gesamten Stil des apollinischen und faustischen Daseins, in der politischen und wirtschaftlichen Geschichte beider Kulturen und der Art der Entwicklung, der Anlage, des Verlaufs ihrer Epochen. Die Beziehung der jeweiligen Schicksalsidee zur antiken Kalokagathia und zum nordischen Willen wurde nachgewiesen. So erscheint sie, vom Geiste mechanisch gefaßt, ins Ausgedehnte, in die sinnliche Wirklichkeit umgedeutet, als Logik des Gewordnen, als ordnendes Urprinzip im Reiche der Zahlen, Dimensionen und Begriffe. Wie der tragische Stil der attischen und nordischen Szene, wie aristotelische und kantische Logik, so unterscheiden sich die antike und abendländische Art der physikalischen Notwendigkeit. Die Kausalität, welche Kant als die vornehmste Kategorie des Verstandes anerkannte und die bei Aristoteles fehlt, gehört zur Dynamik. Eine Kausalkette ist eine Art von erstarrtem biographischem Nacheinander, etwas, das man jedenfalls als den Gegensatz zum Anekdotisch-Punktförmigen empfinden wird. Die Anschauungen der materialistischen Geschichtsauffassung lassen den Zusammenhang übersehen: nur eine historisch empfindende Art Mensch konnte die Naturnotwendigkeit in dieser Form eines Verlaufs perzipieren. In der Statik und Alchimie, beide als vollkommene Arten mechanischer Naturanschauung betrachtet, würde dies dem dogmatischen Grundgefühl widersprechen. Der Neid der Götter, der Geschlechterfluch, das blinde Fatum, das den Heros[S. 551] der attischen Tragödie vernichtet, trifft auf eine momentane Situation, nicht auf ein Ganzes von Leben und Tat. Es fehlt am „zureichenden Grunde“, und das stimmt damit überein, daß es nicht Kräfte sind, die hier an einer Aufgabe scheitern. Kausalität und ἀνάγκη, beides Prinzipien des logischen Zwanges, unterscheiden sich wie Tun und Leiden, wie die Zahl als Funktion und die Zahl als Größe, wie kontrapunktische Musik und attische Plastik.
Die Zahl als Funktion steht mit dem gedanklichen Prinzip von Ursache und Wirkung in tiefer Beziehung. Beide sind Schöpfungen desselben Geistes, Ausdrucksformen desselben Seelentums, bildende Grundlagen derselben objektgewordnen Natur. In der Tat unterscheidet sich die Physik Demokrits von der Newtons, indem die eine das optisch Gegebene, die andere die sich aus ihm entwickelnden abstrakten Beziehungen zum Ausgangspunkt wählt. Die eine ist populär im höchsten Grade; sie bleibt bei der Oberfläche, dem Augenschein stehen; die andre ist ebenso unpopulär, dem Handgreiflichen widerstrebend. Die „Tatsachen“ der apollinischen Naturerkenntnis sind Dinge, für sich bestehende und sinnlich aufzufassende Einzelheiten; die „Tatsachen“ der faustischen Naturerkenntnis sind Beziehungen, die dem Auge des Laien überhaupt nicht zugänglich sind, die geistig erst erobert sein wollen und endlich zu ihrer Mitteilung einer Geheimsprache bedürfen, die nur dem Kenner der Naturwissenschaft vollkommen verständlich ist. Die antike Notwendigkeit liegt in den wechselnden Erscheinungen der Einzeldinge unmittelbar zutage; das Kausalitätsprinzip waltet jenseits der Dinge, indem es ihre sinnlich isolierte Tatsächlichkeit abschwächt oder aufhebt. Man frage sich, welche Bedeutung sich unter Voraussetzung der gesamten heutigen Theorie mit dem Worte „ein Magnet“ verbindet.
Das Prinzip der Erhaltung der Energie, das man seit seiner Formulierung durch J. R. Mayer, Joule und Helmholtz in vollem Ernst als eine bloße Denknotwendigkeit angesehen hat, ist in der Tat eine Umschreibung des Kausalitätsprinzips — der logischen Form des faustischen Weltgefühls — mittelst des physikalischen Begriffes der Kraft. Die Berufung auf die Erfahrung und der Streit, ob eine Einsicht denknotwendig oder empirisch,[S. 552] ob sie nach Kants Bezeichnung — der sich über die verschwimmende Grenze zwischen beiden sehr täuschte — a priori oder a posteriori gewiß sei, ist für die Form des abendländischen Denkens charakteristisch. Nichts erscheint uns selbstverständlicher und eindeutiger als die Erfahrung als Quelle der exakten Wissenschaft. Das nur in Westeuropa zur vollen Meisterschaft ausgebildete Experiment ist nichts als die systematische und erschöpfende Handhabung der Erfahrung. Aber man hat nie bemerkt, daß in diesem höchst dogmatischen Begriff das Dynamische, das Kausale, also ein ganz spezieller Naturaspekt schon vorausgesetzt ist, daß Erfahrung für uns immer kausale Erfahrung, Einsicht in funktionale Zusammenhänge ist und somit in diesem Sinne und dieser Art für das antike Naturgefühl gar nicht existiert, mithin auch für das antike Denken eine unmögliche Konzeption ist. Wenn wir uns weigern, die wissenschaftlichen Resultate des Anaxagoras oder Demokrit als Resultate echter Erfahrungen anzuerkennen, so heißt das nicht, daß diese antiken Menschen sich auf die Interpretation ihrer Anschauungen nicht verstanden, daß sie bloße Phantasien entworfen hätten, sondern daß wir in ihren Verallgemeinerungen das kausale Element vermissen, das für uns den Sinn des Wortes Erfahrung erst ausmacht. Offenbar hat man nie genügend über die Exklusivität dieses rein faustischen Begriffes nachgedacht. Nicht der an der Oberfläche liegende Gegensatz zum Glauben ist für ihn bezeichnend. Die exakte sinnlich-geistige Erfahrung ist im Gegenteil ihrer Struktur nach dem vollkommen kongruent, was tief religiöse Naturen des Abendlandes, Pascal zum Beispiel, der Mathematiker und Jansenist aus der gleichen innern Notwendigkeit war, wohl als Erfahrung des Herzens, als Erleuchtung in bedeutenden Momenten ihres Daseins kennen gelernt haben. Erfahrung bezeichnet eine Aktivität des Geistes, die sich nicht auf die augenblicklichen und rein gegenwärtigen Eindrücke beschränkt, sie als solche hinnimmt, anerkennt, ordnet, sondern sie aufsucht und hervorruft, um sie in ihrer sinnlichen Individualität zu überwinden, sie in eine grenzenlose Einheit zu bringen, durch welche ihre handgreifliche Vereinzelung aufgelöst wird. Was wir Erfahrung nennen, besitzt die Tendenz vom Einzelnen zum Unendlichen. Diese Aktivität, die Willen,[S. 553] Energie, ein Ziel, einen Machtanspruch in sich schließt, widerspricht dem antiken Naturgefühl. Demokrit würde die „Anschauung“ der modernen Mechanik, wonach Bewegungen als kontinuierliche Transformationsgruppen in einer n-dimensionalen Punktmannigfaltigkeit erscheinen, nicht mehr als Interpretation irgendeiner „Natur“ anerkannt haben. Anschauung — das war dem Griechen, dem Plastiker, das unmittelbare Erlebnis des Auges. Uns ist sie etwa das, was der Kenner des Kontrapunktes vor dem innern Blick sich geisterhaft und doch nicht ganz unsinnlich entfalten sieht, wenn er eine Partitur liest. Das bedeutet uns „Erfahrung“. Deshalb besitzt der antike Mensch, für den im Augenschein das ganze Wesen der Welt liegt, eine Physik von unbestreitbarer Logik und Notwendigkeit des formalen Gehaltes, aber nach unserem Maßstabe „ohne Erfahrung“, d. h. ohne die kausale, funktionale Zersetzung der Einheit des Handgreiflichen. Unser Weg, Erfahrungen zu gewinnen, ist für ihn der Weg, sie zu verlieren. Deshalb bleibt er der gewaltsamen Methode des Experiments fern, das seinem Sinne nach dynamisch, nicht statisch ist. (Das magische Experiment der Alchimie ist ein Typus von ganz anderer Bedeutung; er setzt ein anderes Naturgefühl voraus und ruft als Resultat eine andere intuitiv-geistige Vorstellungswelt hervor.) Deshalb besaß man unter dem Namen einer Physik statt eines mächtigen Systems erarbeiteter abstrakter Gesetze und Formeln, das die sinnliche Gegebenheit vergewaltigt und unterwirft — nur dies Wissen ist Macht! —, eine Summe wohlgeordneter, durch Bilder sinnlich verstärkter, nicht etwa aufgelöster Eindrücke, welche die Natur in ihrem in sich vollendeten Dasein unberührt ließ. Unsre exakte Naturwissenschaft ist imperativisch, die antike ist θεωρία im buchstäblichen Sinne, passive Beschaulichkeit.
Es ist nun kein Zweifel mehr: die Identität der Physik mit der Mathematik, der Religion, der großen Kunst ist in den letzten Gründen der Form eine vollkommene. Ein tiefer Mathematiker — nicht ein meisterhafter Rechner, der mit dem alle Methoden beherrschenden Experimentator und dem technischen[S. 554] Virtuosen des Orchesterklangs und des Pinselstrichs auf einer Stufe steht, sondern einer, der den Geist der Zahlen in sich lebendig fühlt — begreift, daß er damit „Gott kennt“. Pythagoras und Plato haben das so gut gewußt wie Pascal und Leibniz. Terentius Varro in seinen Cäsar gewidmeten Untersuchungen über die altrömische Religion unterscheidet mit römischer Prägnanz die theologia civilis, die Summe des öffentlich anerkannten Glaubens, von der theologia mythica, der Vorstellungswelt der Dichter und Künstler, und der theologia physica, der philosophischen Spekulation. Wendet man dies auf die faustische Kultur an, so gehören zur ersten, was Thomas von Aquino und Luther, Calvin und Ignaz von Loyola lehren, zur zweiten Dante und Goethe, zur dritten aber die wissenschaftliche Physik selbst, soweit sie ihren Formeln Bilder unterlegt.
Auch der Wilde und das Kind haben ein Gefühl für das „Andre“ in ihrer Außenwelt, im höchsten Fall eine Ahnung von dem, was das Wort „Gott“ in allen frühen Sprachen bezeichnet, also ein Bewußtsein von einer Natur, ihrer Natur, in der sie leben und weben, mit der sie eins sind, die sie gleichzeitig bilden und von der sie gebildet werden. Aber mit dem Erwachen einer Kultur erwachen die großen seelischen Formen. Jetzt wächst das Gefühl von Gott zu einer großen Bestimmtheit auf, die einen übermächtigen Ausdruck in Mythen, Bauten und Ideen sucht, und das wache Bewußtsein prägt danach einen Begriff von Gott. Aus dem einen folgt das Naturgefühl, aus dem andern die Naturerkenntnis.
Seit den Tagen der Spätrenaissance wird die Vorstellung von Gott im Geist aller bedeutenden Menschen der Idee des reinen, unendlichen Raumes immer ähnlicher. Der Gott der Exercitia spiritualia des Ignaz von Loyola ist auch der des großen Lutherliedes „Ein feste Burg“, der Bachschen Kantaten, der heitren Hallenkirchen des Barock. Er ist nicht mehr der Vater des heiligen Franz von Assisi, wie die Maler der Gotik, wie Giotto und Stephan Lochner ihn empfanden, leibhaft gegenwärtig, sondern ein unpersönliches Prinzip, unvorstellbar, ungreifbar, geheimnisvoll im Unendlichen wirkend. Jeder Rest von Persönlichkeit löst sich in unanschaulicher Abstraktheit auf, eine Idee von Gott, der zuletzt nur noch die Instrumentalmusik[S. 555] großen Stils gewachsen ist, während die Malerei des 18. Jahrhunderts versagt und demnach in den Hintergrund tritt. Dies Gefühl von Gott hat das naturwissenschaftliche Weltbild des Abendlandes, unsere Natur, unsere „Erfahrung“ und mithin unsere Resultate und Hypothesen im Gegensatz zu denen des antiken Menschen gestaltet. Die Kraft, welche die Masse bewegt: das ist es, was Michelangelo an die Decke der sixtinischen Kapelle gemalt hat, was seit dem Vorbilde von Il Gesù die Domfassaden zu dem gewaltsamen Ausdruck bei Della Porta und Maderna und seit Orlando Lasso den fugierten Stil zu den kolossalen Tonmassen der Kirchenmusik des 18. Jahrhunderts gesteigert hat, was als Weltgeschehen in Shakespeares Tragödien die ins Unendliche erweiterte Szene füllt und was endlich Galilei und Newton in Formeln und Begriffe gebannt haben.
Das Wort Gott klingt anders unter den Wölbungen gotischer Dome und in den Klosterhöfen von Maulbronn und Sankt Gallen als in den Basiliken Syriens und den Tempeln des republikanischen Rom. In dem Wälderhaften der Dome, der mächtigen Erhöhung des Mittelschiffes über die Seitenschiffe gegenüber der flachgedeckten Basilika, von deren Typus der abendländische Kirchenbau ausging, in der Verwandlung der Säulen, die durch Basis und Kapitäl als abgeschlossene Einzeldinge in den Raum gestellt wurden, zu Pfeilern und Pfeilerbündeln, die aus dem Boden wachsen und deren Äste und Linien sich über dem Scheitel ins Unendliche verlieren und verschlingen, während von den Riesenfenstern, welche die Wand aufgelöst haben, ein ungewisses Licht durch den Raum fließt, liegt die architektonische Verwirklichung eines Weltgefühls, das im Hochwald der nordischen Ebenen sein ursprünglichstes Symbol gefunden hatte. Und zwar im Laubwalde mit dem geheimnisvollen Gewirr seiner Äste und dem Raunen der ewig bewegten Blättermassen über dem Haupte des Betrachters, hoch über der Erde, von der die Wipfel durch den Stamm sich zu lösen versuchen. Man denke wieder an die romanische Ornamentik und ihre tiefe Beziehung zum Sinn der Wälder. Der unendliche, einsame, dämmernde Wald ist die geheime Sehnsucht aller abendländischen Bauformen geblieben. Deshalb löst sich, sobald die Formenenergie[S. 556] des Stils ermattet, in der späten Gotik (im style flamboyant, in Troyes, im Prager Dom) ganz ebenso wie im ausgehenden Barock die beherrschte abstrakte Liniensprache wieder unmittelbar in naturalistisches Astwerk, Ranken, Zweige, Blätter auf. Die Zypresse und Pinie wirken körperhaft, euklidisch; sie hätten niemals Symbole des unendlichen Raumes werden können. Die Eiche, Buche, Linde mit den irrenden Lichtflecken in ihren schattenerfüllten Räumen wirken körperlos, grenzenlos, geistig. Der Stamm einer Zypresse findet in der klaren Säule ihrer Nadelmasse den vollkommenen Abschluß seiner senkrechten Tendenz, der einer Eiche wirkt wie ein unerfülltes rastloses Streben über den Wipfel hinaus. In der Esche scheint der Sieg der aufstrebenden Äste über den Zusammenhalt der Krone eben zu gelingen. Ihr Anblick hat etwas Aufgelöstes, den Anschein einer freien Verbreitung im Raum, und vielleicht wurde die Weltesche deshalb ein Symbol der nordischen Mythologie. Das Waldesrauschen, dessen Zauber kein antiker Dichter je empfunden hat, das jenseits der Möglichkeiten des apollinischen Naturgefühls liegt, steht mit seiner geheimen Frage nach dem Woher und Wohin, seinem Versinken des Augenblicks im Ewigen in einer tiefen Beziehung zum Schicksal, zum Gefühl für Geschichte und Dauer, zur faustischen schwermütig-sorgenvollen Richtung der Seele in eine unendliche ferne Zukunft. Deshalb wurde die Orgel, deren tiefes und helles Brausen unsere Kirchen füllt, deren Klang im Gegensatz zum klaren, pastosen Ton der antiken Lyra und Flöte etwas Grenzenloses und Ungemessenes besitzt, das Organ der abendländischen Andacht. Dom und Orgel bilden eine symbolische Einheit wie Tempel und Statue. Die Geschichte des Orgelbaus, eines der tiefsinnigsten und rührendsten Kapitel der Musikgeschichte, ist eine Geschichte der Sehnsucht nach dem Walde, nach der Sprache dieses eigentlichen Tempels der abendländischen Gottesverehrung. Von dem Versklang Wolframs von Eschenbach bis zur Musik des Tristan ist diese Sehnsucht unveränderlich fruchtbar geblieben. Das Streben des Orchesterklanges im 18. Jahrhundert ging unablässig dahin, dem Orgelklang immer verwandter zu werden. Das Wort „schwebend“, sinnlos antiken Dingen gegenüber, ist gleich wichtig in der Theorie der Musik, der Architektur, der Physik, der Dynamik[S. 557] des Barock. Wenn man in einem hohen Walde mächtiger Stämme steht und den Sturm über sich wühlen hört, begreift man plötzlich den Sinn des Gedankens von der Kraft, welche die Masse bewegt.
So entsteht aus dem Urgefühl des bewußten Daseins eine immer bestimmtere Vorstellung des göttlichen Prinzips. Erkenntnis ist ein Gewordensein. Der Erkennende selbst aber empfängt durch das Kontinuum der lebendigen Erkenntnisakte den Eindruck einer Bewegung in der äußeren Natur. Er fühlt um sich ein schwer zu beschreibendes fremdes Leben unbekannter Mächte. Er führt den Ursprung dieser Wirkungen auf numina nach römischer Bezeichnungsweise zurück, auf das „andre“, Nichteigne, insofern es ebenfalls Leben besitzt. Ein numen ist gestaltetes, durchseeltes Weltgefühl. Aus der Bewegung entspringen also Religion und Physik. Sie enthalten die Deutung der lebendigen und der toten Natur oder des Bildes der Umwelt durch die Seele und durch den Verstand. Die „himmlischen Mächte“ sind zugleich erster Gegenstand der Verehrung und der Forschung. Es gibt eine Lebens- und eine wissenschaftliche Erfahrung.
Nun beachte man wohl, auf welche Weise das Bewußtsein der einzelnen Kulturen die ursprünglichen numina geistig verdichtet. Es belegt sie mit bedeutungsvollen Worten, mit Namen, und bannt — begreift, begrenzt — sie auf diese Art. Damit unterliegen sie der geistigen Macht des Menschen, der den Namen in seiner Gewalt hat. Und es war schon gesagt worden, daß die ganze Philosophie, die ganze Naturwissenschaft, alles, was zum „Erkennen“ in irgendeiner Beziehung steht, im tiefsten Grunde nichts ist als die unendlich verfeinerte Art, den Namenzauber des primitiven Menschen auf das „Fremde“ anzuwenden. Das Aussprechen des richtigen Namens (in der Physik des richtigen Begriffes) ist eine Beschwörung. So entstehen Gottheiten und wissenschaftliche Grundbegriffe zuerst als Namen, die man anruft und an die sich eine sinnlich immer bestimmtere Vorstellung knüpft. Aus dem numen wird ein deus, aus dem Begriff eine Theorie. Was für ein befreiender Zauber liegt für die Mehrzahl der gelehrten Menschen in der bloßen Nennung der Worte „Ding an sich“, „Atom“, „Energie“, „Schwerkraft“,[S. 558] „Ursache“, „Entwicklung“! Es ist der gleiche, der den latinischen Bauern bei den Worten Ceres, Consus, Janus, Vesta ergriff.[117]
Indes, der Namenzauber tut mehr. Er hebt nicht nur heraus, grenzt aus der Fülle bewegter Eindrücke ab, er macht auch das „Fremde“ der Gestaltungskraft des eignen Ursymbols erreichbar. Aus Worten — denn in der Sprache liegt der ganze Mensch — werden Gottheiten, aber was für Unterschiede! Antike Gottheiten als wohlunterschiedene σώματα, klar umrissen, hell beleuchtet schon bei Homer. Indische Gottheiten, unzählige ineinander verschwimmende, maßlose Wesen, vag, phantastisch wie Wolken und Nebelfetzen. Abendländische Gottheiten auf dem Wege von der Gotik zum Barock zu einer unsichtbaren Macht sich einend. Man achte wohl auf die Unterschiede des apollinischen und vedischen Polytheismus. Von dort geht ein Weg zur euklidischen Körpergeometrie und den Elementen des Empedokles, von hier zur Null, zum Nirwana, zur Seelenwanderung. Aus dem Verhältnis des Olymps zur Atomistik Demokrits, der katholischen Dogmatik zu Newton ermessen wir, was eine indische Physik an Grundbegriffen hätte enthalten müssen.
Dem antiken Weltgefühl war, dem Tiefenerlebnis und dessen Symbolik gemäß, der einzelne Körper das Sein. Folgerichtig empfand man dessen äußere Gestalt als das Wesenhafte, als den eigentlichen Sinn des Wortes „Sein“. Was nicht Gestalt hat, Gestalt ist, ist überhaupt nicht. Von diesem Grundgefühl aus, das man sich nicht mächtig genug denken kann, konzipierte der antike Geist als Gegenbegriff (in der hier neu eingeführten Bedeutung) zur Gestalt das „andre“, die Ungestalt, den Stoff, die ἀρχή oder ὕλη, das, was an sich kein Sein besitzt und lediglich als Komplement zum wirklich Seienden für das Weltgefühl eine ergänzende, sekundäre Notwendigkeit. Man begreift, wie die antike Götterwelt sich bilden mußte. Sie ist neben dem Menschen eine höhere Menschlichkeit; es sind vollkommener gestaltete Körper, erhabenste Möglichkeiten leibhaft-gegenwärtiger Form — im Unwesentlichen, dem Stoffe nach,[S. 559] nicht unterschieden, mithin derselben kosmischen und tragischen Notwendigkeit unterworfen.
Das faustische Weltgefühl aber erlebte die Tiefe anders. Hier erscheint als Inbegriff des Seins der reine unendliche Raum. Er ist das Sein schlechthin. Hier wirkt der sinnliche Empfindungsinhalt, der mit einer höchst bezeichnenden Wendung, die ihm den Rang anweist, das Raumerfüllende genannt wird, als Tatsache zweiter Ordnung und im Hinblick auf den Akt der Naturerkenntnis als das Fragwürdige, als Schein und Widerstand, der überwunden werden muß, wenn man als Philosoph oder Physiker den eigentlichen Gehalt des Seins erschließen will. Die abendländische Skepsis hat sich niemals gegen den Raum, immer gegen die greifbaren Dinge gewandt. Raum ist der primäre Begriff — Kraft ist nur ein weniger abstrakter Ausdruck dafür — und erst als sein Gegenbegriff erscheint die Masse, das, was im Raume ist. Sie ist logisch wie physikalisch von ihm abhängig. Der modernen Konzeption einer elektrodynamischen Energie folgte notwendig die einer zugehörigen Masse, des Lichtäthers. Eine Definition der Masse folgt mit allen ihr zugeschriebenen Eigenschaften aus der einer Kraft, nicht umgekehrt — und zwar mit der Notwendigkeit eines Symbols. — Alle antiken Substanzbegriffe, sie mögen noch so individuell, idealistisch oder realistisch gefaßt sein, bezeichnen das zu Gestaltende, eine Negation also, die ihre näheren Bestimmungen in jedem Falle aus dem Grundbegriff der Gestalt herübernehmen muß. Alle abendländischen Substanzbegriffe bezeichnen das zu Bewegende, ohne Zweifel ebenfalls eine Negation, aber die einer andern Einheit. Gestalt und Ungestalt, Kraft und Nichtkraft — so wird die dem Welteindruck beider Kulturen zugrunde liegende und seine Formen restlos erschöpfende Polarität am deutlichsten wiederzugeben sein. Was die vergleichende Philosophie bis jetzt ungenau und verwirrend mit dem einen Worte Stoff wiedergab, bedeutet in einem Fall das Substrat der Gestalt, im andern das der Kraft. Es gibt nichts Verschiedeneres. Hier spricht das Gefühl von Gott, ein Wertgefühl. Die Gestalt, die Kraft sind die Inkarnationen des Göttlichen im Weltbilde. Die antike Gottheit ist höchste Gestalt, die faustische höchste Kraft. Das „andre“ ist[S. 560] das Ungöttliche, dem die Würde des Seins vom Geiste nicht zugesprochen werden kann. Ungöttlich ist dem apollinischen Weltgefühl die gestaltlose Leere, das „zwischen den Körpern“, dem faustischen also das passive Einzelding.
So erfolgte aus der Idee des einen unendlichen Raumes die abendländische Vorstellung des einen Gottes. Man begreift nun den Ursprung von Monotheismus und Polytheismus. Gott — das ist für unser Gefühl der Raum, Kraft, Wille, Tat. Welt, als Gegensatz zu ihm, ist also die Nichtkraft, die Masse, das Objekt. Man hat von Dante bis Goethe tausendmal die Worte gewechselt und das Weltbild religiös oder wissenschaftlich, intuitiv oder mechanistisch zu deuten versucht; das Grundgefühl ist unverändert geblieben. Es gehört zu den seelischen Bedingungen, über die niemand Gewalt hat. Es ist eine Selbsttäuschung, wenn jemand sagt, er sei Atheist geworden, oder „zu Gott zurückgekehrt“. Er verwechselt lediglich begriffliche Konventionen der Oberfläche — neue Namen — mit dem Gehalt der Welteindrücke selbst. Wer für Gott und Welt Wille und Vorstellung oder Kraft und Stoff sagt, kennzeichnet damit nur seine bewußte Individualität, seinen intellektuellen Geschmack, nicht seine Kultur. Wenn ein Darwinist oder Positivist, Nietzsche einbegriffen, eine Ansicht über den Weltverlauf ausdrücken will, so redet er davon, daß „die Natur“ dies so organisiert hat, jenes so will, irgend etwas bezweckt, zuläßt, schafft. So hätte kein Grieche gesprochen. So spricht die katholische Kirche, nur daß sie das Wort Gott für Natur gebraucht und das Kausalitätsprinzip vorsichtiger formuliert. Es ist dem heutigen Naturforscher so wenig wie dem irgendeiner andern Kultur möglich, von dieser Disposition seines produktiven Bewußtseins loszukommen. Seine Grundbegriffe, scheinbar Resultate einer strengen und voraussetzungslosen Analyse, waren schon in den Gottvorstellungen seiner Vorfahren enthalten.
Es ist ein wissenschaftliches Vorurteil, daß Mythen und Göttervorstellungen eine Schöpfung des primitiven Menschen seien und daß mit fortschreitender Kultur der Seele die mythenbildende[S. 561] Kraft verloren gehe. Das Gegenteil ist der Fall. Wäre nicht die Morphologie der Geschichte bis zum heutigen Tage ein unentdecktes Problem geblieben, so hätte man längst die vermeintlich allgemein verbreitete mythologische Produktivität auf einzelne Epochen beschränkt gefunden und endlich begriffen, daß diese Kraft einer Seele, ihre Welt mit Gestalten, Zügen und Symbolen, und zwar von einheitlichstem Charakter zu erfüllen, gerade den Frühzeiten der großen Kulturen angehört. Jeder Mythus großen Stils steht am Anfang eines erwachenden Seelentums. Er ist seine erste geistige Tat. Man findet ihn nur dort und nirgend anders, dort aber auch mit Notwendigkeit. Die bedeutendsten Motive der Edda sind genau gleichzeitig mit der romanischen Ornamentik und der gotischen Bauweise entstanden. Der olympische Götterkreis, wie wir ihn aus Homer kennen, entstand gleichzeitig mit dem frühdorischen geometrischen Stil.
Ich setze voraus, daß das, was Urvölker wie die Germanen zur Zeit Cäsars an religiösen Vorstellungen besitzen, noch kein höherer Mythus, d. h. wohl eine Summe zerstreuter personifizierender Züge, an Namen haftender Kulte, fragmentarischer Sagenbildungen, aber noch keine Götterordnung, kein mythischer Organismus, kein geschlossener Sagenkreis von einheitlicher Physiognomie ist, so wenig ich die vage Ornamentik dieser Stufe eine Kunst nenne. Übrigens sind die größten Bedenken Symbolen und Sagen gegenüber angebracht, die heute oder auch seit Jahrhunderten unter scheinbar primitiven Völkern geläufig sind, nachdem seit Jahrtausenden keine Landschaft der Erde von der Einwirkung fremder Hochkulturen ganz unberührt geblieben ist.
Es gibt deshalb so viele Formenwelten des Mythus, als es Kulturen, als es Architekturen gibt. Was ihnen zeitlich vorausliegt, das Chaos unfertiger Phantasiegebilde, in das die moderne Mythenforschung ohne ein leitendes Prinzip sich verliert, kommt unter diesen Voraussetzungen nicht in Betracht; andrerseits zählen Bildungen dazu, von denen es noch niemand vermutet hat. In der homerischen Zeit, 1100–800, und der entsprechenden ritterlich-germanischen, 900–1300 — den epischen Zeitaltern —, nicht früher, nicht später, sind die großen Sagenwelten[S. 562] entstanden. Ihnen entspricht in Indien die vedische und in Ägypten die Pyramidenzeit, man wird eines Tages entdecken, daß die ägyptische Mythologie in der Tat gerade während der dritten und vierten Dynastie zur Tiefe herangereift ist.
Nur so ist der unermeßliche Reichtum religiös-intuitiver Schöpfungen zu verstehen, der die drei Jahrhunderte der deutschen Kaiserzeit füllt. Es ist die faustische Mythologie, die hier entstand. Man war bisher blind für den Umfang und die Einheit dieser Formenwelt, weil religiöse und gelehrte Vorurteile zu einer fragmentarischen Behandlung entweder der katholischen oder der nordisch-heidnischen Bestandteile drängten. Aber es besteht hier kein Unterschied. Der tiefe Bedeutungswandel innerhalb der christlichen Vorstellungskreise ist als schöpferischer Akt identisch mit der Zusammenfassung altheidnischer Kulte zu einem Ganzen. Es gehören hierher die sämtlichen westeuropäischen Volkssagen, die damals ihre symbolische Durchbildung erhalten haben, mögen sie auch der Substanz nach viel früher entstanden und viel später noch an neue äußere Erlebnisse angeknüpft und durch bewußtere Züge bereichert worden sein. Es gehören dazu die großen in der Edda erhaltenen Göttersagen und eine Anzahl Motive aus den Evangeliendichtungen gelehrter Mönche. Dazu kommt die deutsche Heldensage des Siegfried-, Gudrun-, Dietrich-, Wielandkreises mit ihrem Gipfel im Nibelungenlied und neben ihr die ungeheuer reiche, aus altkeltischen Märchen abgeleitete und auf französischem Boden eben damals vollendete Rittersage: vom König Artus und der Tafelrunde, vom heiligen Gral, von Tristan, Parzeval und Roland. Und endlich ist außer der unvermerkten, aber um so tieferen psychologischen Umdeutung aller Züge der Passionsgeschichte der ganze Reichtum der katholischen Heiligenlegenden hinzuzurechnen, deren Blütezeit das 10. und 11. Jahrhundert füllt. Damals sind die Marienleben, die Geschichten des hl. Rochus, Sebald, Severin, Franz, Bernhard und der Odilia entstanden. Um 1250 wurde die Legenda aurea verfaßt; es war die Blütezeit der höfischen Epik und der isländischen Skaldenpoesie. Den großen Walhallgöttern im Norden entsprechen die „vierzehn Nothelfer“, die gleichzeitig im südlichen Deutschland als mythische Gruppe konzipiert[S. 563] worden sind. Auf altgermanischen Ideen, welche Dante vielleicht während eines Aufenthaltes in Oxford kennen lernte, beruhen die mächtigen Raumvisionen der Göttlichen Komödie, die Ringe des Höllentrichters. Neben der Schilderung von Ragnarök, der Götterdämmerung, in der Völuspa steht eine christliche Fassung in den süddeutschen Muspilli.
Nichts ist für den letzten Sinn dieser religiösen Schöpfungen bezeichnender als die Tatsache, daß die Götterwelt von Walhall nicht altgermanischen Ursprungs ist und den Stämmen der Völkerwanderung noch gar nicht bekannt war, sondern daß sie erst jetzt und mit einem Schlage, aus innerster Notwendigkeit im Bewußtsein der auf dem Boden des Abendlandes neu entstandenen Völker sich bildete, „gleichzeitig“ also mit der olympischen, die wir aus der homerischen Epik kennen und die ebensowenig urhellenischer Herkunft ist. Die kretisch-mykenische Menschheit, welche Namen ihre verschollenen Völker auch getragen haben mögen, kann die olympischen Motive nicht gekannt haben. Das ist psychologisch unmöglich. Und der kretisch-mykenischen Zeit entspricht der religiösen Lage nach, als Vorstufe einer noch ungebornen Kultur, die merowingisch-karolingische. Als die Araber um 730 mitten im fränkischen Reich, an der Loire standen und Musa verkündete, er wolle über die Pyrenäen und Alpen nach Rom ziehen und Mohameds Namen vor dem Vatikan ausrufen lassen, war das Christentum des Westens dem seelischen Gehalte, der Symbolik nach noch wenig vom Islam verschieden. Man prüfe den Geist der fränkisch-langobardischen Kirchenkunst. Es war noch derselbe Ausdruck des magischen Weltgefühls, wie er auf den morgenländischen Konzilien der ersten Jahrhunderte zu Worte gekommen war. So wenig damals die Welt von Walhall schon entstanden und innerlich auch nur möglich war, so wenig war von dem späteren, dem germanischen, dem faustischen Christentum schon vorhanden. Erst das große Schisma offenbart nach dieser Seite hin das Dasein einer jungen abendländischen neben einer alternden morgenländischen Seele. Als Karl der Große, der Herrscher von „Frankistan“, seine Palastkapelle zu Aachen baute, entstand aus antiken Säulen und Bauteilen, die man von Italien bezog, eine Art Moschee. Das ist ein welthistorisches Symbol.[S. 564] Das Aachener Münster wird immer das merkwürdigste Beispiel einer Architektur vor der Geburt eines Stils bleiben. Es steht außerhalb aller Stile, weil es außerhalb aller Kulturen steht. Aber dasselbe gilt von allem, was an christlichen und heidnischen Gottvorstellungen damals wirkliches geistiges Eigentum des westeuropäischen Menschen war.
Man hat die organische Einheit dieser faustischen Götter- und Sagenwelt und ihre in allen Kreisen identische Symbolik bei weitem nicht genügend beachtet. Siegfried, Baldur, Roland, der Heliand sind verschiedene Namen für ein und dieselbe Gestalt. Walhall und die Gefilde der Seligen Avalun, König Artus’ Tafelrunde und das Mahl der Einherier, Maria, Frigga und Frau Holle bedeuten dasselbe. Demgegenüber ist die äußere Abstammung der stofflichen Motive und Elemente, auf welche die Mythenforschung ein Übermaß von Eifer verwendet hat, lediglich ein Phänomen der historischen Oberfläche und ohne psychologische Bedeutung. Für den Sinn eines Mythus beweist die Herkunft nichts. Das numen selbst, die Urgestalt des Weltgefühls, ist reine wahllose und unbewußte Schöpfung und unübertragbar. Was ein Volk durch Bekehrung oder bewundernde Annahme von einem andern erhält, ist Name, Kleid und Maske für ein eignes Gefühl, niemals ein Gefühl selbst. Man hat die primitiven altkeltischen und altgermanischen Mythenmotive so gut wie den Formenschatz des antiken und des christlich-morgenländischen Glaubens als den Stoff zu betrachten, aus dem die faustische Seele in diesen Jahrhunderten eine eigne mythische Architektur erschuf. Es ist auf dieser Stufe eines eben erwachenden Seelentums ganz belanglos, ob diejenigen, durch deren Geist und Mund dieser Mythus ins Leben tritt, „einzelne“ Skalden, Missionäre, Troubadours, fahrende Sänger, Priester oder „das Volk“ sind. Es ist, wie man sieht, für die innere Selbständigkeit des Entstandenen auch belanglos, daß die christlichen Kultelemente die Formgebung entscheidend beherrscht haben.
Zu dieser Fülle von Mythen, die sämtlich das gleiche, das faustische Weltbild beseelen, dieselbe faustische Natur, die so viel später das Objekt der Dynamik und ihrer Theorien wurde und damit eine neue, geistigere, bewußtere, aber nicht weniger[S. 565] mythische Fassung erhielt, hat jede Landschaft beigesteuert, der Norden Walhall, der deutsche Süden Siegfried und Etzel, England den König Artus, Frankreich Parzeval, die Provence den Gral, Italien die Heiligenlegenden.
Bei allem Anschein eines farbig-sinnlichen Polytheismus aber, der eine Fortsetzung des antiken vortäuscht und in der Tat das Auge immer wieder verführt hat, hebt sich das Urgefühl des einen unendlichen Raumes heraus, eine mächtige Tendenz zur Ferne, eine Wendung an den innern Blick, nicht den des Leibes, was weder die Rittersage noch die Heldensage gänzlich verhehlt. Man vergesse nicht, daß das lateranische Konzil von 1215 die dogmatische Fassung des Weltgefühls festlegte, dessen mythische Gestaltung in der Gesamtheit dieser Götter- und Heldenvorstellungen vorliegt.
Wir haben, jedesmal in der Frühzeit der antiken, arabischen, abendländischen Kultur, einen Mythus statischen, magischen, dynamischen Stils vor uns. Man prüfe jede Einzelheit der Form, wie dort eine Haltung, hier eine Tat, dort die Geste, hier der Wille zugrunde liegen, wie in der Antike das leibhaft Greifbare, das sinnlich Gesättigte vorwaltet, das eben deshalb, was die Form der Verehrung anbelangt, seinen Schwerpunkt in einem sinnlich eindrucksvollen Kultus hat, während im Norden der Raum, die Kraft und mithin eine vorwiegend dogmatisch gefärbte Religiosität herrschen. Schon in diesen frühesten Ansätzen läßt sich die Verwandtschaft des homerischen Mythus zur Statue, des Eddamythus zur kontrapunktischen Musik bemerken. Man hat wohl zwischen dem seiner selbst vollkommen sicheren Gefühl, das sich in diesen mythischen Formen hervorwagt, und den oft sehr davon verschiedenen Zügen, Gebräuchen und Bildern zu unterscheiden, welche die junge Seele aus der Tradition älterer Kulturen herübernimmt, um für ihre stammelnde Sehnsucht eine Sprache zu finden. Die antiken Kulte, welche das Arabertum, und die Lehren der christlichen Kirche, welche das germanische Abendland aufnahm, waren Maske und Stoff; das junge Gefühl fügte sich in die alte Gestalt. Geradeso wurde die Basilika zum Dom umgeschaffen. So hatte der antike Mensch kretisch-ägyptische, phönikische und babylonische Motive in seine Ideen von Gott[S. 566] und seine Kulte verwebt. Die Minos-, Herakles- und Dionysossage beweisen es. So führt ein wesentlicher Teil der deutschen Volkssagen, selbst die, welche im Volksempfinden am tiefsten wurzeln, auf antike Gestalten zurück, als deren Vermittlerin vielfach die Kirche anzunehmen ist.
Es gab keinen altgermanischen Götterhimmel. Walhall ist eine unbewußte Nachbildung des Olymp, aber hier ist alles ins Ungewisse, Schwebende, ins Grenzenlose geweitet und liegt jenseits aller sinnlichen Plastik und Gegenwart. Es gab auch keine allgemein germanischen Götter. Jeder der wandernden Stämme hatte seine eignen, wenig bildhaften Vorstellungen. Erst christliche Einwirkung hat den Gestalten Odins und Baldurs, des Vaters und des Sohnes, ihre mythische Deutlichkeit und Vertiefung gegeben.
Die arabische Seele hatte in den Jahrhunderten zwischen Cäsar und Konstantin ihren Mythus ausgebildet, jene phantastische Masse von Kulten, Visionen und Legenden, die noch heute kaum übersehbar ist, Kulte wie die der Isis und des Mithras (der auf syrischem Boden völlig umgeschaffen wurde), Evangelien und Apokalypsen in erstaunlicher Zahl, die christlichen, neuplatonischen, manichäischen Legenden, die himmlischen Engel- und Geisterordnungen der Kirchenväter und Gnostiker. In der Christusgestalt der Evangelien sehen wir den Heros der früharabischen Epik neben Achilleus, Siegfried und Parzeval. Die Szenen von Gethsemane und Golgatha stehen neben den höchsten Momenten der hellenischen und germanischen Sage. Diese magischen Konzeptionen erwuchsen ohne Ausnahme unter dem Eindruck der sterbenden Antike, die ihnen der Natur der Sache nach niemals den Gehalt, um so öfter die Form lieh. Es ist kaum zu überschätzen, wieviel Apollinisches umgedeutet werden mußte, bevor der altchristliche Mythus die feste Gestalt angenommen hatte, die er zur Zeit des Augustinus besaß.
Dasselbe Schauspiel wiederholt die Gotik. Wäre in dieser Epoche das magische Christentum nicht schon als fertige Formenwelt in das Fühlen der jungen Seele gedrungen, so wäre ohne Zweifel ein völlig neuartiger Mythus von strenger Einheit entstanden. Die gotische Architektur weist auf die Möglichkeit einer faustischen Götterwelt von gigantischem Wurf hin. Indessen[S. 567] wäre es verfehlt, die Edda als Zeichen für das zu nehmen, was sich unter Umständen damals hätte bilden können. Dies Fragment einer nichtchristlichen abendländischen Religion ist dem Christentum nicht voraufgegangen. Das Christentum hat keine Götterwelt vernichtet; es hat deren Entstehung verhindert. Es war da, bevor die Geburt eines spezifisch abendländischen Mythus möglich und also notwendig geworden war. Die Gestalten der Edda sind erst in seinem Schatten gereift. Das religiöse Empfinden war keineswegs in dieser Richtung festgelegt. Tristan, Roland, Parzeval, christliche Heroen, besitzen ebensoviel Symbolik und innere Wahrheit wie Siegfried, Odin und Loki, die neben ihnen, nicht vor ihnen entstanden. Wenn die Götter- und Heldensage eher unter antik-heidnischen Eindrücken Wesen gewann, so wird die Rittersage in einem erheblich höheren Grade von magischen, christlich-neuplatonischen und sogar islamischen Einflüssen beherrscht. Es ist also keine Vermutung darüber möglich, welche Farbe und Gestalt der faustische Mythus unabhängig vom Christentum angenommen haben würde.
Der antike Polytheismus besitzt nach allem einen Charakter, der ihn von jeder andern, äußerlich verwandten Fixierung eines Weltgefühls streng abhebt. Diese Art, Götter, keine Gottheit zu besitzen, war nun einmal da, eben in der einzigen Kultur, welche die Statue des nackten Menschen als den Inbegriff aller Kunst empfand.
Die Natur, wie sie der antike Mensch um sich fühlte und erkannte, konnte in keiner andern Form beseelt, vergöttlicht werden. Der Römer fand in dem Anspruch Jehovas, allein zu existieren, etwas Atheistisches. Ein Gott war für ihn kein Gott. Von hierher schreibt sich die starke Abneigung des gesamten griechisch-römischen Volksbewußtseins gegen die Philosophen, soweit sie Pantheisten, mithin gottlos waren. Götter sind σώματα der vollkommensten Art und zum σῶμα im mathematischen wie im physikalischen, rechtlichen und dichterischen Sprachgebrauch gehört die Vielzahl. Der Begriff des ζῷον πολιτικόν gilt auch von Göttern; nichts ist ihnen so fremd wie die Einsamkeit, das Allein-[S. 568] und Fürsichsein. Man muß hier mathematisch und zwar antik-mathematisch denken, um zu begreifen. Es sei noch einmal betont: die unzähligen, leibhaften, gegenwärtigen Götter der antiken Natur — das sind die zahllosen möglichen, wohl begrenzten Körper der euklidischen Geometrie. Der eine Gott des Abendlandes, der die faustische Natur durchdringt, ist der eine grenzenlose Raum der analytischen Geometrie. Pythagoras, der in seiner religiösen Reform den uralten Demeterkult zu Kroton wieder zu Ehren brachte und in diesem Symbol die Heiligung des Leibes aussprach, begründet zugleich die Mathematik der Körper, die Idee der Zahl als Größe, als Maß. Pascal, der in den Pensées den strengsten Jansenismus, eine reine transzendente Idee von Gott und der Erbsünde aufbaute, begründet zugleich die Geometrie der reinen Beziehungen: die Projektionslehre.
Es ist von höchster Bedeutung, daß gerade in Hellas die Gestirngötter, als numina der Ferne, fehlen. Helios hatte nur auf dem orientalisierten Rhodos, Selene überhaupt nie einen Kult. Beide sind lediglich, wie schon in der höfischen Poesie Homers, künstlerische Ausdrucksmittel, nach römischer Bezeichnung Elemente des genus mythicum, nicht des genus civile. Sie besaßen weder Tempel noch Statuen und das, obgleich in Ägypten (Ra) und Babylon (Marduk), denen der Hellene so viel entlehnte, der Sonnen- und Gestirndienst den Mittelpunkt des Kultus bildete. Die altrömische Religion, in der das antike Weltgefühl in besonderer Reinheit zum Ausdruck kommt, kennt weder Sonne noch Mond, weder Sturm noch Wolken als Gottheiten. Waldesrauschen und Waldeinsamkeit, Gewitter und Meeresbrandung, die das Naturgefühl des faustischen Menschen, schon das des Kelten und Germanen, völlig beherrschen und seinen mythischen Schöpfungen den eigentümlichen Charakter geben, lassen das des antiken Menschen unberührt. Nur Konkreta, Herd und Tür, der einzelne Wald und das einzelne Feld, dieser Fluß und jener Berg, verdichten sich ihm zu Wesen. Man bemerkt, daß alles, was Ferne hat, alles, was grenzenlos und unkörperlich wirkt und deshalb den Raum als seiend, als göttlich in die gefühlte Natur ziehen würde, vom Mythus ausgeschlossen bleibt, wie auch Wolken und Horizonte, die dem Landschaftsgemälde des Barock geradezu Sinn und Seele geben, im antiken hintergrundlosen[S. 569] Fresko fehlen. Die unbegrenzte Menge antiker Götter — jeder Baum, jede Quelle, jedes Haus, jeder Teil des Hauses sogar ist Gott — bedeutet, daß jedes greifbare Ding, deren Summe eben Kosmos heißt, zugleich für sich bestehendes Wesen, keines also dem andern funktional untergeordnet ist. Die Idee der Moira bringt das selbst den höchsten Göttern gegenüber zum Ausdruck. Nicht das Schicksal ist die Gottheit, was die attische Tragödie mit unzweifelhafter Deutlichkeit erkennen läßt. Da alles Gott ist, so ist das Schicksal die Notwendigkeit, der ohne Ausnahme alle Götter unterliegen. Auch Zeus kann dem Verhängnis nicht entrinnen, heißt es bei Äschylos. Man erinnere sich der Atome Demokrits und der Ananke, die sie planlos durcheinanderwirbelt. Erst aus diesem Urgefühl ist das Bild der Olympier entstanden, indem das apollinische Bewußtsein aus der Unsumme von Göttern eine plastische Gruppe von sinnlich scharf umrissener Individualität heraushob, während das abendländische Gefühl den umgekehrten Weg ging und von der farbigen Fülle des Mythus, wie ihn die Zeit der Kreuzzüge geschaffen hatte, zu der strengen Abstraktheit der protestantischen und tridentinischen Gottesvorstellung gelangte, die reine Kraft, reiner Wille ist und sich jeder Möglichkeit malerischer Darstellung entzieht.
Dem apollinischen und dem faustischen Naturbilde liegen überall die entgegengesetzten Symbole des Dinges und des Raumes zugrunde. Olymp und Unterwelt sind von scharfer sinnlicher Bestimmtheit; die Reiche der Zwerge, Elben, Kobolde, Walhall und Niflheim — das alles ist irgendwo im Weltraum verloren. In der altrömischen Religion ist Tellus mater nicht die „Urmutter“, sondern der handgreifliche Acker selbst. Faunus ist der Wald, Volturnus der Fluß, die Saat heißt Ceres, die Ernte heißt Consus. Sub Jove frigido heißt bei Horaz echt römisch unter kaltem Himmel. Hier wird nicht einmal der Versuch einer bildlichen Wiedergabe an der Stätte der Verehrung gemacht, denn das hieße den Gott verdoppeln. Noch sehr spät lehnt sich der römische Instinkt gegen Götterbilder auf. Daß dem Griechen ein entsprechendes Gefühl nicht fremd war, beweisen der immer profaner werdenden Plastik gegenüber der Volksglaube und die Philosophie. Im Hause ist Janus die Tür als Gott, Vesta der Herd als Göttin; die beiden Funktionen des[S. 570] Hauses sind in ihrem Gegenstand Wesen, Gott geworden. Hellenische Flußgötter wie Acheloos, der als Stier erscheint, sind deutlich als der Fluß selbst, nicht etwa als im Flusse wohnend bezeichnet. Die Pane und Satyrn sind die als Wesen empfundenen einzelnen, wohlbegrenzten Felder und Triften. Dryaden und Hamadryaden sind Bäume. An vielen Stellen wurden einzelne, besonders wohlgewachsene Bäume an sich, ohne Namengebung verehrt, indem man sie mit Binden und Weihgeschenken schmückte (ein Motiv der hellenistischen Landschaftsmalerei). Dagegen besitzen die Mahre, Wichte, Zwerge, Hexen, Valkyren und die ihnen verwandten, schweifenden Heere der abgeschiedenen Seelen, die nachts „umgehen“, nichts von dieser ortsgebundenen Stofflichkeit. Najaden sind Quellen. Nixen und Alrunen aber, Holzgeister und Elben sind Seelen, die in Quellen, Bäume, Häuser nur gebannt sind und erlöst sein, wieder frei herumschweifen wollen. Das ist das vollkommene Gegenteil einer plastischen, euklidischen Naturempfindung. Die Dinge werden hier nur als Räume andrer Art erlebt. Eine Nymphe, eine Quelle also, nimmt wohl menschliche Gestalt an, wenn sie einen schönen Hirten besuchen will; eine Nixe aber ist eine verwunschene Prinzessin, mit Wasserrosen im Haar, die in Mitternächten aus dem See steigt, in dessen Tiefe sie wohnt. Kaiser Rotbart sitzt im Kyffhäuser und Frau Venus im Hörselberg. Es ist, als ob es nichts Stoffliches, Undurchdringliches im faustischen Weltall gäbe. In den Dingen ahnt man andre Welten; ihre Dichte, ihre Härte ist Schein und — ein Zug, der im antiken Mythus gar nicht vorkommen könnte, der ihn aufheben würde — bevorzugten Sterblichen wird die Gabe verliehen, durch Felsen und Berge in die Tiefe zu schauen. Aber ist das nicht auch die geheime Meinung unsrer physikalischen Theorie? Ist eine neue Hypothese nicht immer eine Art Springwurzel? Keine andre Kultur kennt so viele Sagen von Schätzen, die tief in Bergen und Seen ruhen, von geheimnisvollen unterirdischen Reichen, Palästen, Gärten, in denen andre Wesen wohnen. Die ganze Substanz der sichtbaren Welt wird vom faustischen Naturgefühl verleugnet. Es gibt nichts Erdhaftes mehr, nur der Raum ist wirklich. Das Märchen löst die Materie der Natur auf, wie der gotische Stil die steinerne Masse seiner Dome, die in einer Fülle von Formen[S. 571] und Linien geisterhaft verschwebt, denen keine Schwere mehr anhaftet, die keine Grenze mehr kennen.
All diese Geschöpfe sind durch einen Namen gebannte, abgehobene, gestaltete Mächte der Natur. Sie stellen dem Gläubigen, der sie als gegenwärtig empfindet, deren Wesen dar; sie geben die Beziehungen zwischen Natur und Mensch in ihrem freundlichen oder feindlichen Verhältnis wieder. Was der unbewußte Mensch in der Natur verehrt, zu erforschen, zu gewinnen sucht, das Fremde, erscheint in diesen Gebilden leibhaft, göttlich vor seinem Auge. Aber vergessen wir nicht, daß diese Natur selbst eine Schöpfung des höheren Menschen und die Spiegelung seines Selbst ist, daß es eine Natur als geschautes Ganzes, als Makrokosmos, als Einheit des Ausdruckes nur in bezug auf einen Kulturmenschen gibt, und daß weder der Wilde noch das Kind eine sinnvolle, wohlgeordnete Natur in sich und um sich erleben, jede Kultur aber ihre eigne.
Insofern sind diese Wesen vom Fleisch und Blut des Menschen, für den sie Wirklichkeit besitzen, reine Schöpfungen seines Herzens, nicht seines Verstandes, der erst in den Spätzeiten wie im Barock und in der Ionik das wache Bewußtsein und dessen Projektionen auf das „Fremde“ beherrscht. Der Mythus ist ein ländliches, die Physik das entsprechende städtische Phänomen. Sie verwandelt eine durchseelte Welt in ein intellektuelles System, Symbole in Begriffe, Gottheiten in Theorien, Ahnungen in Hypothesen.
Der mit steigendem Nachdruck auf somatische Vereinzelung gerichtete antike Polytheismus verdeutlicht sich besonders in der Haltung „fremden Göttern“ gegenüber. Für den antiken Menschen waren die Götter der Ägypter, Phöniker, Germanen, soweit sich mit ihnen eine bildhafte Vorstellung verbinden ließ, ebenfalls wirkliche Götter. Die Rede, daß sie „nicht existierten“, hat innerhalb dieses Weltgefühls keinen logischen Sinn. Der Grieche verehrt sie, wenn er mit ihrem Lande in Berührung kommt. Die Götter sind wie eine Statue, eine Polis, ein euklidischer Körper an den Ort gebunden. Sie sind Wesen der Nähe, nicht des allgemeinen Raumes. So gut Zeus und Apollo zurücktreten, wenn man sich etwa in Babylon aufhält, so gut hat man die dort heimischen Götter nun besonders zu achten. Diese[S. 572] Bedeutung haben die Altäre mit der Aufschrift „Den unbekannten Göttern“ — der Paulus in der Apostelgeschichte eine so bezeichnend mißverständliche, magisch-monotheistische Deutung gibt. Es sind die Götter, welche der Grieche dem Namen nach nicht kennt, die aber von den Fremden in den großen Häfen, im Piräus oder in Korinth etwa, verehrt werden und denen er deshalb Achtung zollt. Mit klassischer Deutlichkeit offenbart dies das römische Sakralrecht und die streng bewahrten Anrufungsformeln z. B. der generalis invocatio. Da das Universum die Summe der Dinge ist und Dinge Götter sind, so werden auch alle Götter als solche anerkannt, mit denen der Römer praktisch-historisch noch nicht in Beziehungen getreten ist. Er kennt sie nicht oder sie sind die Götter seiner Feinde, aber sie sind Götter, weil das Gegenteil nicht vorstellbar ist. Das ist der Sinn jener sakralen Wendung bei Livius (VIII, 9, 6): di quibus est potestas nostrorum hostiumque. Das römische Volk gesteht, daß der Kreis seiner Götter nur augenblicklich begrenzt ist und will durch diese Formeln am Ende des Gebets, nachdem die eigenen Götter mit Namen aufgezählt sind, den Rechten der andern nicht zu nahe treten. Nach dem Sakralrecht geht mit der Besitzergreifung fremden Landes die ganze Summe religiöser Verpflichtungen, die an diesem Gebiete und dessen Gottheiten haftet, auf die Stadt Rom über — das ist die logische Konsequenz des additiven antiken Gottgefühls. Daß mit der Anerkennung der Gottheit die der Formen ihres Kultus durchaus nicht gleichbedeutend war, beweist der Fall der Magna Mater von Pessinus, die im zweiten punischen Kriege auf Grund einer sibyllinischen Weissagung in Rom rezipiert wurde, während ihr höchst unantik gefärbter Kultus — der von miteingewanderten Priestern aus ihrer Heimat ausgeübt wurde — unter strenger polizeilicher Aufsicht stand, und nicht nur römischen Bürgern, sondern selbst deren Sklaven der Eintritt in die Priesterschaft bei Strafe untersagt war. Mit der Aufnahme der Göttin war dem antiken Weltgefühl Genüge getan, mit der persönlichen Ausübung ihres dem Römer verächtlichen Kultus wäre es aber verletzt worden. Das Verhalten des Senats ist in solchen Fällen entscheidend, während das Volk bei der zunehmenden Vermischung mit östlichen, namentlich semitischen Völkerschaften an diesen[S. 573] Kulten Geschmack fand und die römischen Heere der Kaiserzeit infolge ihrer Zusammensetzung sogar einer der wichtigsten Träger des magischen Weltgefühls geworden sind.
Von hier aus wird der Kult vergötterter Menschen als ein notwendiges Element innerhalb dieser religiösen Formenwelt verständlich. Aber man hat scharf zwischen antiken und den oberflächlich ähnlichen orientalischen Erscheinungen zu unterscheiden. Der römische Kaiserkult, d. h. die Verehrung des Genius des lebenden Prinzips und die der verstorbenen Vorgänger als Divi, ist bisher mit der zeremoniellen Verehrung des Herrschers in vorderasiatischen Reichen, vor allem in Persien,[118] und noch mehr mit der späteren ganz anders gemeinten Vergötterung der Khalifen, die schon bei Diokletian und Konstantin in voller Ausbildung erscheint, vermengt worden. In der Tat handelt es sich hier um sehr verschiedene Dinge. Mag im Osten die Verschmelzung dieser symbolischen Formen dreier Kulturen einen hohen Grad erreicht haben, in Rom ist der antike Typus unzweideutig und rein verwirklicht worden. Schon einige Griechen wie Sophokles und Lysander, vor allem Alexander, wurden nicht nur von Schmeichlern als Götter ausgerufen, sondern vom Volkstum in einem ganz bestimmten Sinne als solche empfunden. Von der Göttlichkeit eines Dinges, eines Hains, einer Quelle, endlich einer Statue, die den Gott repräsentiert — man denke an die tiefe Wirkung des Hermokopidenfrevels auf das athenische Volk und auf den Ausgang des Peloponnesischen Krieges — bis zu der eines hervorragenden Menschen, der erst Heros und dann Gott wird, ist nur ein Schritt. Man verehrte im einen wie im andern die vollkommene Gestalt, in der die Weltsubstanz, das an sich Nichtgöttliche, sich verwirklicht hatte. Hier ist an den attischen Begriff der Kalokagathia zu denken. Die schöne, sichtbar vollendete Gestalt war das Göttliche, also war es in der machtvollen Erscheinung des Cäsar für das Auge des Römers im höchsten Maße unmittelbar gegenwärtig. Bestand in jedem Hause ein Kult des genius, der Zeugungskraft des Hausherrn, so verehrte man hier, im genius principis, die Lebenskraft der Stadt als eines Gesamtkörpers. Eine Vorstufe war der Konsul am Tage[S. 574] seines Triumphes. Er trug hier die Rüstung des kapitolinischen Juppiter, und in der älteren Zeit waren Gesicht und Arme mit roter Farbe bestrichen, um die Ähnlichkeit mit der Terrakottastatue des Gottes, dessen numen sich in diesem Augenblick in ihm verkörperte, zu erhöhen.
Äußerst charakteristisch ist für das hier waltende Urgefühl der bizarre Gegensatz zur Vergöttlichung des Cäsars (die im Grunde eine Einbeziehung der Götter als Personen in die römische Menschheit bedeutet); die im römischen Recht stets aufrecht erhaltene Strafbarkeit der Tiere (nicht ihrer Besitzer) für Vergehen, welche bei Menschen strafbar sind. Als Körper, σώματα, gehören die Tiere also ebenso wie die Götter der Gemeinschaft lebender Körper, dargestellt im Staate, an. Man kann sagen, daß in dieser Skala der Heros, der Cäsar als Übergang nach oben, der Sklave als der nach unten empfunden wurde. Zwischen ihnen liegt der Bereich des ζῷον πολιτιχόν, des eigentlichen antiken Menschen, der Rechte und Pflichten hat. Der Sklave hat keine Rechte mehr. Er ist, griechisch gesprochen, ἀπρόσωπος, keine Person, obwohl nicht ἀσώματος. Er besitzt einen Leib, aber keine Bedeutung. Er ist nicht Bürger. Der Heros ist es auch nicht mehr, aber insofern er über Pflichten erhaben ist. Hier liegen die Grenzen der Polis hinsichtlich der ihr aktiv zugehörenden Körper (σώματα πόλεως). Erst so begreift man, was der antike Mensch Staat nennt. Folgerichtig ist — was für die Haltung der Christen wesentlich wurde — das Majestätsverbrechen eine Art Gottfrevel, das Verbrechen gegen den Sklaven eines andern eine Art Sachbeschädigung.
Der Kaiserkult ist die letzte religiöse Schöpfung des antiken Volkstums, soweit es nicht durch östliche Elemente in seinen Instinkten gebrochen war. Man hat die Echtheit dieses Gottgefühls sehr ernst zu nehmen. Daß die römischen Massen die Abstammung Julius Cäsars, eines tiefen Skeptikers, von der Venus als etwas Wesentliches empfanden, hat auf die Throngeschichte des julisch-claudischen Hauses entscheidend eingewirkt. Der Kult des Genius Augusti mit einem streng geregelten Opferdienst, während gleichzeitig der Princeps selbst innerhalb der Mauern Roms beinahe das Dasein einer distinguierten Privatperson führte, ist nur aus dem Weltgefühl der[S. 575] apollinischen Seele zu begreifen. Sein intellektueller Gegensatz ist der gelehrte, dem Gehalt nach durchaus irreligiöse Stoizismus als die Weltanschauung der patrizischen Elemente, wie etwa jenes Scaevola, der als höchster Priester Roms die Götterverehrung nur aus Gründen der Staatsraison brauchbar befand. Hier steht Instinkt gegen Intellekt, Glaube gegen Wissen, und zwar in politischer Verkleidung als Demokratie und Aristokratie. Die beiden ewigen Inkarnationen des antiken Seins, Athen und Sparta, Tyrannis und Oligarchie, Plebs und Senat, Cäsar und Pompeius, Prinzipat und Republik, stehen hier zum letzten Male einander gegenüber im Kult des Divus Julius und dem aus Opposition dagegen gepflegten, von Lucanus in seiner Pharsalia angedeuteten Kult Catos, des vornehmen Republikaners. Die gesamte blutige Geschichte der frühen Kaiserzeit findet hier ihre Deutung. Man hat den Kult Cäsars von der geflissentlichen Verehrung seines Mörders, des Patriziers Brutus oder der Catos wohl zu unterscheiden. Jener ist eine Religion, die letzte der antiken Kultur, die damals starb; diese ist eine theoretische, tendenziöse, nichts weniger als religiöse Schwärmerei der gebildeten Kreise. Tacitus hat als ihr Mitglied, als verkappter Stoiker, den Prinzipat der Cäsaren beurteilt. Je schärfer er richtet, desto populärer war der Verurteilte. Nero ist der Abgott des Volkes auf Generationen hinaus gewesen. Jeder Angriff auf den Princeps und seinen Kult traf den religiösen Instinkt der Massen.
An früherer Stelle war das paulinische Christentum als die Herübernahme einer früharabischen Religion in die antike Form der stoischen Diatribe bezeichnet worden. Daraus erklärt sich das Phänomen der — auf die Stadt Rom beschränkten — Christenverfolgungen durch Nero und Domitian. Sie richten sich in Wahrheit gegen die Stoa als den intellektuellen Ausgangspunkt aller Verschwörungen zum Sturz des Prinzipates. Weil Paulus das Christentum in den weltstädtischen Stoizismus hineingeleitet hatte, der, allerdings in einer exklusiven, katonischen Gestalt, die Weltanschauung des Patriziats geworden war, weil seine Ablehnung des Divuskultes mit der aus ganz anderen Gründen erfolgten der Senatspartei zusammenfiel, war das antike Empfinden des Demos in der einzigen Form der Götterverehrung[S. 576] verletzt, die in ihm noch lebendig war. Mochte Tacitus als Philosoph das Christentum mit den übrigen orientalischen Kulten als foeda superstitio verachten, so sind doch die Philosophen Helvidius Priscus und Thrasea von Nero aus dem gleichen Motiv wie die Christen hingerichtet worden.
In dem welthistorischen Worte: Gebt dem Cäsar, was des Cäsars ist und Gott, was Gottes ist, das dem Christus der Evangelien in den Mund gelegt ist, treten antikes und arabisches Gottbewußtsein in vollster Schärfe und mit der Notwendigkeit gegenseitigen Mißverstehens einander gegenüber. Ein Ausgleich zwischen dem streng euklidischen, beinahe posthumen Divuskult und dem ganz jungen, magisch-monotheistischen Christentum war aber schon durch die Kulturstufe, die beide voraussetzen, dort ein Ende, hier ein Anfang, unmöglich.
In den ersten Generationen der Kaiserzeit löst sich der antike Polytheismus, ohne daß in vielen Fällen an der äußeren, kultischen oder sakralrechtlichen Form etwas geändert worden wäre, in den magischen Monotheismus auf. Eine neue Seele war erschienen und sie erlebte die verjährten Formen anders. Die Namen bestanden fort, aber sie deckten andre numina. Alle sogenannten spätantiken Kulte der Isis und Kybele, des Mithras, Sol, Serapis, Hermes sind nicht mehr die Verehrungen ortsgebundener, plastisch greifbarer Wesen. Der attische Hermes war der Gott einer Stadt gewesen, in der seine Statue als Zeichen seines Wohnsitzes stand; der Hermes des alexandrinischen Kultes ist ein geistiges Prinzip, das vom Euphrat bis zum Rhein überall angerufen werden konnte. Der Zeus der Perikleszeit war in jeder Stadt, wo er einen Tempel besaß, ein andrer. Der Zeus von Dodona war mit dem Zeus von Olympia nicht identisch. So wenig sich diese Auffassung logisch exakt darstellen läßt, so logisch wirkte sie dennoch auf den religiösen Instinkt. Man war in Rom weit entfernt, den Juppiter Omnium Maximus mit einem der andern, etwa dem Juppiter Victor oder Feretrius zu vermengen, aber die vielen sehr verschiedenartigen Gottheiten der frühchristlichen Zeit wurden als ein und dasselbe[S. 577] Wesen empfunden, nur daß jeder Anhänger eines einzelnen Kultes überzeugt war, es in seiner wahren Gestalt zu kennen. In diesem Sinne sprach man von der „millionennamigen Isis“. Bis dahin waren die Namen Bezeichnungen ebensovieler körperhafter Götter gewesen, jetzt sind sie Titel des einen, den jeder meint.
Der magische Monotheismus offenbart sich in allen religiösen Schöpfungen, die vom Osten aus das Imperium erfüllen, in den Kulten der alexandrinischen Isis, des von Aurelian bevorzugten Sonnengottes (des Baal von Palmyra), des von Diokletian beschützten Mithras, dessen persische Gestalt in Syrien völlig umgeprägt worden war, der von Septimius Severus verehrten Baalath von Karthago (Tanith, Dea caelestis), die sämtlich nicht mehr in antiker Weise die Zahl der konkreten Götter additiv vermehren, sondern sie im Gegenteil in einer der bildhaften Darstellung sich mehr und mehr entziehenden Weise in sich aufnehmen. Das ist Alchymie an Stelle der Statik. Dem entspricht es, daß an Stelle des Bildes gewisse Symbole, der Stier, das Lamm, der Fisch, das Dreieck, das Kreuz in den Vordergrund treten. „In hoc signo vinces“ — das klingt nicht mehr antik. Hier bereitet sich die Abkehr von der menschendarstellenden Kunst vor, die später im Islam und in Byzanz zum Bilderverbot führte. Die namentlich in der bildenden Kunst und der höheren Poesie Roms beliebte, niemals ins Volksbewußtsein gedrungene Angleichung antiker Gottheiten wie die von Aphrodite und Venus, von Neptunus und Poseidon, die naive Art, fremde Götter durch Gleichsetzung mit heimischen sich verständlich zu machen (so den germanischen Donar mit Herkules), hat mit dieser spirituellen Verschmelzung von Gottheiten nichts zu tun. Was die Religionsforschung heute als Synkretismus bezeichnet, ein Phänomen, das sich deutlich als Auflösung des statisch-plastischen Gottgefühls, also negativ abhebt, ist positiv gefaßt nichts als die Heraufkunft des magischen Gefühls. Es ist das einem anderen Naturbilde zugrunde liegende Prinzip, das auch die Mächte dieser Natur anders faßt. Der arabische Mensch erlebt die eigene und einzige, das All erschöpfende Gottheit als die primäre Substanz; alle andern besitzen nur als ihre Namen oder Erscheinungsformen Geltung.
[S. 578]
Bis auf Trajan herab, als auf griechischem Boden längst der letzte Hauch apollinischen Weltgefühls verschwunden war, besaß der römische Staatskult die Kraft, die additive Tendenz während der fortgesetzten Vermehrung der Götterwelt zu wahren. Die Gottheiten der unterworfenen Länder und Völker erhalten in Rom eine anerkannte Kultstätte, Priesterschaft und Ritual, während sie selbst als genau abgegrenzte Individuen neben die Götter der Vergangenheit treten. Von da an siegt auch an dieser Stelle, trotz eines ehrwürdigen Widerstandes, der seinen Sitz in der kleinen Zahl uralter Patrizierfamilien hat, der magische Geist; die Göttergestalten schwinden als solche, als Körper, aus dem Bewußtsein, um einem transzendenten Gottgefühl Platz zu machen, das nicht mehr auf dem unmittelbaren Zeugnis der Sinne beruht, und die Bräuche, Feste und Legenden verfließen ineinander. Als Caracalla 217 den sakralrechtlichen Unterschied zwischen römischen und fremden Gottheiten aufhob (wie er auch durch Erteilung des Bürgerrechtes an alle Reichsbewohner die antike Idee der Polis endgültig beseitigte), womit tatsächlich Isis die erste, alle älteren numina umfassende Gottheit Roms und damit die gefährlichste Feindin des Christentums wurde, die sich den Todhaß der Kirchenväter zuzog, war Rom ein Stück Orient, eine religiöse Dependenz Syriens geworden. Damals beginnen die Baale von Doliche, Petra, Palmyra, Emesa zum Monotheismus des Sol zu verschmelzen, der später als Gott des Reiches in seinem Vertreter Licinius von Konstantin besiegt wurde. Es handelt sich damals nicht mehr um antik oder magisch — das Christentum konnte den hellenischen Göttern sogar eine Art ungefährlicher Sympathie entgegenbringen —, sondern darum, welche der magischen Religionen der damaligen Welt die geistige Form geben sollte. Man findet diesen Prozeß der Abnahme des plastischen Empfindens sehr deutlich in den Entwicklungsstufen des Kaiserkultes, wo zuerst der verstorbene Kaiser als Divus durch Senatsbeschluß in den Kreis der Staatsgötter aufgenommen wird — als erster der Divus Julius 42 v. Chr. — und eine eigne Priesterschaft erhält, so daß von nun an sein Bild bei Familienfesten nicht mehr unter den Ahnenbildern vorangetragen wird; wo dann von Mark Aurel an keine neue Priesterschaft mehr für den Dienst konsekrierter Kaiser[S. 579] entsteht, bald darauf auch kein neuer Tempel mehr geweiht wird, weil ein allgemeines templum divorum dem religiösen Gefühl hinreichend erscheint und die Bezeichnung Divus endlich sich in einen Titel der Mitglieder des Kaiserhauses verwandelt. Dieser Ausgang bezeichnet den Sieg des magischen Gefühls. Man wird finden, daß die Häufung von Namen in Weihinschriften, etwa Isis-Magna Mater-Juno-Astarte-Bellona oder Mithras-Sol invictus-Helios schon längst den Charakter des Titels einer alleinexistierenden durchgeistigten Gottheit angenommen hat.[119]
Das Problem des Atheismus ist für den Psychologen einstweilen noch terra incognita. Soviel über den Atheismus schlechtweg, d. h. ein in seinen letzten Gründen und seelisch-historischen Bedingungen gar nicht verstandenes Phänomen geschrieben und räsoniert worden ist, gleichviel ob im Stile des „vorgeschrittenen“ Menschen, im idealen Falle des freigeistigen Märtyrers, oder im Stile des Kulturmenschen, im äußersten Falle des gläubigen Zeloten: von Nuancen des Atheismus, von der Analyse einer einzelnen, bestimmten Erscheinungsform des Atheismus in ihrer Fülle und Notwendigkeit, ihrer starken Symbolik, ihrer zeitlichen Beschränktheit hat man nie gehört.
Der Atheismus — ist er eine apriorische Struktur des Weltbewußtseins oder eine wahlfreie Vorstellung? Und zieht das Gefühl von einem entgötterten Kosmos auch das Wissen davon,[S. 580] daß „der große Pan tot ist“, nach sich? Gibt es einen unbewußten Atheismus? Gibt es frühe Atheisten, etwa in der dorischen oder gotischen Zeit? Gibt es jemand, der sich mit Leidenschaft, aber mit Unrecht als Atheisten bezeichnet? Und kann es zivilisierte Menschen geben, die es nicht sind, nicht ganz wenigstens?
Daß zum Wesen des Atheismus, wie schon die Wortbildung in sämtlichen Sprachen verrät, der Charakter der Negation gehört, daß er den Verzicht auf eine seelische Bildung, die ihm also voraufgeht, bedeutet und nicht etwa den positiven Akt einer ungebrochenen Gestaltungskraft, steht fest. Aber was wird da verneint? In welcher Weise? Und von wem?
Ohne Zweifel ist der Atheismus, richtig verstanden, der notwendige Ausdruck eines in sich vollendeten, in seinen religiösen Möglichkeiten erschöpften, dem Anorganischen verfallenden Seelentums. Er verträgt sich sehr wohl mit dem lebhaften und sehnsüchtigen Bedürfnis nach echter Religiosität[120] — darin aller Romantik verwandt, die ebenfalls etwas unwiderruflich Verlornes, die Kultur nämlich, wieder heranziehen möchte — und er kann seinem Träger sehr wohl unbewußt sein, eine Gestalt seines Fühlens, die nie in die Konventionen seines Denkens eingreift, die seiner Überzeugung sogar widerspricht. Man begreift das, wenn man einsieht, weshalb der fromme Haydn Beethoven einen Atheisten nannte, nachdem er Musik von ihm gehört hatte. Die Notwendigkeit für Beethoven, die große musikalische Form des Barock zu verletzen, um innerlich wahr zu sein, der tiefe Widerspruch zwischen seinem persönlichen Wollen und dem der bereits hinter ihm liegenden Kultur besagt dasselbe. Beethoven war Romantiker und romantische Religiosität ist, in Alexandria wie im Kreise der Schlegel und Tieck, die feinste Form eines heimlichen Atheismus. Man darf sagen, daß ein faustischer Mathematiker, der nicht „fromm“ ist, wie Pascal, Leibniz, Newton, Gauß waren, ein ausgezeichneter Organisator der Materie seiner Wissenschaft und Entdecker wichtigster Sätze sein kann, daß[S. 581] er aber zur Vertiefung der Idee der analytischen Zahl nichts beitragen wird, weil er sie nicht in sich fühlt, sondern nur außer sich erkennt, sie nur als Element einer Ordnung, nicht einer Schöpfung besitzt. Der Atheismus gehört zum zivilisierten Menschen, insofern eine Zivilisation der „Erdenrest“ einer erloschenen Kultur ist. Wir werden das noch kennen lernen. Er gehört zur großen Stadt; er gehört zum „Gebildeten“ der großen Städte, der sich mechanisch aneignet, was seine Vorfahren, die Schöpfer seiner Kultur, organisch erlebt haben. Aristoteles ist, vom antiken Gottgefühl aus, Atheist, ohne es zu wissen. Der hellenistisch-römische Stoizismus ist es so gut wie der Sozialismus und Buddhismus der westeuropäischen und indischen Modernität. Ein typisch atheistischer Zustand ist es, aus dem heute die „freireligiösen“ humanen Bewegungen hervorgehen, die einen großen Teil des städtischen Protestantismus umfassen — beim ehrlichsten Gebrauch des Wortes „Gott“.
Bedeutet dies späte und abschließende Phänomen aber die Verneinung des religiösen Moments in uns, so ist es in jeder Zivilisation von andrer Struktur. Es gibt keine Religiosität ohne eine ihr allein zugehörige, gegen sie allein gerichtete atheistische Auflehnung. Es gibt einen antiken, arabischen, abendländischen Atheismus, die untereinander nach Sinn und Gehalt völlig verschieden sind. Nietzsche hat den einen, den dynamischen — etwas post festum —, dahin formuliert, daß „Gott tot ist“. Ein antiker Philosoph hätte den andern, statisch-euklidischen, damit bezeichnet, daß „die Götter tot sind“. Das eine bedeutet die Entgötterung des unendlichen Raumes, das andre die der unzähligen Dinge. Sie waren bis dahin — man denke an das Tiefenerlebnis und seine Bedeutung für das Erwachen des Innenlebens — Symbole gewesen, letzte Formelemente einer lebendigen Natur; sie sind jetzt bloße Tatsachen der mechanischen Ausgedehntheit. Der tote Raum und die toten Dinge sind die Objekte der verstandesmäßigen Physik. Mit einem richtigen Gefühl pflegt der Sprachgebrauch Weisheit und Intelligenz zu unterscheiden, als einen frühen und späten, bäuerlichen und großstädtischen Zustand des Geistes. Intelligenz ist das Komplement zu einer mechanischen Weltanschauung. Niemand würde Heraklit oder Meister Eckart eine Intelligenz nennen, aber Sokrates und[S. 582] Rousseau sind intelligent, nicht „weise“. In diesem Worte liegt etwas Anorganisches; es verrät den Beigeschmack von Atheismus. Nur vom Standpunkte des Stoikers und Sozialisten, des typisch irreligiösen Menschen, ist der Mangel an Intelligenz etwas Verächtliches.
Der apollinische Mensch kann die Götter leugnen, der faustische und der magische Mensch leugnet Gott. Aber dieser Akt vollzieht sich in sehr verschiedenen Formen. Er kann in bewußtem und unbewußtem Verhalten, im Zweifel und in der Verzweiflung, im theoretischen Angriff und praktischem Aus-dem-Wege-gehen liegen. Das sinnlich-euklidische Göttertum, durch das die einzelnen Dinge geheiligt sind, verleugnet man schon durch die Neigung zum monotheistischen Isis- oder Mithraskult. Noch einmal: Ein Gott ist für das antike Empfinden kein Gott. Dem Römer galten alle südarabischen Religionen samt dem Christentum — mit ihrer gemeinsamen, wenn auch kultisch noch so verhüllten Formel „Allah il Allah“ — als atheistisch dem antiken Gottgefühl gegenüber und er hat sie verfolgt. Hier ist das Wesen der Toleranz verständlich zu machen.
Solange man diese Erscheinung vom Standpunkte des Für und Wider betrachtet, wird man für das Wesentliche blind sein. Einfältige Leute lieben es, die antike Toleranz gegen die christliche Toleranz auszuspielen. Aber das Wort Toleranz besagt an sich gar nichts. Erst das Warum, Wogegen und Wofür entscheidet alles. Wer z. B. die hinter dem Worte Liberalismus schlecht verhehlte Gleichgültigkeit gegen religiöse Dinge, die dem einen nichts mehr bedeuten und die deshalb auch dem andern nichts bedeuten sollten, für Toleranz nimmt und mit jenem tiefsymbolischen Akte der Aufnahme der di peregrini in den römischen Staatskult gleichsetzt, verdient als gelehrter Flachkopf keine Widerlegung. Im wesentlichen ist niemand tolerant, sofern man darunter einen wirklichen Verzicht, nicht eine positive Äußerung religiöser Gestaltungskraft versteht. Eben darauf beruht das Symbolische jeder Toleranz, die allein von gläubigen Menschen, nie von der „Intelligenz“, von einer Kultur, nicht von einer Zivilisation ausgeht.
Der antike Kosmos als Summe leibhafter, gleichmäßig göttlicher Dinge forderte nicht nur die Duldung, sondern die tätige[S. 583] Anerkennung sämtlicher fremden Götter, soweit sie überhaupt als Dinge in höherem Sinne gelten konnten. Solange man Jehova, Christus und Mithras als Tagesgestalten von der Substanz eines Apollo oder Mars nahm, glaubte man an sie. Alexander Severus hatte die Bilder von Osiris, Christus, Abraham, Alexander dem Großen und Orpheus in seiner Privatkapelle aufgestellt. Als abstrakte Geister mit dem Anspruch auf Alleingültigkeit reizten sie zu Verachtung und Zorn. Und hier hatte die antike Duldung ein Ende. Hier stand das eigene Gottgefühl in Frage.
Der Logos der stoischen Lehre, so gewiß er im Verlaufe der vorsokratischen Philosophie sich aus der Tiefe des apollinischen Götterbewußtseins herausgebildet hatte, war unter den Händen der sophistischen Intelligenz zuletzt die Inkarnation des antiken Atheismus, der formgewordne Widerspruch gegen die plastische Götterwelt geworden. Es entstand wie in jeder andern Kultur eine Todfeindschaft zwischen der Religion der Väter und der kühlen, weltbürgerlichen, das All entseelenden Philosophie der Modernität. Es ist kein Zufall, daß an diese Idee vom einen Logos alle früharabischen Spekulationen, allen voran die des Johannesevangeliums und die Plotins, angeknüpft haben. Was dem antiken Menschen der Inbegriff des Atheismus war, das bezeichnete gerade den Geltungsbereich des Göttlichen im magischen Weltbewußtsein.
Aber ebenso besteht zwischen dem Deismus des 18. Jahrhunderts, dem Voltaires, Goethes, Kants, und dem Atheismus des 19. kein Gegensatz und nicht einmal eine wesentliche Distanz. Der faustische Gott gleicht dem Symbol des einen absoluten Raumes. Die Intelligenz der Zeit Rousseaus schloß folgerichtig, nicht daß die Götter der andern Völker ebenfalls von unanfechtbarer Existenz seien, sondern daß jedermann, unter welcher Form auch immer, sei es auch unter einer polytheistischen, ja nur den einen, abstrakten, faustischen Gott meinen und verehren könne. Das ist der Gegensatz von kultischer und dogmatischer Religiosität. Der antike, ahistorische Mensch übt die Kulte der fremden Götter aus, der abendländische, der geborne Historiker, ist Psycholog: er „versteht“ die Überzeugung des andern. Hier ist die Quelle einer ganz anders gearteten Toleranz, die ihren höchsten[S. 584] Ausdruck in Lessings Nathan gefunden hat, tief und vornehm, solange sie wie bei Goethe noch aus einem lebendigen Gottgefühl hervorging, eine Farce, wenn sie nichts als die moderne Irreligion decken sollte. Aber je bewußter diese Idee von Gott gefaßt wurde, desto ähnlicher mußte sie dem zugehörigen Atheismus werden. Die Sublimierung der Idee in den großen romantischen Systemen ist in der Tat, ohne daß es Hegel, Fichte und den andern je zum Bewußtsein gekommen wäre, das Verschwinden des letzten Unterschiedes zwischen Gott und Raum, das völlige Verschwinden des lebendigen Gehaltes aus der abstrakten Idee. Pantheismus und Atheismus sind zuletzt nur noch Wortdifferenzen. Schopenhauer war bewußter Atheist, aber Oken hat mit der ganzen Bizarrerie eines Romantikers (man denke an Ähnliches bei Novalis) Gott = ±0 gesetzt, und er empfand das durchaus als den Ausdruck eines echten Gottgefühls.
Diese Zusammenhänge sind unendlich wichtig, denn sie erklären die Heraufkunft der Physik am Ende einer Kultur und ihre wachsende Tyrannei über den späten, städtischen Geist — das groteske Phänomen einer „naturwissenschaftlichen Weltanschauung“. Sie erklären aber auch den vorbestimmten Entwicklungsgang einer jeden Physik, die auf dem Wege zur reinen archimedischen Statik oder reinen modernen Dynamik immer weniger seelenhaft, immer intellektueller, immer atheistischer wird. Insofern besteht eine natürliche Verwandtschaft zwischen jeder gereiften Physik und der Religion, aus deren intuitiver Weltform sie ursprünglich hervorgegangen ist. Jede „moderne Weltanschauung“ ist Physik, in Zahlen und Begriffe gebrachter Pantheismus. Wie stark der mythenbildende Trieb selbst einer späten Seele ist, sieht man an ihrer letzten Schöpfung, der physikalischen Mythologie, wo der wissenschaftliche Geist ihrem Zwecke dienstbar gemacht wird. Jede Atomlehre ist ein Mythus, die kinetische Gastheorie ist es so gut wie die Edda. Ob ein Skalde oder ein Gelehrter das Medium ist, ist eine Frage des Stadiums.
Jedes lebendige Seelentum ist religiös, hat Religion, ob es sich dessen bewußt ist oder nicht. Daß es überhaupt da ist, daß es wird, sich entwickelt, sich erfüllt, ist seine Religion. Es steht ihm nicht frei, irreligiös zu sein. Es ist ihm nur möglich,[S. 585] wie im mediceischen Florenz mit dem Gedanken daran zu spielen. Der Mensch der Weltstädte aber ist irreligiös. Das gehört zu seinem Wesen, das bezeichnet seine historische Erscheinung. Er mag aus der schmerzlichen Empfindung einer inneren Leere und Armut noch so ernstlich religiös sein wollen, er kann es nicht. Alle weltstädtische Religiosität beruht auf Selbsttäuschung. Daß in der späten Kaiserzeit eine echte Religiosität sich in Rom verbreitete, beweist, daß unter der Kruste der erloschenen Antike bereits ein neues Menschentum lebendig war. Der Römer zur Zeit Aurels, nur rechtlich und sprachlich, nicht seelisch mehr Ausdruck des antiken Seins, lebte in der Riesenstadt, als sei sie Land. Rom war nur scheinbar, materiell noch Weltstadt; innerlich gewogen war es eine altgewordne, entseelte Häusermasse, in der eine fremde Bevölkerung bäuerlich-dumpf und in primitiven Lebensformen hauste. Dem entsprach eine durchaus frühmenschlich-naive Religiosität.
Inzwischen hatte sich die Form der Religiosität verwandelt. Für den apollinischen Menschen offenbarte sich das Wesen seiner Religion im sinnlich-plastischen Kultus. Er besaß weder mystische Geheimnisse noch ein bindendes Dogma. Die eleusinischen Mysterien waren kein Geheimkult. Was den Eingeweihten verboten war — und schließlich war jeder eingeweiht, der es wünschte —, war die Profanation der heiligen Handlungen, also eben die Entweihung des sinnlichen Elements. Äschylus wurde angeklagt, weil er die Tracht der Eleusispriester zum Kostüm der attischen Szene gemacht hatte. Der faustischen Seele aber war das transzendente Dogma wesentlich, nicht der Kult. Gottlos war für sie die Auflehnung gegen eine Lehre; hier begann der Begriff der Ketzerei. Diese Religion konnte ihrer Natur nach keine Gewissensfreiheit gestatten — das widerspricht der Dynamik, dem Machtwillen über die Seelen. Darin macht auch das Freidenkertum keine Ausnahme. Auf den Scheiterhaufen folgte die Guillotine, auf das Verbrennen der Bücher ihr Totschweigen. Es gibt unter uns keine Partei ohne Neigung zur Inquisition in irgendeiner Form. Gottlos aber war für die Antike eine Verachtung des Kultus — ἀσέβεια im wörtlichen Sinne — und hier duldete die apollinische Religion keine Freiheit des Verhaltens. Damit war in beiden Fällen eine Grenze der[S. 586] Toleranz gezogen, welche das Gottgefühl forderte und welche es verbot.
In diesem Punkte nun stand die spätantike Philosophie die sophistisch-stoische Theorie (nicht die stoische Weltstimmung) dem religiösen Empfinden entgegen, und hier war das Volk von Athen — desselben Athens, das auch noch den „unbekannten Göttern“ Altäre baute — von der Unerbittlichkeit der spanischen Inquisition. Man hat nur die lange Reihe antiker Denker und historischer Persönlichkeiten zu mustern, die der Heilighaltung des Kultus geopfert wurden. Sokrates und Diagoras wurden der Asebeia wegen hingerichtet; Anaxagoras, Protagoras, Aristoteles, Alkibiades konnten sich nur durch Flucht retten. Die Zahl der wegen Kultfrevels Hingerichteten zählt allein in Athen und nur während der Jahrzehnte des Peloponnesischen Krieges nach Tausenden. Nach der Verurteilung des Protagoras wurden seine Schriften von Haus zu Haus gesucht und verbrannt. In Rom beginnen die historisch noch erkennbaren Akte dieser Art mit der 181 vom Senat angeordneten öffentlichen Verbrennung der pythagoräischen „Bücher des Numa“, und von da an folgen ohne Unterbrechung Ausweisungen einzelner Philosophen und ganzer Schulen, späterhin Hinrichtungen und die feierliche Verbrennung von Schriften, die der Religion gefährlich werden konnten. Hierher gehört die Tatsache, daß allein zur Zeit der Diktatur Cäsars die Stätten des Isiskultes von den Konsuln viermal zerstört worden sind, und daß Tiberius das Bild der Göttin in die Tiber werfen ließ. Die Nichtbegehung des Geburtstages des Cäsar war unter Strafe gestellt. Die Verweigerung des Divusopfers war unzweifelhaft eine Auflehnung gegen das antike Religionsempfinden. In allen Fällen handelt es sich um „Atheismus“, wie er sich aus dem antiken Gottgefühl ergab und wie er sich als theoretische oder praktische Mißachtung des Kultus manifestierte. Wer in diesen Dingen nicht das eigne, abendländische Empfinden aus dem Spiele lassen kann, wird nie in das Wesen der hier zugrunde liegenden seelischen Phänomene eindringen. Dichter und Philosophen durften Mythen erfinden und Göttergestalten umbilden, soviel sie wollten. Die dogmatische Deutung des sinnlich Gegebenen stand in jedermanns Belieben. Man konnte die Götter in Satyrspielen und[S. 587] Komödien nach Herzenslust lächerlich machen — selbst das griff nicht an ihre euklidische Existenz —, aber an den Kultus, die plastische Gestaltung der Götterverehrung, durfte nicht gerührt werden. Hier fand die Duldung des antiken Menschen ein Ende. Hier war das eigentliche Wesen seiner Religion angetastet. Cäsar, ein vollkommener Skeptiker, hat für die Wiederherstellung alter Kulte peinlichst Sorge getragen. Man mißversteht die feinen Geister der ersten Kaiserzeit, wenn man es als Heuchelei nimmt, daß sie, ohne irgendeinen Mythus noch ernst zu nehmen, alle Verpflichtungen des Staatskultus, vor allem des allenthalben tief empfundenen Kaiserkultes auf sich nahmen. Umgekehrt stand es dem Dichter und Denker der gereiften faustischen Kultur frei, „nicht zur Kirche zu gehen“, die Beichte zu meiden, bei Prozessionen daheim zu bleiben, in protestantischer Umgebung ohne alle Verbindung mit kirchlichen Institutionen zu leben, nicht aber an dogmatische Einzelheiten zu rühren. Das war innerhalb aller Konfessionen und Sekten (das Freidenkertum nochmals ausdrücklich einbegriffen) gefährlich. Das Beispiel des stoischen Römers, der ohne Glauben an die Mythologie die sakralen Formen pietätvoll beobachtet, findet sein Gegenstück an Menschen der Aufklärungszeit wie Lessing und Goethe, die, ohne die kirchlichen Gebräuche zu erfüllen, doch niemals an den „Grundwahrheiten des Glaubens“ zweifeln.
Kehren wir vom gestaltgewordnen Naturgefühl zur systemgewordnen Naturerkenntnis zurück, so kennen wir Gott oder die Götter als den Ursprung der Gebilde, durch welche der Geist reifer Kulturen sich der Umwelt begrifflich zu bemächtigen sucht. Die starke Religiosität der Mechanik Newtons und die fast vollkommen atheistisch formulierte moderne Dynamik sind von gleicher Farbe, Position und Negation desselben Urgefühls. Ein physikalisches System trägt mit Notwendigkeit alle Züge der Seele, zu deren Formenwelt es gehört. Zur antiken Statik und euklidischen Geometrie gehört der olympische Polytheismus. Zur Dynamik und analytischen Geometrie gehört der Deismus des Barock. Seine drei Grundprinzipien Gott, Freiheit und Unsterblichkeit[S. 588] heißen in der Sprache der Mechanik das Prinzip der Trägheit (Galilei), das Prinzip der kleinsten Wirkung (d’Alembert) und das Prinzip der Erhaltung der Energie (Mayer).
Was wir heute ganz allgemein Physik nennen, ist in der Tat ein Barockphänomen. Es wird nicht mehr als paradox empfunden werden, wenn ich insbesondere diejenige Vorstellungsweise, welche auf der Annahme von Fernkräften und den der naiv-antiken Anschauung völlig fremden Fernwirkungen, der Attraktion und Repulsion von Massen beruht, in Erinnerung an die gleichzeitige Epoche der Architektur (Vignola) als den Jesuitenstil in der Physik bezeichne, wie mir ganz ebenso die Infinitesimalrechnung, die nur im Abendlande und gerade damals entstand und nur dort entstehen konnte, den Barockstil, den Jesuitenstil in der Mathematik darzustellen scheint. Wer die Physik für eine ewige Wissenschaft hält, die sich in Jahrtausenden fortschreitend vervollkommnet und sich „der“ Wahrheit mehr und mehr nähert, hat das Bedingte in ihr, die Gewißheit, von späteren Kulturen und deren andersgeartetem Naturgefühl völlig mißverstanden, verachtet und wieder vergessen zu werden, und damit ihren tieferen Sinn nicht begriffen. Symbole vergehen, und die Formenwelt einer Physik ist ein Symbol. Die gesamte moderne Naturwissenschaft ist Teil des Ausdrucks der faustischen Seele, und damit sind Anfang, Ende und Umfang ihres historisch-lebendigen Daseins unwiderruflich festgelegt.
Die abendländische Physik ist ihrem Typus nach dogmatisch, nicht kultisch. Ihr Inhalt ist das Dogma von der Kraft, die mit dem Raume, der Distanz identisch ist, das von der unendlichen Wirkung in die Ferne, von der Tat, nicht der Haltung. Ihre Tendenz ist demnach die fortschreitende Überwindung des Augenscheins. Von einer noch sehr „antiken“ Einteilung in eine Physik des Auges (Optik), Ohres (Akustik) und Hautsinnes (Wärmelehre) ausgehend hat sie die Sinnesempfindungen allmählich ganz ausgeschaltet und durch abstrakte Beziehungssysteme ersetzt, so daß z. B. die strahlende Wärme infolge der Vorstellungen von den Bewegungen des Äthers heute in der Optik behandelt wird.
„Kraft“ ist ein Urbegriff, der nicht vom Geiste konstruiert[S. 589] worden ist, der im Gegenteil die Struktur des westeuropäischen Geistes ausbilden half.[121]
Es ist das Gefühl von Gott, das logisch in Erscheinung tritt: Aus der instinktiven Polarität von Gott und Welt wird die intellektuelle von Kraft und Masse. Indem man ein Etwas im Naturbilde Kraft nannte, hatte man die erkannte, nicht die erlebte, die geistig, nicht seelisch erfüllte Natur einer Symbolik unterworfen. Eine physikalische Theorie ist ein intellektueller Mythus.
Daß diese Kraft oder Energie in der Tat eine zum Begriff erstarrte Idee und nicht entfernt ein reines Resultat wissenschaftlicher Forschung ist, wird durch die oft übersehene Tatsache bestätigt, daß das Grundprinzip der Dynamik, der bekannte erste Hauptsatz der mechanischen Wärmetheorie, überhaupt nichts über das Wesen der Energie aussagt. Daß die „Erhaltung der Energie“ in ihm fixiert sei, ist eigentlich ein falscher, aber psychologisch sehr bezeichnender Ausdruck. Die Dynamik kann ihrer Natur nach nur Relatives, nur Energiedifferenzen feststellen, und ihre Gesetze beziehen sich allein darauf. Es bleibt jedesmal, wie man sich ausdrückt, eine additive Konstante unbestimmt, d. h. man sucht das mit dem inneren Auge aufgefaßte Bild einer Kraft festzuhalten, obwohl die wissenschaftliche Praxis nichts damit zu tun hat.
Aus dieser Genesis des Kraftbegriffs folgt, daß er, über die Möglichkeiten der strengen Logik hinausgreifend, nicht etwa von ihr geprägt, ebensowenig genau definierbar ist wie die ebenfalls in den antiken Sprachen fehlenden Begriffe des Willens und des Raumes. Es ist unmöglich, das Gefühl von Gott exakt in eine extensiv-begriffliche Form zu bringen. Es bleibt ein gefühlter, geschauter Rest, der jede tatsächlich erfolgte Definition zu einem Bekenntnis ihres Urhebers macht. Jeder Denker, Mathematiker und Physiker des Barock hat hier ein inneres[S. 590] Erlebnis, das er in Worte kleidet. Man denke an Goethe, der seinen Begriff einer Weltkraft nicht hätte definieren können und mögen, aber seiner gewiß war. Kant nannte die Kraft die Erscheinung eines an sich Seienden („Die Substanz im Raume, den Körper, kennen wir nur durch Kräfte“). Laplace nannte sie eine Unbekannte, deren Wirkungen wir nur erkennen; Newton hatte an immaterielle Fernkräfte gedacht. Leibniz sprach von der vis viva als einem Quantum, das mit der Materie zusammen die Einheit der Monade bildet. Descartes war ebensowenig wie einzelne Denker des 18. Jahrhunderts (Lagrange) gewillt, Bewegung von Bewegtem prinzipiell zu sondern. Neben potentia, impetus, virtus finden sich Umschreibungen mit conatus und nisus, wo offenbar die Kraft von der auslösenden Ursache nicht gesondert worden ist (der „Wille Gottes“). Es ist sehr wohl möglich, katholische, protestantische und atheistische Kraftbegriffe zu unterscheiden. Spinoza, als Jude, seelisch also noch der magischen Kultur zugehörig, vermochte den faustischen Kraftbegriff überhaupt nicht zu rezipieren. Er fehlt in seinem System. Und es ist ein erstaunliches Zeichen für die Intensität der Urbegriffe, daß H. Hertz, der einzige Jude unter den großen Physikern der Jetztzeit, auch der einzige ist, der den Versuch gemacht hat, das Dilemma der Mechanik durch Ausschaltung des Kraftbegriffs zu lösen.
Das Dogma von der Kraft ist das einzige Thema der faustischen Physik. Was unter dem Namen Statik als Teil der Naturwissenschaft durch alle Systeme und Jahrhunderte geschleppt wurde, ist eine Fiktion. Es steht mit einer „modernen Statik“ nicht anders als mit der „Arithmetik“ und „Geometrie“, wörtlich den Lehren vom Zählen und Messen, die innerhalb der neueren Analysis ebenfalls, wenn man mit den Worten überhaupt noch den ursprünglichen Sinn verbindet, leere Namen, literarische Reste antiker Wissenschaften sind, die zu beseitigen oder auch nur als Scheingebilde zu erkennen uns die Ehrfurcht vor allem Antiken nicht gestattet hat. Es gibt keine abendländische Statik, d. h. keine dem abendländischen Geist natürliche Art der Interpretation mechanischer Tatsachen, welche die Begriffe Gestalt und Substanz (allenfalls Raum und Masse) statt Raum, Zeit, Masse und Kraft zugrunde legt. Man kann das auf[S. 591] jedem einzelnen Gebiet nachprüfen. Selbst die „Temperatur“, die doch am ehesten den antik-statischen Eindruck einer passiven Größe macht, läßt sich diesem System erst einordnen, wenn sie im Bild einer Kraft erfaßt wird: Die Wärmemenge als Inbegriff der sehr schnellen, feinen, unregelmäßigen Bewegungen der Atome eines Körpers, seine Temperatur als die mittlere lebendige Kraft dieser Atome.
Die Renaissance hatte die archimedische Statik wiederzuerwecken geglaubt, ebenso wie sie die hellenische Plastik fortzusetzen glaubte. In beiden Fällen hat sie die endgültigen Konzeptionen des Barock, und zwar aus dem Geiste der Gotik, nur vorbereitet. Mantegna gehört zur Statik der Bildmotive, auch Raffael, dessen Geste man später steif und kalt gefunden hat; mit Lionardo beginnt die Dynamik, und Rubens ist ein Maximum der Bewegtheit schwellender Leiber. Das hintergrundlose Fresko ist eine statische, das perspektivische Ölgemälde eine dynamische Gattung. Das Fresko malt körperhafte Grenzen, das Ölbild löst sie auf. Der Impressionismus endlich stellt eine reine Dynamik der Farben dar; Körpergrenzen gegen den Raum bedeuten ihm nicht mehr wie der Elektrodynamik, in deren Kraftfeldern sie mathematisch von ganz untergeordneter Bedeutung sind.
Im Sinne der Renaissancephysik hat noch 1629 Nicolaus Cabeo aus Ferrara, ein Jesuit, eine Theorie des Magnetismus im Stile der aristotelischen Weltauffassung entwickelt, die ebenso wie die florentinische Freskotechnik keine Folgen haben konnte, nicht weil sie „falsch“ gewesen wäre, sondern weil sie dem faustischen Naturgefühl widersprach, das durch die Renaissance eben aus der arabisch-magischen Vormundschaft befreit worden war und das nun eigene Formen für den Ausdruck seiner Welterkenntnis brauchte. Cabeo verzichtet auf die Begriffe Kraft und Masse und beschränkt sich auf die klassischen: Stoff und Gestalt, das heißt, er geht vom Geiste der Architektur des alternden Michelangelo und des Vignola auf den Michelozzos und Raffaels zurück und entwirft so ein vollkommen in sich geschlossenes, aber für die Zukunft belangloses System. Der Magnetismus als Zustand einzelner Körper, nicht als Kraft im grenzenlosen Raume — das konnte das innere Auge des westeuropäischen[S. 592] Menschen nicht befriedigen. Wir brauchten eine Theorie der Ferne, nicht der Nähe. Ein andrer Jesuit, Boscovich, hat dann Newtons mathematisch-mechanische Prinzipien als erster zu einer umfassenden eigentlichen Dynamik ausgestaltet (1758).
Galilei stand noch unter dem Eindruck starker Reminiszenzen des Renaissancegefühls, dem die Antithese von Kraft und Masse, aus der im architektonischen, malerischen und physikalischen Stil das Element der großen Bewegung folgt, fremd war. Er beschränkt die Vorstellung der Kraft noch auf Berührungskräfte (Stoß) und formuliert lediglich eine Erhaltung der Quantität der Bewegung. Damit hält er am älteren Prinzip der Bewegung unter Ausschluß eines räumlichen Pathos fest, und erst Leibniz entwickelte, gegen ihn polemisierend, die Idee der eigentlichen, im unendlichen Raume wirksamen, freien Kräfte (lebendige Kraft, activum thema), die er dann im Zusammenhange mit seinen mathematischen Entdeckungen vollkommen durchführte. An Stelle der Erhaltung der Bewegungsquantität trat die Erhaltung der lebendigen Kräfte. Das entspricht dem Ersatz der Zahl als Größe durch die Zahl als Funktion.
Der Begriff der Masse wurde erst etwas später, als Gegenbegriff zur Kraft, deutlich ausgebildet. Bei Galilei und Kepler erscheint an seiner Stelle das Volumen, und erst Newton hat ihn mit Bestimmtheit funktional gefaßt (die Welt als Funktion Gottes). Es ist dem Renaissanceempfinden völlig widersprechend, daß die Masse — heute definiert als das konstante Verhältnis von Kraft und Beschleunigung in bezug auf ein System materieller Punkte — dem Volumen keineswegs proportional ist, wofür die Planeten ein wichtiges Beispiel gaben.
Aber Galilei mußte doch schon nach Ursachen der Bewegung fragen. Diese Frage hatte innerhalb einer eigentlichen, auf die Begriffe Stoff und Form beschränkten Statik keinen Sinn. Für Archimedes war die Ortsveränderung neben der Gestalt als dem eigentlichen Wesen alles extensiven Daseins belanglos; was hätte auf die Körper wirken sollen — von außen —, da der Raum „nicht ist“? Die Dinge bewegen sich, sie werden nicht bewegt. Erst Newton schuf in völliger Unabhängigkeit[S. 593] von der Fühlweise der Renaissance den Begriff der Fernkräfte, der Anziehung und Abstoßung von Massen durch den Raum hindurch. Diese Idee hat nichts sinnlich Greifbares mehr, und Newton selbst empfand vor ihr einiges Unbehagen. Sie hatte ihn, nicht er sie ergriffen. Es ist der dem unendlichen Raume zugewandte Geist des Barock selbst, der diese kontrapunktische, gänzlich unplastische Konzeption hervorgerufen hat. Und zwar mit einem inneren Widerspruch. Man hat diese Fernkräfte niemals hinreichend definieren können. Kein Mensch hat je begriffen, was eigentlich Zentrifugalkraft ist. Ist die Kraft der sich um ihre Achse drehenden Erde die Ursache dieser Bewegung oder umgekehrt? Oder sind beide identisch? Wenn eine Bewegung in Erscheinung tritt — ist sie dann Wirkung einer Ursache, und ist diese Ursache, logisch isoliert, eine Kraft oder eine andere Bewegung? Wie unterscheiden sich Kraft und Bewegung? Die Veränderungen im Planetensystem sollen Wirkungen einer Zentrifugalkraft sein. Aber dann müßten die Körper aus ihrer Bahn geschleudert werden, und da dies nicht der Fall ist, nimmt man auch noch eine Zentripetalkraft an. Aber was bedeuten diese Worte? Die Unmöglichkeit, hier Ordnung und Klarheit zu schaffen, hatte Heinrich Hertz bewogen, auf den Kraftbegriff überhaupt wieder zu verzichten und sein System der Mechanik durch die äußerst künstliche Annahme von festen Koppelungen zwischen Lagen und Geschwindigkeiten auf das Prinzip der Berührung (Stoß) zurückzuführen. Aber damit sind die Verlegenheiten nur verdeckt, nicht behoben. Sie sind spezifisch faustischer Natur und wurzeln im tiefsten Wesen der Dynamik. „Dürfen wir von Kräften reden, welche erst durch Bewegung entstehen?“ Gewiß nicht. Aber können wir auf die dem abendländischen Geiste eingebornen Urbegriffe verzichten, weil sie undefinierbar sind? Hertz selbst hat keinen Versuch gemacht, sein System praktisch in Anwendung zu bringen.
„Die Erscheinung — sagt Goethe — ist vom Beobachter nicht losgelöst, vielmehr in dessen Individualität verschlungen und verwickelt.“ Gerade die letzten, vermeintlich objektivsten Begriffe der Naturerkenntnis sind Symbole, sind aus einem Gefühl entsprungen, das in dieser Gestalt nur der Seele einer[S. 594] bestimmten, der apollinischen, magischen, faustischen Seele eigen ist. So gering der organische Rest in ihnen sein mag, er läßt sich nicht überwinden, denn der Physiker arbeitet nicht nur als Intellekt, sondern als Mensch, als der er Ausdruck und Organ seiner Kultur ist. Jede Erkenntnis ist nicht nur ein Resultat, sondern auch ein Akt.
Man erinnere sich nochmals, daß nicht die bloßen geschriebenen oder gesprochenen Formeln, sondern die den toten Ziffern unterlegten Bilder, die ihnen erst Blut und Seele geben, das Wesen der Physik ausmachen. Die Kraft ist ein solches Bild. Die beiden möglichen Natureindrücke des Kulturmenschen, die lebendige Goethesche und die tote Newtonische Natur sind einander verwandt. Und zwar folgt die zweite aus der ersten. Das Werden, in den Worten Leben, Zeit, Schicksal, Richtung, Gott sich offenbarend liegt dem Gewordnen, das mit dem Erkannten identisch ist, zugrunde. Die physikalische Phantasie des faustischen Menschen drängt stets zur Imagination unendlich bewegter Scharen von kleinsten Elementen. Dies Prinzip, dem die Mathematik in der Gruppentheorie, der Mengenlehre Rechnung getragen hat, kehrt in der kinetischen Gastheorie, der Vorstellung von Kraftfeldern, Ionen, Elektronen wieder. Aber es ist dasselbe, was das Weltgefühl der früheren Jahrhunderte längst in seinen Kobolden, Zwergen und Wichten, in dem „stillen Volk“ in Wiesen und Bergen, den Elfen, die im Laub, im Sonnenlichte „weben“, den in imaginären Räumen liegenden Reichen von elbischen winzigen rastlosen Wesen verkörpert hat, und hier haben wir den Ursprung dessen zu suchen, was die Worte Kraft und Bewegung enthalten und was über alle Möglichkeiten logischer Fixierung hinausgeht.
Diese immanente Verlegenheit der modernen Mechanik wird durch die von Faraday begründete Potentialtheorie — nachdem der Schwerpunkt des physikalischen Denkens aus der Dynamik der Materie in die Elektrodynamik des Äthers gerückt war — keineswegs beseitigt. Der berühmte Experimentator, der durchaus Visionär und unter allen Meistern der neuern Physik der einzige Nichtmathematiker war, bemerkte 1846: „Ich nehme in irgendeinem Teil des Raumes, mag er nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauch leer oder von Materie erfüllt sein, nichts wahr[S. 595] als Kräfte und die Linien, in denen sie ausgeübt werden.“ In dieser Definition tritt die ihrem Gehalte nach organische, das Erlebnis des Erkennenden bezeichnende, spezifisch historische Richtungstendenz — der Wille zur Macht — deutlich hervor; damit knüpft Faraday metaphysisch an Newton an, dessen Fernkräfte ein immaterielles Prinzip darstellen, dessen Kritik der fromme Physiker ausdrücklich ablehnte. Der zweite noch mögliche Weg, zu einem eindeutigen Begriff der Kraft zu gelangen — von der „Welt“, nicht von „Gott“, vom Objekt, nicht vom Subjekt des natürlichen Bewegtseins aus —, führte eben damals zur Konzeption des Begriffs der Energie, die im Unterschiede von der Kraft ein Quantum, keine Richtung darstellt und insofern an Leibniz und an dessen Idee der lebendigen Kraft mit ihrer unveränderlichen Quantität anknüpft; man sieht, daß hier wesentliche Merkmale des Massebegriffs herübergenommen worden sind, derart, daß sogar der bizarre Gedanke einer atomistischen Struktur der Energie in Erwägung gezogen worden ist.
Indessen ist mit dieser Neuordnung der Eigenschaften das Grundgefühl vom Vorhandensein einer Weltkraft und ihres Substrats nicht verändert und damit die Unlösbarkeit des Bewegungsproblems nicht widerlegt worden.
Man wird sich erinnern, daß im vorigen Kapitel der Abstieg von der tragischen zur Plebejermoral, von der Kultur zur Zivilisation des westeuropäischen Menschen durch den Übergang vom ethischen Grundprinzip der Tat zu dem der Arbeit charakterisiert wurde. Der große Mensch der Vergangenheit von den Hohenstaufen bis zu Napoleon verrichtete Taten, der moderne Gehirnmensch, sei er Feldherr oder Experimentator, arbeitet. Wir sind alle Arbeiter, und der Unterschied besteht nur noch zwischen geistiger und ungeistiger Arbeit. Es ist überaus bezeichnend, daß sich genau derselbe Begriffswechsel in der physikalischen Formensprache vollzieht. Das Naturbild Brunos, Newtons, Goethes imaginiert ein göttliches Prinzip, das sich in Taten auswirkt. Die zivilisierte, atheistische Physik setzt den Begriff auf ein intellektuelles Niveau herab: die Natur „leistet Arbeit“. Unter diesem Eindruck steht die heutige Mechanik. Die entscheidende Entdeckung J. R. Mayers fällt mit der Geburt der sozialistischen Theorie zusammen. Gleichzeitig[S. 596] vollzieht sich der sehr tiefliegende Begriffswechsel von der Kraft zur Energie (einem Quantum). Man wird ferner die strenge Kongruenz dieser Formenwelt mit der gleichzeitig ausgebildeten der Nationalökonomie bemerken. Nationalökonomie — das war, wie wir sahen, die notwendige Fassung der praktischen Dynamik eines willensstarken Menschentums, das nach Dauer, Zukunft, Macht, Tat strebt. Auch die nationalökonomischen Systeme operieren mit denselben Begriffen; seit Adam Smith wird das Wertproblem mit dem Arbeitsquantum in Beziehung gesetzt; das ist Quesney und Turgot gegenüber der Schritt von einer organischen zu einer mechanischen Struktur des Wirtschaftsbildes. Was hier als „Arbeit“ der Theorie zugrunde liegt, ist rein dynamisch gemeint. Man könnte die genauen Analoga der Prinzipien von der Erhaltung der Energie, der Entropie, der kleinsten Wirkung auffinden. Man vergleiche diese parallele Entwicklung mit jener der antiken — volkswirtschaftlichen und physikalischen — Statik, und man wird einsehen, in welchem Grade die vermeintliche „Erfahrung“ von der geistigen Gestaltungskraft vorausbestimmt wird.
Betrachtet man demnach die Stadien, welche der zentrale Begriff der Kraft seit seiner Geburt im frühen Barock durchlaufen hat, und zwar in genauester Verwandtschaft mit den Formenwelten der großen Künste und der Mathematik, so findet man drei: Im 17. Jahrhundert (Galilei, Newton, Leibniz) trat er bildhaft ausgeprägt neben die große Ölmalerei, die um 1680 erlosch; im 18., dem der klassischen Mechanik (Laplace, Lagrange), stand er neben der Musik Bachs und empfing den intuitiven Charakter des kontrapunktischen Stils; im 19., wo die Künste zu Ende sind und die zivilisierte Intelligenz das Seelenhafte überwältigt, erscheint er in der Sphäre der reinen Analysis, und zwar insbesondere der Theorie der Funktionen von mehreren komplexen Variablen, ohne die er sich in seiner modernsten Bedeutung kaum mehr verständlich machen läßt.
Damit aber ist — darüber täusche sich niemand — die westeuropäische Physik an der Grenze ihrer inneren Möglichkeiten[S. 597] angelangt. Der Sinn ihrer Erscheinung war, das faustische Naturgefühl in Erkenntnis, die Gestalten eines frühzeitlichen Glaubens in mechanische Formen eines exakten Wissens zu verwandeln. Daß die einstweilen noch zunehmende Gewinnung praktischer oder auch nur gelehrtenhafter Ergebnisse — ein Oberflächenphänomen der Wissenschaftsgeschichte — mit der raschen Zersetzung ihres Wesenskerns nichts zu tun hat, braucht kaum gesagt zu werden. Bis zum Ausgang des 19. Jahrhunderts erfolgen alle Schritte in der Richtung einer inneren Vollendung, einer wachsenden Reinheit, Schärfe und Fülle des dynamischen Naturbildes; von da an, wo ein Optimum von Deutlichkeit im Theoretischen erreicht ist, beginnen sie plötzlich auflösend zu wirken. Das geschieht nicht absichtlich; das kommt den hohen Intelligenzen der modernen Physik nicht einmal zum Bewußtsein. Darin liegt eine unabwendbare historische Notwendigkeit. Die antike Physik hatte sich in demselben Stadium, um 200 v. Chr., innerlich vollendet. Die Analysis kam mit Gauß, Cauchy und Riemann zum Ziele und füllt heute nur noch die Lücken ihres Gebäudes aus.
Daher erheben sich plötzlich vernichtende Zweifel an Dingen, die noch gestern das unbestrittene Fundament der physikalischen Theorie bildeten, am Sinne des Energieprinzips, am Begriff der Masse, des Raumes, der absoluten Zeit, des kausalen Naturgesetzes überhaupt. Das sind nicht mehr jene schöpferischen Zweifel des frühen Barock, die einem Erkenntnisziele entgegenführen; diese Zweifel gelten der Möglichkeit einer Naturwissenschaft überhaupt. Welche tiefe und von ihren Urhebern offenbar gar nicht gewürdigte Skepsis liegt allein in der rasch zunehmenden Benützung abzählender, statistischer Methoden, die nur eine Wahrscheinlichkeit der Ergebnisse bezwecken und die absolute Exaktheit der Naturgesetze, wie man sie früher hoffnungsvoll verstand, ganz aus dem Spiele lassen!
Wir nähern uns dem Augenblick, wo man die Möglichkeit einer geschlossenen und in sich widerspruchslosen Mechanik endgültig aufgibt. Ich hatte gezeigt, wie jede Physik an dem Bewegungsproblem scheitern muß, in welchem die lebendige Person des Erkennenden in die anorganische Formenwelt der vollzogenen Erkenntniselemente hereinragt. Aber alle neuesten Hypothesen[S. 598] enthalten diese Verlegenheit in einer nach dreihundertjähriger Denkarbeit erzielten äußersten Zuspitzung, die keine Täuschung mehr zuläßt. Die Gravitationstheorie, seit Newton eine unumstößliche Wahrheit, ist als eine zeitlich beschränkte und schwankende Annahme erkannt worden. Das Prinzip der Erhaltung der Energie hat keinen Sinn, wenn die Energie unendlich in einem unendlichen Raume gedacht wird. Die Annahme des Prinzips läßt sich mit keiner Art von dreidimensionaler Struktur des Weltraums, weder der unendlichen euklidischen, noch (unter den nichteuklidischen Geometrien) der sphärischen mit ihrem unbegrenzten, aber endlichen Volumen vereinen. Seine Gültigkeit wird also auf ein „nach außen abgeschlossenes System von Körpern“ beschränkt, eine künstliche Begrenzung, die es in Wirklichkeit nicht gibt und nicht geben kann. Man wird zugeben, daß das Weltgefühl des faustischen Menschen, aus dem diese grundlegende Vorstellung — die Unsterblichkeit der Weltseele, mechanistisch und extensiv umgedacht — hervorging, gerade die symbolische Unendlichkeit hatte ausdrücken wollen. So fühlt man, aber der Intellekt vermochte das in seiner Sphäre nicht zu verifizieren. Es war ferner der Lichtäther ein ideales Postulat der modernen Naturerkenntnis, die zu jeder Bewegung die Vorstellung eines Bewegten forderte. Aber jede denkbare Hypothese über die Beschaffenheit des Äthers wurde sofort durch innere Widersprüche widerlegt. Insbesondere hat Lord Kelvin mathematisch nachgewiesen, daß es eine einwandfreie Struktur dieses Lichtträgers nicht gibt. Da Lichtwellen nach der Interpretation der Versuche Fresnels transversal sind, müßte der Äther ein fester Körper (mit wahrhaft grotesken Eigenschaften) sein, aber in diesem Falle würden die Elastizitätsgesetze für ihn gelten, und die Lichtwellen wären demnach longitudinal. Die Maxwell-Hertzschen Gleichungen der elektromagnetischen Lichttheorie, die in der Tat reine, unbenannte Zahlen von unzweifelhafter Gültigkeit sind, schließen jede Deutung durch irgendeine Mechanik des Äthers aus. Man hat nun den Äther, vor allem unter dem Eindruck der Folgerungen aus der Relativitätstheorie, als das reine Vakuum definiert, was doch nicht viel andres als eine Zerstörung des dynamischen Urbildes bedeutet.
[S. 599]
Seit Newton besaß die Annahme einer konstanten Masse — des Gegenstückes der konstanten Kraft — unbestrittene Gültigkeit. Moderne Hypothesen, die auf Grund von experimentellen Erfahrungen notwendig geworden waren, haben diese Annahme zerstört. Jedes abgeschlossene System besitzt neben der kinetischen Energie noch die Energie der strahlenden Wärme, die nicht von ihr trennbar und deshalb durch den Begriff der Masse nicht rein darstellbar ist. Denn wird die Masse durch die lebendige Energie definiert, so ist sie im Hinblick auf den thermodynamischen Zustand nicht mehr konstant. Aber weit über diese partiellen Zweifel hinaus greift das Relativitätsprinzip, die revolutionäre Theorie vom Beginn des 20. Jahrhunderts, in den Kern der Dynamik ein.
Bekanntlich hat der Begriff Bewegung im leeren Raume keinen Sinn. Das wissenschaftliche Denken kennt nur Lageveränderungen mehrerer Körper relativ zueinander. In diesem Falle aber wendet das antike Weltgefühl greifbare, absolute Maße an, um absolute Bewegungsgrößen zu messen. Hier liegt also ein Rest von plastischem, statuenhaftem Empfinden (sinnlicher Konstanz) vor, den das faustische Naturdenken noch aufzulösen hatte.
Gibt es absolute Maße? Nimmt man in kosmischen Verhältnissen den Abstand der Erde von der Sonne als Maßeinheit, so ist der Lichtweg zu messen; es gibt keine andere Möglichkeit. Das Licht aber braucht Zeit, und damit tritt ein organischer, historischer Faktor in den Akt der messenden Vergleichung ein. Abstände werden durch Lichtsignale abgegrenzt, und es fragt sich, in welcher Zeit das Licht (bei gleichbleibender Geschwindigkeit) von der Sonne her die Erde erreicht. Wir kennen die Bewegung der Erde relativ zur Sonne, nicht aber die absolute Bewegung des Sonnensystems im Raume, die etwa in der Richtung von der Erde zur Sonne oder umgekehrt stattfinden könnte. Aber in diesen Fällen wird der tatsächliche Lichtweg abgekürzt oder verlängert, da der Beobachter dem Licht entgegenkommt oder sich von ihm entfernt, und damit verliert die Lichtzeit die Eigenschaft einer absoluten Größe, weil nach dem berühmten Versuch von Michelson die Geschwindigkeit des Lichtes von der Bewegung der durchdrungenen Körper unberührt bleibt. Daraus[S. 600] ergeben sich unabsehbare Folgerungen. So gut wir eine Bewegung nur als Lageveränderungen eines Körpers relativ zu einem andern auffassen können — die ägyptischen Pyramiden, die relativ zur Erde ruhen, bewegen sich doch relativ zur Sonne mit gewaltiger Geschwindigkeit durch den Weltraum —, so gut ist eine Zeit nur in bezug auf den Standort eines Beobachters eindeutig meßbar; man kann Fälle annehmen, wo für zwei Beobachter in bezug auf zwei Ereignisse die Begriffe früher und später sich umkehren. Damit aber ist auch die Konstanz aller physikalischen Größen aufgehoben, in deren Definition die Zeit eingegangen ist, und die westeuropäische Dynamik besitzt im Gegensatz zur antiken Statik nur solche Größen. Eine Strecke messe ich durch Vergleich der relativen Lage der Endpunkte, und dieser Vergleich beansprucht Zeit. Man weiß, daß Fixsterne, deren Standort durch das auf der Erde ankommende Licht bestimmt wird, an einer anderen Stelle des Himmels erscheinen als der, die sie „wirklich“ einnehmen. Dieselbe Strecke kann für verschiedene Beobachter je nach deren „Bewegungszustand“ verschieden groß sein. Ein Körper, der für den irdischen Beobachter eine Kugel ist, kann in bezug auf einen andern ein Rotationsellipsoid sein. Starre Körper gibt es nur in bezug auf ein bestimmtes System. Absolute Längen- und Zeitmaße gibt es überhaupt nicht mehr. Damit fällt auch die Möglichkeit absoluter quantitativer Bestimmungen und somit der übliche Begriff der Masse, denn die Masse war als Funktion der Bewegung, als das konstante Verhältnis von Kraft und Beschleunigung definiert worden. Es ist für die Elektronen bereits nachgewiesen worden, daß deren Masse sich mit der Geschwindigkeit ändert. In andern Fällen ist der Nachweis schwierig, denn Körper an der Erdoberfläche, z. B. die Objekte beinahe aller physikalischen Versuche, bewegen sich annähernd mit Erdgeschwindigkeit — die Elektronen aber nicht, und diese Abweichung kommt in Gestalt einer Variabilität ihrer Masse zum Vorschein. Die „Erhaltung der Masse“ im Weltraum ist also ein Begriff ohne Sinn. Wie man sieht, ist hier das unantike, funktionale Empfinden der faustischen Seele zum denkbar schärfsten Ausdruck gelangt. Von den Faktoren des sinnlichen Augenscheins ist nichts geblieben, nicht einmal die angeblich a priori[S. 601] vorhandenen und konstanten Formen der Anschauung, Raum und Zeit, im Sinne Kants. Es gibt nichts Greifbares und Plastisches mehr, das ein ruhendes Sein spiegelt, keine Gestalt, keine Größe, kein Maß. Die Grundwerte des newtonischen Weltbildes, ohnehin Elemente von höchst abstrakter Natur, sind in das unendliche Gewebe von variablen Beziehungen aufgelöst, das nunmehr die letzte Form der faustischen Natur, eine Gestalt von äußerst unpopulärem und esoterischem Charakter, vor Augen führt.
In den Kreis dieser Symbole des Niedergangs gehört nun vor allem die Entropie, bekanntlich das Thema des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Der erste Hauptsatz, das Prinzip von der Erhaltung der Energie, formuliert einfach das Wesen der Dynamik, um nicht zu sagen die Struktur des westeuropäischen Geistes, dem allein die Natur mit Notwendigkeit in der Form einer kontrapunktisch-dynamischen Kausalität im Gegensatz zu der statisch-plastischen des Aristoteles erscheint. Das Grundelement des faustischen Weltbildes ist nicht die Haltung, sondern die Tat, mechanisch gesprochen der Prozeß, und dieser Satz fixiert lediglich den mathematischen Charakter dieser Prozesse in Form von Variablen und Konstanten. Der zweite Satz aber greift tiefer und stellt eine einseitige Tendenz des Naturgeschehens fest, welche durch die begrifflichen Grundlagen der Dynamik in keiner Weise a priori bedingt war.
Die Entropie wird mathematisch durch eine Größe repräsentiert, die durch den augenblicklichen Zustand eines in sich abgeschlossenen Systems von Körpern bestimmt ist und die bei allen überhaupt möglichen Änderungen physikalischer oder chemischer Art nur zunehmen, niemals abnehmen kann. Im günstigsten Falle bleibt sie unverändert. Die Entropie ist wie die Kraft und der Wille etwas, das jedem, der überhaupt in das Wesen dieser Formenwelt einzudringen vermag, innerlich vollkommen klar und deutlich ist, das aber von jedem anders und offenbar unzulänglich formuliert wird. Auch hier versagt der Geist vor dem Ausdrucksbedürfnis des Weltgefühls.
[S. 602]
Man hat, je nachdem die Entropie sich vermehrt oder nicht, die Gesamtheit der Naturprozesse in nichtumkehrbare und umkehrbare eingeteilt. Bei jedem Prozeß der ersten Art wird freie Energie in gebundene verwandelt; soll diese tote Energie in lebendige zurückverwandelt werden, so kann es nur dadurch geschehen, daß gleichzeitig in einem damit verbundenen zweiten Prozeß ein Quantum lebendiger Energie gebunden wird. Das bekannteste Beispiel ist die Verbrennung von Kohle, d. h. die Umwandlung der in ihr aufgespeicherten lebendigen Energie in die durch die Gasform der Kohlensäure gebundene Wärme, wenn die latente Energie des Wassers in Dampfspannung und weiterhin in Bewegung umgesetzt werden soll. Daraus folgt, daß die Entropie im Weltganzen beständig zunimmt, so daß das dynamische System sich offenbar einem wie immer gearteten Endzustande nähert. Zu den nichtumkehrbaren Prozessen gehören Wärmeleitung, Diffusion, Reibung, Lichtemission, chemische Reaktionen, zu den umkehrbaren die Gravitation, elektrische Schwingungen, elektromagnetische und Schallwellen.
Was bisher nie empfunden worden ist, und weshalb ich in dem Satz von der Entropie den Anfang der Vernichtung dieses Meisterstückes der westeuropäischen Intelligenz, der Physik dynamischen Stils sehe, ist der tiefe Gegensatz zwischen Theorie und Wirklichkeit, der hier zum ersten Male ausdrücklich in die Theorie selbst hineingetragen worden ist. Nachdem der erste Satz das strenge Bild eines kausalen Naturgeschehens gezeichnet hatte, bringt der zweite durch das Phänomen der Nichtumkehrbarkeit eine dem unmittelbaren Leben angehörende Tendenz zum Vorschein, die dem Wesen des Mechanischen und Logischen prinzipiell widerspricht.
Verfolgt man die Konsequenzen der Entropielehre, so ergibt sich erstens, daß theoretisch alle Prozesse umkehrbar sein müssen. Das gehört zu den Grundforderungen der Dynamik. Das fordert noch einmal in aller Schärfe der erste Hauptsatz. Es ergibt sich aber zweitens, daß in Wirklichkeit sämtliche Naturvorgänge nichtumkehrbar sind. Nicht einmal unter den künstlichen Bedingungen des experimentellen Verfahrens kann der einfachste Prozeß exakt umgekehrt, d. h. ein einmal überschrittener Zustand wiederhergestellt werden. Nichts ist bezeichnender[S. 603] für die Lage des gegenwärtigen Systems als die Einführung der Hypothese der „elementaren Unordnung“, um den Widerspruch zwischen geistiger Forderung und wirklichem Erlebnis auszugleichen: Die „kleinsten Teilchen“ der Körper — ein Bild, nicht mehr — führen durchweg umkehrbare Prozesse aus; in den wirklichen Dingen befinden die kleinsten Teilchen sich in Unordnung und stören einander; infolgedessen ist mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit der natürliche, allein vom Beobachter erlebte, nichtumkehrbare Prozeß mit einer Zunahme der Entropie verbunden. So wird die Theorie zu einem Kapitel der Wahrscheinlichkeitsrechnung, und statt seiner exakten Methode tritt die statistische in Wirksamkeit.
Man hat augenscheinlich nicht bemerkt, was das bedeutet. Die Statistik gehört zur Sphäre des Organischen, zum wechselnd bewegten Leben, zum Schicksal und Zufall und nicht zur Welt der exakten Gesetze und der zeitlos-ewigen Mechanik. Man weiß, daß sie vor allem zur Charakteristik politischer und wirtschaftlicher, also historischer Phänomene dient. In der klassischen Mechanik Galileis und Newtons wäre für sie kein Platz gewesen. Was hier plötzlich statistisch erfaßt und erfaßbar wird, mit Wahrscheinlichkeit statt mit jener apriorischen Exaktheit, die alle Denker des Barock einstimmig gefordert hatten, ist der Mensch selbst, der diese Natur erkennend durchlebt, der in ihr sich selbst durchlebt; es ist nicht mehr ein reiner Intellekt, der seine starre Form objektiviert. Was die Theorie mit innerer Notwendigkeit hinstellt, jene in Wirklichkeit gar nicht vorhandenen umkehrbaren Prozesse, repräsentiert den Rest einer streng-geistigen Form, den Rest der großen Barocktradition, welche die Schwester des kontrapunktischen Stils war. Die Zuflucht zur Statistik offenbart die Erschöpfung der in dieser Tradition wirksam gewesenen ordnenden Kraft. Werden und Gewordnes, Schicksal und Kausalität, historische und natürliche Elemente beginnen zu verschwimmen. Formelemente des Lebens: das Wachstum, das Altern, die Lebensdauer, die Richtung, der Tod drängen herauf.
Das hat in diesem Aspekte die Nichtumkehrbarkeit der Weltprozesse zu bedeuten. Sie ist, im Gegensatz zu dem physikalischen Zeichen t, Ausdruck der echten, historischen, innerlich erlebten Zeit, die mit dem Schicksal identisch ist.
[S. 604]
Das ist keine Vervollkommnung der Dynamik, das ist ein Symptom ihrer Zersetzung. Gerade so hatte die Musik Beethovens die große Form der Instrumentalmusik des 18. Jahrhunderts zerstört, weil in ihr die barbarische Fülle einer weltstädtischen, modernen Seele nicht mehr zu bändigen war. Ich hatte an einer früheren Stelle die Polarität von Geschichte und Natur (oder, was dasselbe ist, von lebendiger und toter Natur) durch den Unterschied des morphologischen Verfahrens bestimmt, das dort Physiognomik, hier Systematik ist. Nun, die Physik des Barock war durch und durch strenge Systematik, solange Theorien wie diese noch nicht an ihrem Bau rütteln durften, solange in ihrem Bilde nichts anzutreffen war, was den Zufall und die bloße Wahrscheinlichkeit zum Ausdruck brachte. Mit dieser Theorie aber ist sie Physiognomik geworden. Der „Lauf der Welt“ wird verfolgt. Die Idee des Weltendes erscheint in der Verkleidung von Formeln, die im Grunde ihres Wesens keine Formeln mehr sind. Es kommt damit etwas Goethesches in die Physik, und man wird das ganze Gewicht dieser Tatsache ermessen, wenn man sich klar macht, was zuletzt die leidenschaftliche Polemik Goethes gegen Newton in der Farbenlehre bedeutete. Hier argumentierte die Intuition gegen den Verstand, das Leben gegen den Tod, die schöpferische Gestalt gegen das ordnende Gesetz. Die Formenwelt der Naturerkenntnis war aus dem Naturgefühl, dem Gottgefühl hervorgegangen. Hier hat sie den Gipfel der Distanz erreicht, und sie kehrt zum Ursprung zurück.
Und so beschwört die in der Dynamik wirksame Einbildungskraft noch einmal die großen Symbole der historischen Leidenschaft des faustischen Menschen herauf, die ewige Sorge, den Hang zu den fernsten Fernen von Vergangenheit und Zukunft, die rückschauende Forschung, den vorausschauenden Staat, die Biographien und Selbstbetrachtungen, die Uhren, die über Westeuropa weithinhallenden, das Leben messenden Glockenschläge. Das Ethos des Wortes Zeit, wie nur wir es empfinden, wie es die kontrapunktische Musik im Gegensatz zur Statuenplastik erfüllt, richtet sich auf ein Ziel. Das war in allen Lebensidealen des Abendlandes als drittes Reich, als neues Zeitalter, als Aufgabe der Menschheit, als Ausgang einer Entwicklung[S. 605] verkörpert worden. Und das bedeutet für das Gesamtdasein der faustischen Natur die Entropie.
Der antike Kosmos ist ahistorisch. Die Statik formuliert einen Zustand, der immer derselbe und in jedem Augenblicke vollkommen enthalten ist. In gewissem Sinne behauptet das die Dynamik auch, insoweit sie Systematik ist. Sie bringt zwar das Geschehen, nicht das Sein in Form, aber unter der Voraussetzung, daß diese Form von zeitloser Allgemeingültigkeit sei. Darunter ist aber eine physiognomische Tendenz wirksam, welche eine Biographie des Weltwerdens zum Ziele hat, die, bisher latent, jetzt in mächtigen physikalischen Visionen hervorbricht. Der Kosmos Demokrits gestattet keine biographische Betrachtung. Was man dort Veränderung nennt, ist eine Laune, keine Entwicklung, kosmische Episode, nicht Epoche, ein Spiel ohne Sinn. Heraklit hat es mit dem Spiel eines Knaben verglichen, der Sandhaufen auftürmt und wieder zerstört. Aristoteles schuf den Begriff der Entelechie, der von den Faktoren der Zeit und der Kraft ganz unberührten Entwicklung des einzelnen Dinges von der in ihm ruhenden möglichen zur sinnlich verwirklichten Gestalt.
Goethe aber entdeckt, seiner Idee einer Entwicklung folgend, den Zwischenknochen beim Menschen, die Metamorphose der Pflanzen und (nach Lionardos Vorgang) die Eiszeiten, sämtlich Phänomene einer zeitlich vorschreitenden, dynamischen, historischen Weltvollendung.
Schon in dem halbmystischen Begriff der Kraft, der dogmatischen Voraussetzung dieser ganzen Formenwelt, liegt stillschweigend ein Richtungsgefühl, eine Beziehung auf Vergangenes und Künftiges; noch deutlicher wird sie in der Bezeichnung der Naturvorgänge als Prozesse. Ich behaupte also, daß die Entropielehre als die intellektuelle Form, in welcher die unendliche Summe aller Naturereignisse als historische und physiognomische Einheit zusammengefaßt wird, allen physikalischen Begriffsbildungen von Anfang an unbewußt zugrunde lag, und daß sie eines Tages als „Entdeckung“ auf dem Wege wissenschaftlicher Induktion zum Vorschein kommen und dann durch die übrigen theoretischen Elemente des Systems durchaus bestätigt werden mußte. Je mehr die Dynamik sich durch Erschöpfung ihrer[S. 606] inneren Möglichkeiten dem Ziele nähert, desto entschiedener dringen die historischen Momente vor, desto stärker machen sich neben der anorganischen Notwendigkeit des Kausalen die organische des Schicksals, neben den Faktoren der reinen Ausgedehntheit — Kapazität und Intensität — die der Richtung geltend. Es geschieht dies durch eine ganze Reihe neuer Hypothesen von gleichem Stil, die durch die experimentellen Befunde gefordert werden, richtiger ausgedrückt, durch eine Reihe innerlich verwandter Produkte einer intellektuell geregelten Phantasie, die sämtlich durch das Weltgefühl und die Mythologie schon der Gotik antizipiert waren.
Dahin gehört vor allem auch die bizarre Hypothese des Atomzerfalls, welche die radioaktiven Erscheinungen deutet — nach welcher Uratome, die Jahrmillionen hindurch trotz äußerer Einwirkungen ihr Wesen unverändert bewahrt haben, plötzlich und ohne nachweisbaren Anlaß explodieren und ihre kleinsten Teile mit einer Geschwindigkeit, die Tausende von Kilometern in der Sekunde beträgt, im Weltraum verbreiten. Dies Schicksal trifft unter einer Menge radioaktiver Atome immer nur einzelne, während die benachbarten davon ganz unberührt bleiben. Auch dieses Bild ist Historie, nicht Natur, und wenn sich auch hier die Anwendung der Statistik als notwendig erweist, so möchte man beinahe vom Ersatz der mathematischen durch die chronologische Zahl reden.
Mit diesen Vorstellungen kehrt die mythische Gestaltungskraft der faustischen Seele zum Ausgang zurück. Gerade damals, als zu Beginn der Gotik die ersten mechanischen Uhren konstruiert wurden, Symbole eines historischen Weltgefühls, entstand der Mythus von Ragnarök, dem Weltende, der Götterdämmerung. Mag diese Konzeption, wie wir sie in der Völuspa und in christlicher Fassung in den Muspilli besitzen, wie alle vermeintlich urgermanischen Mythen nicht ohne Einwirkung antiker und vor allem christlich-apokalyptischer Motive entstanden sein, sie ist in dieser Gestalt Ausdruck und Symbol der faustischen und keiner andren Seele. Die olympische Götterwelt ist ahistorisch. Sie kennt kein Werden, keine Richtung, kein Ziel. So wenig die antiken Stadtstaaten bewußte oder unbewußte Aufgaben und Endziele hatten, so wenig hat sie das Dasein des[S. 607] Kosmos, die ewig gleiche Summe schöner Dinge. Der abendländische Geist aber gestaltet aus der Leidenschaft der Ferne heraus, sei es den Staat, das Bild der Natur oder das einzelne Leben. Die Kraft, der Wille hat ein Ziel, und wo es ein Ziel gibt, gibt es auch ein Ende. Was die Perspektive der großen Ölmalerei durch den Konvergenzpunkt, was der Rokokopark durch den Point de vue, was die Analysis durch das Restglied der unendlichen Reihen symbolisierte, den Abschluß einer gewollten Richtung, tritt hier in streng geistiger Form hervor. Der Faust des zweiten Teils der Tragödie stirbt, weil er sein Ziel erreicht hat. Mag aus den älteren Kulturen noch so viel mythologische Substanz herübergenommen sein, lebendig wurde sie erst durch Umprägung in einem neuen, im dynamischen Sinne. Das Weltende als Vollendung einer innerlich notwendigen Entwicklung — das ist die Götterdämmerung; das bedeutet also, als letzte, als irreligiöse Fassung des Mythus, die Lehre von der Entropie.
Es bleibt noch übrig, den Ausgang der abendländischen Wissenschaft überhaupt zu zeichnen, der heute, wo der Weg sich bereits abwärts senkt, mit Sicherheit übersehen werden kann.
Auch das, die Voraussicht des unabwendbaren Schicksals, gehört zur Mitgift des historischen Blickes, den nur der faustische Geist besitzt. Auch die Antike starb, aber sie wußte nichts davon. Sie glaubte an ein ewiges Sein. Sie hat noch ihre letzten Tage mit rückhaltlosem Glück, jeden für sich, als Geschenk der Götter durchlebt. Wir kennen unsere Geschichte. Wir werden mit Bewußtsein sterben und alle Stadien der eignen Auflösung mit dem Scharfblick des erfahrenen Arztes verfolgen.
Es steht uns noch eine letzte geistige Krisis bevor, welche das ganze Abendland ergreifen wird. Ihren Verlauf erzählt der späte Hellenismus. Die Tyrannei des Verstandes, die wir nicht empfinden, weil die heutigen Generationen ihr Maximum darstellen, ist in jeder Kultur eine Epoche zwischen Mann und Greis, nicht mehr. Ihr deutlichster Ausdruck ist der Kultus der exakten Wissenschaften, der Dialektik, des Beweises, der Erfahrung,[S. 608] der Kausalität. Die Ionik und das Barock zeigen seinen Aufschwung; es fragt sich, in welcher Gestalt er zu Ende geht.
Auch hier darf noch einmal an früher Gesagtes erinnert werden: wie jeder höhere Mensch in sich, in der Entfaltung seiner individuellen Seele die Epochen seiner Kultur noch einmal durchlebt, wie der mystische Akt des Tiefenerlebnisses, durch welchen um das Jahr 1000 die faustische Seele in der westeuropäischen Landschaft geboren wurde, in jedem Kinde noch einmal das Erwachen des so und nicht anders, faustisch nämlich gearteten Innenlebens anzeigt, so erlebt jeder bedeutende wissenschaftliche Mensch persönlich, was seine Wissenschaft im Verlaufe ihres organischen Werdens erlebte. Da ist ein Jugendstadium des schrankenlosen Optimismus, der gewiß ist, daß alles erkannt werden kann und einmal erkannt werden wird. Damit beginnen nach der gotischen und dorischen Frühzeit die leidenschaftlichen Visionen Lionardos, Galileis, Brunos, Huttens und dementsprechend die der großen Vorsokratiker. Das ist die Morgenröte der reinen Geistigkeit. Die Gotik ersehnte sie, das Barock errang sie, die — westeuropäische und hellenistische — Zivilisation besitzt sie, um zu erfahren, wie fragwürdig dieser Besitz ist. Man muß viel wissen, ehe man so weise ist, daß man am Sinn und Wert des Wissens zu zweifeln anfängt. Das de omnibus dubitandum des Descartes erstreckte sich hierauf nicht. Sein Zweifel war nur die Maske einer siegesgewissen Zuversicht. Der reine Gehirnmensch, für den die Welt restlose Beute seiner intellektuellen Fähigkeiten ist, erscheint erst mit dem 3. und 19. Jahrhundert. Aber es beginnt endlich ein Kampf gegen die Wissenschaftlichkeit, an deren Rechten man zweifelt, deren Herrschaft einen leisen Ekel einzuflößen beginnt, zuerst mit der feinen Skepsis Pyrrhons und Nietzsches, während die mittleren Geister noch mit ihren „wissenschaftlichen Errungenschaften“ einen gewaltigen Lärm machen. Indessen braucht man nur die Bücher unserer tiefsten Physiker aufzuschlagen — und die Physik ist das Meisterstück des faustischen Geistes —, um zu sehen, wie die Resignation, die Bescheidung in Hinsicht auf Ziele, Erfolge und Möglichkeiten täglich zunimmt.
Ich sage es voraus: noch in diesem Jahrhundert, dem Zeitalter des wissenschaftlich-kritischen Alexandrinismus, wird sie[S. 609] den Willen zum Siege der Wissenschaft überwinden. Die europäische Wissenschaft geht der Selbstvernichtung durch Verfeinerung des Intellekts entgegen. Man hatte zuerst ihre Mittel geprüft — im 18. Jahrhundert, dann ihre Macht — im 19.; man durchschaut endlich ihre historische Rolle. Von der Skepsis führt ein Weg zur „zweiten Religiosität“, jener der sterbenden Weltstädte, jener kranken Innerlichkeit, die nicht vor, sondern nach einer Kultur kommt, die greisen Seelen wärmend, wie es die morgenländischen Kulte im späten Rom taten.
Der Einzelne leistet Verzicht, indem er die Bücher weglegt. Eine Kultur verzichtet, indem sie aufhört, sich in hohen wissenschaftlichen Intelligenzen zu offenbaren; aber Wissenschaft existiert nur im lebendigen Dasein großer Gelehrtengenerationen, und Bücher sind nichts, wenn sie nicht in Menschen, die ihnen gewachsen sind, lebendig und wirksam werden. Wissenschaftliche Resultate sind keine objektive Materie, wie der typische Gelehrte glaubt; sie sind lediglich Elemente einer geistigen Tradition. Der Tod einer Wissenschaft besteht darin, daß sie niemandem mehr innerstes Ereignis wird. Ihr Vorhandensein ist von dem Vorhandensein verwandter Geister abhängig.
An die Müdigkeit des Geistes glaubt heute niemand, so sehr wir sie schon in allen Gliedern spüren. Aber zweihundert Jahre Zivilisation und Orgien der Wissenschaftlichkeit — dann hat man es satt. Nicht der Einzelne, die Seele der Kultur hat es satt. Sie drückt das aus, indem sie ihre Forscher, die sie in die historische Welt des Tages hinaufsendet, immer kleiner, enger, unfruchtbarer wählt. Das große Jahrhundert der antiken Wissenschaft war das dritte, nach dem Tode des Aristoteles. Als die Römer kamen, als Archimedes starb, war es schon zu Ende. Unser klassisches Jahrhundert ist das neunzehnte. Gelehrte im Stile von Gauß, Humboldt, Helmholtz waren schon um 1900 nicht mehr da; in der Physik, wie in der Chemie, der Biologie wie der Mathematik sind die großen Meister tot, und wir erleben heute das Decrescendo der Nachzügler, die ordnen, sammeln und abschließen wie die Alexandriner der Römerzeit. Es ist das ein allgemeines Symptom. Nach Lysipp ist kein großer Plastiker mehr gekommen, dessen Erscheinung ein Schicksal gewesen wäre, nach Rembrandt und Velasquez kein Maler, nach[S. 610] Beethoven kein Musiker mehr. Man beachte wohl, weshalb Goethe, im Vergleich mit Shakespeare, sich einen Dilettanten nannte, und weshalb Nietzsche Wagner den Namen eines Musikers absprach. Was war zur Zeit Cäsars die Tragödiendichtung oder die Physik? Eine Angelegenheit von vorgestern, ein Thema für die Überflüssigen. Auf Eratosthenes und Archimedes, die eigentlichen Schöpfer, folgen Poseidonios und Plinius, die mit Geschmack sammeln, und endlich Ptolemäus und Galen, die nur noch abschreiben. Wie die Ölmalerei und die kontrapunktische Musik ihre Möglichkeiten in einer kleinen Zahl von Jahrhunderten einer organischen Entwicklung erschöpft haben, so ist die Dynamik, deren Formenwelt um 1600 aufblüht, ein Gebilde, das heute im Erlöschen begriffen ist.
Zuvor aber erwächst dem faustischen, eminent historischen Geiste eine noch nie gestellte, noch nie als möglich geahnte Aufgabe. Eines Tages wird eine Morphologie der exakten Wissenschaften geschrieben werden, die untersucht, wie alle Gesetze, Begriffe, Theorien als Formen innerlich zusammenhängen und was sie als solche historisch bedeuten. Die theoretische Physik, Chemie, Mathematik als Inbegriff von Symbolen betrachtet — das ist die endgültige Überwindung des mechanischen Weltaspektes durch die intuitive, wiederum religiöse Weltidee. Das ist das letzte Meisterstück einer Physiognomik, welche auch noch die Systematik als Objekt in sich auflöst. Wir werden künftig nicht mehr fragen, welche allgemein gültigen Gesetze der chemischen Affinität oder dem Diamagnetismus zugrunde liegen — eine Dogmatik, die das 19. Jahrhundert ausschließlich beschäftigt hat — wir werden sogar erstaunt sein, daß verhältnismäßig primitive Fragen wie diese, Köpfe von solchem Range völlig beherrschen konnten. Wir werden untersuchen, woher diese der faustischen Intelligenz vorbestimmten Formen kommen, warum sie uns Menschen einer einzelnen Kultur im Unterschiede von jeder andern kommen mußten, welcher tiefere Sinn darin liegt, daß die gewonnenen Zahlen gerade in dieser bildhaften Verkleidung in Erscheinung treten. Und dabei ahnen wir heute kaum, was alles von den vermeintlich objektiven Werten und Erfahrungen nur Verkleidung, nur Bild und Ausdruck ist.
[S. 611]
Die einzelnen Wissenschaften, Erkenntnistheorie, Physik, Chemie, Mathematik, Astronomie nähern sich mit wachsender Geschwindigkeit. Wir gehen einer vollkommenen Identität der Resultate und damit einer Verschmelzung der Formenwelten entgegen, die einerseits ein auf wenige Grundformeln reduziertes System von Zahlen (funktionaler Natur) darstellt, andrerseits als deren Benennung eine kleine Gruppe von Theorien und bildhaften Anschauungen bringt, die endlich als verschleierter Mythus wieder erkannt und ebenfalls auf einige Typen, aber von durchaus vitaler, physiognomischer Bedeutung zurückgeführt werden können und müssen. Man hat diese Konvergenz nicht bemerkt, weil seit Kant und eigentlich schon seit Leibniz kein Gelehrter mehr die Problematik aller exakten Wissenschaften beherrschte.
Noch vor hundert Jahren waren Physik und Chemie einander fremd; heute sind sie einzeln nicht mehr zu behandeln. Man denke an die Gebiete der Spektralanalyse, der Radioaktivität, an die kinetische Gastheorie. Vor fünfzig Jahren war das Wesentliche der Chemie noch fast ohne Mathematik darstellbar; heute sind die chemischen Elemente im Begriff, sich in mathematische Konstanten variabler Beziehungskomplexe zu verflüchtigen. Die Elemente aber waren in ihrer sinnlichen Faßlichkeit die letzte antik-plastisch anmutende Größe der Naturwissenschaft gewesen. Die Molekulartheorie ist längst ein Gebiet der reinen Mathematik geworden. Die Physiologie steht im Begriff, ein Kapitel der organischen Chemie zu werden und sich der Mittel der Infinitesimalrechnung zu bedienen. Die nach Sinnesorganen wohlunterschiedenen Teile der älteren Physik, Akustik, Optik, Wärmelehre sind aufgelöst und zu einer Dynamik der Materie und einer Dynamik des Äthers verschmolzen, deren rein mathematische Grenze sich bereits nicht mehr aufrecht erhalten läßt. Heute vereinigen sich die letzten Betrachtungen der Erkenntnistheorie mit solchen der Analysis und der Physik (vor allem der Optik) zu einem sehr schwer zugänglichen Gebiete, dem z. B. die Relativitätstheorie gehört. Die Emanationstheorie der radioaktiven Strahlengruppen wird durch eine Zeichensprache dargestellt, der nichts Anschauliches mehr anhaftet.
Die Chemie ist im Begriff, statt der schärfsten anschaulichen Bestimmung der Qualitäten der Elemente (Wertigkeit, Gewicht,[S. 612] Affinität, Reagibilität) diese sinnlichen Momente vielmehr zu beseitigen. Daß die Elemente je nach ihrer „Abstammung“ aus Verbindungen verschieden charakterisiert sind, daß sie Komplexe diskreter Einheiten darstellen, die zwar experimentell („wirklich“) als Einheit höherer Ordnung wirken und mithin praktisch nicht trennbar sind, daß sie aber hinsichtlich ihrer Radioaktivität tiefe Verschiedenheiten aufweisen, daß durch die Emanation von strahlender Energie ein Abbau stattfindet und man also von einer Lebensdauer der Elemente reden darf, was offenbar dem ursprünglichen Begriff des Elements und damit dem Geiste der von Lavoisier geschaffenen modernen Chemie völlig widerspricht — all das rückt diese Vorstellungen in die Nähe der Entropielehre mit ihrem bedenklichen Gegensatz von Kausalität und Schicksal, Erkenntnis und Erlebnis, Natur und Historie und kennzeichnet den Weg der westeuropäischen Wissenschaft einerseits zur Aufdeckung der Identität ihrer formalen, logischen oder zahlenmäßigen Resultate mit der Struktur des Verstandes selbst, andrerseits zu der Erkenntnis, daß die gesamte, diese Zahlen und Begriffe einkleidende Theorie lediglich den symbolischen Ausdruck des faustischen Lebens darstellt.
Die Tatsache, daß Radium sich unter gewissen Bedingungen in Helium, ein Element sich also in ein anderes verwandelt, greift die Grundlagen der chemischen Theorie an. Die Relativitätstheorie beweist zum mindesten, daß die absolute Größe einer Strecke eine Vorstellung ist, die ernstlich angezweifelt werden darf. Diese Vorstellung aber ist die Voraussetzung der messenden Physik. Die Vielzahl der in sich widerspruchslosen Geometrien, deren Einführung in die Physik und Astronomie neben der bisher allein verwandten euklidischen sich aus methodischen Gründen heute vollzieht, widerspricht zwar sicherlich gewissen bisher nie angezweifelten Sätzen der Erkenntnistheorie, vor allem derjenigen Kants, beweist aber damit nur, daß auch hier geistige Konventionen vorliegen, an denen Zweifel möglich oder angebracht sind. An dieser Stelle ist endlich als eines der wichtigsten Fermente des gesamten Formenkomplexes die echt faustische Mengenlehre zu nennen, die im schärfsten Gegensatz zur antiken Mathematik nicht mehr die singulären Größen, sondern den Inbegriff irgendwie morphologisch gleichartiger Größen (etwa die Gesamtheit[S. 613] aller Quadratzahlen, aller Differentialgleichungen von bestimmtem Typus) als neue Einheit, als neue Zahl höherer Ordnung auffaßt und neuartigen, früher ganz unbekannten Überlegungen bezüglich ihrer Mächtigkeit, Ordnung, Gleichwertigkeit, Abzählbarkeit[122] unterwirft. Man charakterisiert die endlichen (abzählbaren, begrenzten) Mengen hinsichtlich ihrer Mächtigkeit als „Kardinalzahlen“, hinsichtlich ihrer Ordnung als „Ordinalzahlen“ und stellt die Gesetze und Rechnungsarten derselben auf. So ist eine letzte Erweiterung der Funktionentheorie, die ihrer Formensprache nach und nach die gesamte Mathematik einverleibt hatte, in Verwirklichung begriffen, wonach sie in bezug auf den Charakter der Funktionen nach Prinzipien der Gruppentheorie, in bezug auf den Wert der Variablen nach mengentheoretischen Grundsätzen verfährt. Die Mathematik ist sich dabei der Tatsache vollkommen bewußt, daß hier die letzten Erwägungen über das Wesen der Zahl mit denen der reinen Logik zusammenfließen, und man spricht von einer Algebra der Logik. Die moderne geometrische Axiomatik ist vollkommen ein Kapitel der Erkenntnistheorie geworden.
Das unvermerkte Ziel, dem dies alles zustrebt und das insbesondere jeder echte Naturforscher als Trieb in sich empfindet, ist das Herausarbeiten einer reinen, zahlenmäßigen Transzendenz, die vollkommene und restlose Überwindung des Augenscheins und dessen Ersatz durch eine dem Laien unverständliche und unvollziehbare Bildersprache, der das große faustische Symbol des unendlichen Raumes innere Notwendigkeit verleiht. Der Kreislauf der Naturerkenntnis des Abendlandes vollendet sich. Mit dem tiefen Skeptizismus dieser letzten Einsichten knüpft der Geist wieder an die Formen frühgotischer Religiosität an. Die anorganische, erkannte, zergliederte Umwelt, die Welt als Natur, als System ist zu einer reinen Sphäre funktionaler Zahlen vertieft worden. Wir hatten die Zahl als eines der ursprünglichsten Symbole jeder Kultur erkannt, und so folgt, daß der Weg zur reinen Zahl die Rückkehr des Geistes zu seinem eignen[S. 614] Geheimnis, die Offenbarung seiner eignen formalen Notwendigkeit ist. Die faustische Zahl war nicht sinnliche Größe, sondern abstrakte Beziehung. Am Ziele angelangt, enthüllt sich endlich das ungeheure, immer unsinnlicher, immer durchscheinender gewordene Gewebe, das die gesamte Naturwissenschaft umspinnt: Es ist nichts andres als die innere Struktur des Geistes, der sie zu gestalten glaubte. Darunter aber erscheint wieder das Früheste und Tiefste, der Mythus, das unmittelbare Werden, das Leben. Je weniger anthropomorph die Naturforschung zu sein glaubt, desto mehr ist sie es. Sie beseitigt nach und nach die einzelnen menschlichen Züge des Naturbildes, um endlich als die vermeintliche reine Natur die Menschlichkeit selbst, rein und ganz, die unmittelbare Form des Verstandes, in Händen zu halten. Aus dem religiösen Seelentum der Gotik ging der das ursprüngliche Weltgefühl überschattende städtische Intellekt, das alter ego der irreligiösen Naturerkenntnis hervor. Heute, in der Abendröte der wissenschaftlichen Epoche, im Stadium des siegenden Skeptizismus, lösen sich die Wolken, und die Landschaft des Morgens ruht wieder in vollkommener Deutlichkeit. Die Natur als starrer Inbegriff funktionaler Gesetze, ganz abstrakt, ganz infinitesimal — das ist nichts als das mechanische Bild des faustischen Geistes, das sich vom organischen Grunde ablöst. Den Grund aber hatten schon die romanische Ornamentik und die gotischen Dome offenbart.
Der letzte Schluß faustischer Weisheit, wenn auch nur in ihren höchsten Momenten, ist die Auflösung des gesamten Wissens in ein ungeheures System morphologisch-historischer Verwandtschaften. Dynamik und Analysis sind dem Sinne, der Formensprache, der Substanz nach identisch mit den Bildungen der gotischen Architektur und des dynastischen Staates, den Tendenzen unsres mehr und mehr sozialistischen Wirtschaftslebens und unserer impressionistischen Ölmalerei, der Instrumentalmusik und der christlich-germanischen Dogmatik. Ein und dasselbe Weltgefühl redet aus allen. Sie sind mit der faustischen Seele geboren und alt geworden. Sie stellen ihre Kultur als historisches Phänomen in der Welt des Tages und des Raumes dar. Die Vereinigung der einzelnen wissenschaftlichen Aspekte zum Ganzen wird alle Züge der großen Kunst des Kontrapunkts tragen. Eine infinitesimale Musik des grenzenlosen Weltraums — das[S. 615] ist immer die tiefe Sehnsucht dieser Seele im Gegensatz zur antiken mit ihrem plastisch-euklidischen Kosmos gewesen. Das ist, als Denknotwendigkeit des faustischen Weltverstandes auf die Formel einer dynamisch-imperativischen Kausalität gebracht, zu einer diktatorischen Naturwissenschaft gestaltet, ihr großes Testament für den Geist kommender Kulturen — ein Vermächtnis von Formen gewaltigster Transzendenz, das vielleicht niemals eröffnet werden wird. Damit kehrt eines Tages die abendländische Wissenschaft, ihres Strebens müde, in ihre seelische Heimat zurück.
Ende des ersten Bandes.
[115] Etwa im zweiten Hauptsatz der Thermodynamik in der Fassung Boltzmanns: „Der Logarithmus der Wahrscheinlichkeit eines Zustandes ist proportional der Entropie dieses Zustandes.“ Hier repräsentiert jedes Wort eine vollständige Naturanschauung.
[116] Das Feuer gehört für das antike Auge dazu. Es ist der stärkste optische Natureindruck, den es gibt und gestattet deshalb dem antiken Geiste keinen Zweifel an seiner Körperlichkeit. Erde, Wasser und Luft bedeuten den festen, flüssigen und gasförmigen Aggregatzustand der physikalischen σώματα, ein rein sinnliches Sichverhalten. Man vergleiche das mit dem Begriff des ἦθος in der Tragödie.
[117] Und man darf behaupten, daß der populäre Glaube, den z. B. Haeckel mit den Namen Atom, Materie, Energie verbindet, von dem Fetischismus des Neandertalmenschen nicht wesentlich verschieden ist.
[118] In Ägypten hat erst Ptolemäus Philadelphus den Herrscherkult eingeführt. Die Verehrung der Pharaonen hatte eine ganz andre Bedeutung.
[119] Die symbolische Bedeutung des Titels und seine Beziehung zu Begriff und Idee der Person kann hier nicht gegeben werden. Es sei nur darauf aufmerksam gemacht, daß die antike Kultur als einzige von allen niemals einen Titel gekannt hat. Das würde dem streng Somatischen ihrer Bezeichnungen widersprochen haben. Außer Eigen- und Beinamen besaß sie nur die technischen Namen tatsächlich ausgeübter Ämter. „Augustus“ wird sofort Eigenname, Cäsar sehr bald Amtsbezeichnung. Aber man kann das Vordringen des magischen Gefühls daran verfolgen, wie in der spätrömischen Beamtenschaft höfliche Wendungen wie vir clarissimus feststehende Titulaturen werden, die verliehen und entzogen werden können. Genau so sind die Namen fremder und älterer Götter jetzt zu Titeln der anerkannten exklusiven Gottheit geworden. „Heiland“ (Asklepios) und „Guter Hirte“ (Orpheus) sind Titel Christi. In antiker Zeit aber waren sogar die Beinamen römischer Gottheiten allmählich zu selbständigen Göttern geworden.
[120] Diagoras, der seiner „gottlosen“ Schriften wegen in Athen zum Tode verurteilt wurde, hat tief fromme Dithyramben hinterlassen. Man lese daraufhin Hebbels Tagebücher und seine Briefe an Elise. Er „glaubte nicht an Gott“, aber er betete.
[121] Auch unsere Sprachen setzen ihn oder vielmehr das hinter dem Wort stehende numen schon voraus. Wir sagen, daß eine Industrie „sich Absatzgebiete erschließt“ und daß der Rationalismus „zur Herrschaft gelangt“. Das sind dynamische Wendungen. Keine antike Sprache gestattet solche Ausdrücke. Hier liegt auch ein wesentlicher Unterschied zwischen den Bildern der antiken und modernen Poesie.
[122] Die „Menge“ der rationalen Zahlen ist abzählbar, die der reellen nicht. Die Menge der komplexen Zahlen ist zweidimensional; daraus folgt der Begriff der n-dimensionalen Menge, welcher auch die geometrischen Gebiete in die Mengenlehre einordnet.
Inhalt des zweiten Bandes:
Welthistorische Perspektiven.
|
I.
|
Grundformen der Geschichte.
|
|
|
1.
|
Ursprung und Landschaft. Die Gruppe der hohen
Kulturen. Völkerformen und Sprachen.
|
|
|
2.
|
Die Geschichte einer Kultur als Ablauf eines
organischen Prozesses. Urvölker, Kulturvölker, Fellachenvölker.
Beispiel: Die Kultur der Maya.
|
|
|
II.
|
Das Problem der Zivilisation.
|
|
|
1.
|
Kultur und Zivilisation. Land und Stadt. Instinkt und
Intellekt. Bauerntum und Bürgertum. Beispiel: Der Aufbau der ägyptischen
Kultur.
|
|
|
2.
|
Weltstadt und Provinz. Zur Psychologie der
Modernität.
|
|
|
3.
|
Der Imperialismus. Das chinesische Reich; das
Imperium Romanum. Die westeuropäische Zukunft.
|
|
|
III.
|
Probleme der arabischen Kultur.
|
|
|
1.
|
Historische Pseudomorphosen: Die römische
Kaiserzeit.
|
|
|
2.
|
Der Puritanismus: Pythagoras, Mohammed, Cromwell.
|
|
|
3.
|
Das Judentum.
|
|
|
IV.
|
Der Staat.
|
|
|
1.
|
Die indische Kultur und das Problem der Stände.
|
|
|
2.
|
Antike und abendländische Staatsidee: Polis und
Dynastie.
|
|
|
3.
|
Stadien der politischen Form. Parlamentarismus;
Cäsarismus.
|
|
|
V.
|
Das Geld.
|
|
|
Münze und Kredit. Idee des Eigentums. Morphologie der
Wirtschaftsgeschichte.
|
||
|
VI.
|
Die Symbolik der Maschine.
|
|
|
Sklaventum und Maschinenindustrie. Zur Psychologie der
westeuropäischen Technik: Sinn, Entwicklung und Lebensdauer. Der
Erfinder als faustischer Typus.
|
||
|
VII.
|
Das Russentum und die Zukunft. Schluß
|
|
OSWALD SPENGLER
PREUSSENTUM
UND SOZIALISMUS
21. bis 33. Tausend
Preis M 6.—
Inhalt: Einleitung — Die deutsche Revolution — Sozialismus als Lebensform — Engländer und Preußen — Marx — Die Internationale
„Ich halte dies Buch für ‚aktueller‘ als die Enthüllungen, Prozesse, Steuerprojekte alle, die uns sonst beschäftigen müssen: sie sind Papier, dies Buch ist Leben ... Ein Büchlein von 100 Seiten nur und doch zu groß, um seine Linien so nachzeichnen zu können, wie man es möchte.“ Fritz Endres (München-Augsburger Abendzeitung). — „Dieses Buch ist eine Bejahung des Preußentums, die gehört werden wird, denn der sie ausspricht, ist ein Philosoph von Geblüt.“ Willy Pastor (Tägliche Rundschau). —„Gleichviel, ob ihr Gehalt im historischen Sinne ‚richtig‘, ob ihr Ziel das wahrhaft zu erstrebende ist — die Broschüre „Preußentum und Sozialismus“ war im Augenblick ihres Erscheinens sofort eine Kraft, und sie ist selbst eine gegenwartgestaltende Macht geworden. Mit diesem Auge müssen wir sie sehen, nicht bloß als eine „Meinung“, an der man Kritik übt und die man schließlich anfechtbar findet.“ Eduard Spranger (Dresdner Anzeiger). —„Oswald Spengler, der Verfasser des „Untergangs des Abendlandes“, des bedeutendsten und universellsten Buches der letzten zwanzig Jahre, hat unter dem Titel „Preußentum und Sozialismus“ ein Werk der Öffentlichkeit übergeben, das — man mag zu Spenglers Skepsis und Kulturtheorien stehen, wie man will! — in geradezu hervorragender Klarheit und Wahrheit sowohl die heutige Lage psychologisch analysiert, als auch unseren schicksalhaften Weg ihrer Überwindung zum Aufbau hin darstellt. Auf nur 99 Seiten gibt Spengler eine derartige Fülle von Gedanken, daß es nicht möglich ist, sie auch nur andeutungsweise anzugeben, man müßte denn das ganze Buch nachschreiben. Jeder, dem des Vaterlandes Not im Herzen brennt, sollte das Buch zur Hand nehmen!“ Ernst Buske (Wandervogel).
Alle hier angegebenen Preise sind wegen der stets steigenden Kosten unverbindlich.
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München
Der Untergang des Abendlandes und der Christ
Von A. ALBERS. M 1.50. Soeben erschienen.
Idealisten wenden sich mit Ingrimm gegen den Relativismus Spenglers und suchen in dem dichten Netze seiner Gedanken irgendwo eine Lücke zu finden, durch die sie seinem schrecklichen Relativismus entfliehen könnten. Der Christ fürchtet diesen nicht, ja er sieht in ihm eine Förderung seines geistigen Lebens. Er weiß einen Punkt, der ihn außerhalb aller Relativität stellt. Von ihm aus kann er den Spenglerschen Kosmos ruhevoll betrachten: sein Weltbild birgt noch tiefere Geheimnisse für alles Denken und Schauen. Mit Ernst ist in diesem Aufsatz gezeigt, wie Spenglers Buch seine zahlreichen Leser in der Richtung zum Christlichen vorwärts bringen kann.
Der deutsche Geist und die Form
Gedanken und Betrachtungen von MAX ZOBEL von
ZABELTITZ. M 6.—. Soeben erschienen.
Die Schrift eröffnet im Hinblick auf die letzten politischen Schicksale der Deutschen tiefe und heilsame Einsichten in das Wesen und die Geistesart unseres Volkes; sie zeigt, wie überraschend tief bei ihm der Zusammenhang zwischen politischem und geistigem Leben ist, so tief nämlich, daß auch für die bekannten und so oft entgegengehaltenen Widersprüche: Weimar — Potsdam, Weltbürgertum — Nationalstaat nur ein und dieselbe Wurzel in der deutschen Seele nachweisbar ist. Hier liegen bedeutsame Erkenntnisse, welche eine Erklärung für viele Erscheinungen in der deutschen Politik und im deutschen Geistesleben bieten. Aus der Mannigfaltigkeit und dem Ueberreichtum der deutschen Seele ergibt sich dem Verfasser als erste Notwendigkeit und einzige Aussicht für das deutsche Volk der Wille zur Form — staatlich wie geistig genommen. Die gedankenreiche, glänzende Schrift ist ein Sammelruf in der allgemeinen Zersplitterung an das geistige Deutschland.
Von der innern Not unseres Zeitalters
Ein Ausblick auf Fausts künftigen Weg. Von ROBERT
SAITSCHICK. 2. Auflage. Gebunden M 4.50
„Faust ist auch in Saitschicks Betrachtung nur der Name für den inneren Menschen unserer Tage. Und wie Goethe, so setzt auch Saitschick sich mit ihm selbständig auseinander. Nur sieht er schärfer; denn Faust ist inzwischen ein Jahrhundert seinen Weg weiter gegangen.“ Hochland.
Der Staat und was mehr ist als er
Von ROBERT SAITSCHICK. Gebunden M 12.—
Inhalt: Einleitung — Was ist der Staat? — Staat und Individuum — Macht und Recht — Staat und Sittlichkeit — Nation — Patriotismus — Der Staat und die tragischen Widersprüche des Menschen — Vom Weltfrieden — Völkergemeinschaft.
Laotse / Tao Teh King
Vom Geist und seiner Tugend. Übertragen von H.
FEDERMANN. In Pappband gebunden M 8.—, in Javapapier gebunden M 12.—.
Soeben erschienen.
Diese neue Uebertragung der tiefsinnigen Sprüche des Laotse ist in direkter Fühlung mit dem chinesischen Urtext entstanden. Der Uebersetzer, der selbst eine der Lyrik und Musik offene Seele besitzt, konnte dem schwierigen Text und dem Geist der Sprüche allseitig gerecht werden.
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München
Soeben ist erschienen:
Immermann
Der Mann und sein Werk
im Rahmen der Literaturgeschichte
von
Harry Maync
Gebunden M 60.—
Dieses Werk bildet einen neuen Band der angesehenen und weitverbreiteten Sammlung von Dichterbiographien unseres Verlags. Es ist einem Autor gewidmet, dessen zwei Hauptwerke, „Die Epigonen“ und der „Münchhausen“ (mit der in ihm eingeflochtenen herrlichen Dorfgeschichte „Der Oberhof“), in der Entwicklung des deutschen Romans epochemachend geworden sind, der aber gleichwohl dem heutigen Geschlechte weniger bekannt ist, als er nach der Vielseitigkeit seiner literarischen Betätigung — Immermann ist durch seine dramaturgische Tätigkeit zumal auch für das deutsche Theater von Bedeutung geworden — und vor allem nach dem Gewicht seiner aufrechten und männlichen Persönlichkeit verdiente. — Die Zeitspanne von den Freiheitskriegen bis zum Jahre 1840, in die Immermanns Schaffen fällt, war eine ganz unpolitische, wesentlich aufs Literarische und Geistige gerichtete Epoche; sie mutet uns Heutige nach dem politischen Schiffbruch, den wir soeben erleiden mußten, wie ein schönes Traumland an. Als in jenen Jahren der bekannte englische Staatsmann und vielgelesene Schriftsteller Sir Ed. Bulwer in der berühmt gewordenen Widmung seines „Ernest Maltravers“ „das große deutsche Volk“ als „das Volk der Dichter und Denker“ ansprach, wollte dieser Titel gleichwohl diesem nicht recht gefallen. Heute, wo wir Deutsche am Grabe unserer politischen Hoffnungen stehen, ist es wie wenn jene Bezeichnung neue Geltung erhalten sollte. Das Leben Immermanns, eines der literarischen Hauptvertreter jener Epoche, gewinnt daher sicherlich heute ein verstärktes Interesse für uns Deutsche, freilich auch in dem Sinne, daß es uns lehrt, daß ein seiner Kräfte bewußtes Volk von bloßer Geistigkeit nicht leben kann, sondern mit innerer Notwendigkeit auf politische Betätigung hingetrieben wird. Harry Maync legt in seiner fesselnden Darstellung mit Recht starken Nachdruck auf die Herausarbeitung des zeitlichen Milieus. Das bedeutende und anregende Buch darf den weitesten Kreisen zum Studium und zur Lektüre wärmstens empfohlen werden und wird niemand enttäuschen.
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München
JOHANNES VOLKELT:
Das ästhetische Bewußtsein
Prinzipienfragen der Ästhetik. Geheftet M 28.- (Soeben
erschienen.)
Inhalt: I. Ästhetische Gegenständlichkeit. — II. Der Tatbestand der ästhetischen Einfühlung. — III. Zur Theorie der ästhetischen Einfühlung. — IV. Ursprung der Einfühlung überhaupt. — V. Illusion und ästhetische Wirklichkeit. — VI. Mit-Wahrnehmung und Phantasie im ästhetischen Betrachten. — VII. Der Gebild-Charakter des ästhetischen Verhaltens. — Sachregister.
Diese Untersuchungen können als Phänomenologie des ästhetischen Bewußtseins bezeichnet werden. Das dem ästhetischen Anschauen hingegebene Bewußtsein wird in seiner wesenhaften Verfassung beschrieben, wobei die Beziehung von Bewußtheit und Gegenständlichkeit in den Mittelpunkt gerückt ist. Das Buch bildet eine Ergänzung der großen Ästhetik Volkelts.
Gewißheit und Wahrheit
Untersuchung der Geltungsfragen als Grundlegung der
Erkenntnistheorie. Geheftet M 26.—, gebunden M 40.—
„Wir zweifeln nicht, daß das gediegene, glänzend geschriebene Werk auf die erkenntnistheoretische Auseinandersetzung und Fragestellung einen nachhaltigen, tiefgehenden Einfluß üben wird.“ Geisteskampf der Gegenwart.
System der Ästhetik
Drei Bände. Gebunden M 105.—
„Das Werk Volkelts ist durchgängig erfüllt mit ästhetischem Vollgehalt; es gibt keine leeren Fächer darin, keine abstrakten Nieten, keine überflüssigen Spitzfindigkeiten ... Ein auf allen ästhetischen Gebieten erfahrener, wohlorientierter, gebildeter Geist waltet über dem Ganzen.“ Professor Dr. O. Liebmann (Frankfurter Zeitung).
Ästhetik des Tragischen
Dritte, neubearbeitete Auflage. Gebunden M 30.—
„Nicht bloß der Forschung im engeren Sinn, auch der Kritik und vor allem dem Unterricht hat Volkelts Werk unschätzbare Dienste geleistet, hat Unzähligen für die feinsten Abschattungen tragischen Erlebens und Gestaltens die Augen geöffnet und uns klärend und vertiefend zu den letzten Fragen hingeleitet.“ Prof. Dr. Rob. Petsch (Neue Jahrbücher für das klassische Altertum).
Kunst und Volkserziehung
Betrachtungen über Kulturfragen der Gegenwart. Zweiter
Abdruck. Gebunden M 2.80 und 75% Teuerungszuschlag.
„Das Anziehende des Buches bildet die konsequente Ablehnung jeder moralisierenden Tendenz für die Kunst und das warm begeisterte Eintreten für eine in ihrem tiefsten Wesen begründete Sittlichkeit, die eins mit ihr wird. So begegnen sich Ästhetik und Ethik hier in harmonischer Verschmelzung.“ A. Brausewetter (Der Tag).
Festschrift Johannes Volkelt
zum 70. Geburtstag dargebracht. VII, 428 Seiten. Lex.
8o. Geheftet M 25.—
Mit Beiträgen von Wilhelm Wundt, Jonas Cohn, Bruno Bauch, Albert Köster, Georg Witkowski, Hermann Schwarz, Walther Schmied-Kowarzik, Max Frischeisen-Köhler, Otto Klemm, Hermann Schneider, Richard Falckenberg, Max Dessoir, Ernst Bergmann, Felix Krueger, Wilhelm Wirth, F. R.
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München
Platon
Sein Leben, seine Schriften, seine Lehre. Von
CONSTANTIN RITTER. Erster Band: Platons Leben
und Persönlichkeit, Philosophie nach den Schriften der ersten sprachlichen
Periode. XV, 588 Seiten 8o. Geheftet M 8.—*, gebunden
M 9.—*
Platon und die Aristotelische Ethik
Von Dr. HANS MEYER, Professor der Philosophie in
München. 1919. VI, 300 Seiten 8o. Geheftet M 16.—
Geschichte der griechischen Literatur
von WILH. v. CHRIST. Unter Mitwirkung von Professor
Dr. OTTO STÄHLIN (Erlangen) neubearbeitet von Professor Dr. WILHELM SCHMID
(Tübingen).
(Handbuch der klassischen Altertumswissensschaft VII. Band)
|
I.
|
Teil: Die klassische Periode der griechischen
Literatur. 6. Auflage. 1912. 50 Bogen Lex. 8o. Geheftet
M 23.50, gebunden M 41.50
|
|
II.
|
Teil, 1. Hälfte: Die nachklassische Literatur
von 320 v. Chr. bis 100 n. Chr. 6. Auflage. 1920. 42½
Bogen Lex. 8o. Geheftet M 35.—, geb. M 55.—. (Soeben
erschienen.)
|
|
II.
|
Teil, 2. Hälfte: Die nachklassische Periode der
griechischen Literatur von 100 bis 530 n. Chr. 5. Auflage.
1913. Mit alphabetischem Sachregister und einem Anhang von 45
Porträtdarstellungen, ausgewählt und erläutert von J.
Sieveking. 50⅝ Bogen Lex. 8o.
Geheftet M 25.50, gebunden M 43.50
|
Geschichte der römischen Literatur
bis zum Gesetzgebungswerk des Kaisers Justinian. Von
MARTIN von SCHANZ.
(Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft VIII. Band)
|
I.
|
Teil, 1. Hälfte: Von den Anfängen der Literatur bis
zum Ausgang des Bundesgenossenkrieges. Mit Register. 3. Auflage. 23
Bogen Lex. 8o. Geh. M 12.25, geb. M 26.25
|
|
I.
|
Teil, 2. Hälfte: Bis zum Ende der Republik. Mit
Register. 3. Auflage. 33⅞ Bogen Lex. 8o. Geheftet M 17.50,
gebunden M 33.50
|
|
II.
|
Teil, 1. Hälfte: Die augustische Zeit. Mit
Register. 3. Auflage. 38½ Bogen Lex. 8o. Geheftet M
17.50, gebunden M 33.50
|
|
II.
|
Teil, 2. Hälfte: Vom Tode des Augustus bis zur
Regierung Hadrians. Mit Register. 3. Auflage. 38½ Bogen Lex.
8o. Geheftet M 17.50, gebunden M 33.50
|
|
III.
|
Teil: Die römische Literatur von Hadrian bis auf
Constantin (324 n. Chr.). Mit Register. 2. Auflage.
Vergriffen.
|
|
IV.
|
Teil, 1. Hälfte: Die Literatur des 4.
Jahrhunderts. Mit Register. 2., vermehrte Auflage. 36¾ Bogen
Lex. 8o. Geheftet M 17.50, gebunden M 33.50. Die zweite
Hälfte (die Literatur des 5. und 6. Jahrhunderts) erscheint Herbst
1920.
|
Griechische Staatskunde
Von Dr. GEORG BUSOLT, ord.
Professor an der Universität Göttingen. 3., neugestaltete Auflage der
Griechischen Staats- und Rechtsaltertümer. 1. Hauptteil: Allgemeine
Darstellung des griechischen Staates. 41 Bogen Lex. 8o. Geheftet M
30.—, gebunden M 50.—. (Soeben erschienen.)
(Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft IV. Band, 1. Abteilung, 1. Hälfte)
Griechische Kultusaltertümer
Von Dr. P.
STENGEL, Professor am Joachimsthalschen Gymnasium in Berlin. 3.,
neubearbeitete Auflage. 17½ Bogen Lex. 8o. Mit 6 Tafeln.
Geheftet M 20.—, gebunden M 35.—. (Soeben erschienen.)
(Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft V. Band. 3. Abteilung)
Geschichte der antiken Philosophie
Von WILHELM
WINDELBAND. 3. Auflage bearbeitet von Dr. ADOLF BONHÖFFER. Geh. M
10.50, geb. M 24.50
(Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft V. Band, 1. Abteilung, 1. Teil)
Zu den mit * versehenen Preisen kommt noch ein Teuerungszuschlag des Verlages von 75%.
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München
Geschichte der deutschen Literatur
bis zum Ausgang des
Mittelalters. Von Professor Dr. G. EHRISMANN. 1. Teil: Die
althochdeutsche Literatur. (Soeben erschienen.) Geheftet M 22.50,
gebunden M 30.—
Die deutschen Dichter des lateinischen Mittelalters
in deutschen
Versen von PAUL von WINTERFELD. Herausgegeben von HERMANN REICH.
In Halbleinen gebunden M 16.—
Deutsche Altertumskunde
von Professor Dr. FR. KAUFFMANN.
1. Hälfte: Von der Urzeit bis zur Völkerwanderung. Geheftet M 17.50, in
Leinwand gebunden M 24.—
Deutsches Sagenbuch
Herausgegeben von Professor Dr. FRIEDRICH
v. d. LEYEN.
1. Teil: Die Götter und Göttersagen der Germanen. Von Professor Dr. FR. v. d. LEYEN. 2. Auflage. VIII, 278 Seiten 8o. In Pappband M 22.—. (Soeben erschienen.) — 2. Teil. Die deutschen Heldensagen. Von Professor Dr. FR. v. d. LEYEN. VIII, 352 Seiten 8o. In Pappband M 11.—. — 3. Teil: Die deutschen Sagen des Mittelalters. Von K. WEHRHAN. 1. Hälfte: Kaiser und Herren. VIII, 210 Seiten 8o. In Pappband M 11.—. 2. Hälfte: Stämme und Landschaften, Ritter und Sänger. X, 254 Seiten 8o. In Pappband M 17.—. (Soeben erschienen.) — 4. Teil: Die deutschen Volkssagen. Von Dr. FR. RANKE. XVII, 294 Seiten 8o. In Pappband M 11.—
Die Germanen
Eine Erklärung der Überlieferung über Bedeutung,
Herkunft des Völkernamens. Von TH. BIRT. M 4.50
Deutsche Geschichte
Von OSKAR JÄGER. 5. Auflage (14. bis
16. Tausend) Erster Band: Bis zum westfälischen Frieden. 43
Bogen mit 112 Abbildungen und 7 Karten. / Zweiter Band: Bis zur
Gegenwart. 43 Bogen mit 108 Abbildungen und 8 Karten. Gebunden M 45.—
Schulthess’ Europäischer Geschichtskalender
Kriegsjahrgänge 1914, 1915 und 1917
Neue Folge. 30. Jahrgang 1914 (der ganzen Reihe LV. Band). Herausgegeben von WILHELM STAHL. In zwei Hälften. XXXII und 1248 Seiten. M 45.—
Neue Folge. 31. Jahrgang 1915 (der ganzen Reihe LVI. Band). Herausgegeben von ERNST JÄCKH und KARL HÖNN. In zwei Hälften. LI, 1454 Seiten. M 60.—
Neue Folge. 32. Jahrgang 1916. Im Druck.
Neue Folge. 33. Jahrgang 1917 (der ganzen Reihe LVIII. Band). Herausgegeben von WILHELM STAHL. In zwei Hälften. 1. Hälfte: IV, 1048 Seiten. 2. Hälfte: XXXV, 1067 Seiten. M 100.—. Soeben erschienen.
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München
Goethe
Sein Leben und seine Werke. Von ALBERT
BIELSCHOWSKY. 38. und 39. Auflage. Zwei Bände mit zwei
Porträtgravüren. In Halbleinenband M 70.—
Schiller
Sein Leben und seine Werke. Von KARL BERGER.
11. und 12. Auflage (34. bis 39. Tausend). Zwei Bände mit zwei
Porträtgravüren. In Halbleinenband M 65.—
Herder
Sein Leben und seine Werke. Von EUGEN KÜHNEMANN.
2., neubearbeitete Auflage. Mit Porträtgravüre. In Halbleinenband M
24.—
Schiller
Von EUGEN KÜHNEMANN. Sechste Auflage (16. bis
19. Taus.). In Halbleinenband M 40.—. (Soeben erschienen.)
Theodor Fontane von CONRAD WANDREY.
Geb. M 20.—
„Das kluge, gediegene und liebevolle, dabei in seiner Rede die richtige Tonhöhe wahrende und in kritischen Einzelheiten sehr feine Buch will, wie es im Vorwort heißt, das Fontanebild dieser Gegenwart einfangen, und das heißt, es dient in der Hauptsache und fast ausschließlich dem Epiker, denn dieser ist es, der lebt und gilt .... Es ist eine Glanzleistung, die, wie wir glauben möchten, mit ihrem Gegenstande durch die Zeiten ehrenvoll verbunden bleiben wird.“ Thomas Mann (Berliner Tageblatt).
Goethes Faust
Nach Entstehung und Inhalt erklärt. Von ERNST
TRAUMANN. Zweite Auflage. Erster Band: Der
Tragödie erster Teil. Zweiter Band: Der Tragödie
zweiter Teil. In Halbleinenband M 45.—
„Unsere Literatur über unsere Literatur ist nicht allzu reich an solchen wahrhaft ins Herz der Dichtung führenden Werken.“ Professor Dr. J. Hofmiller (Süddeutsche Monatshefte). — „Wir werden an dem Werk die ausführlichste, wissenschaftlich zuverlässigste und gründlichste Erklärung des Faust haben.“ Pädagogische Blätter.
Bausteine zu einer Ästhetik der innern Form
Von FRIEDRICH
LIPPOLD. XXIV, 400 Seiten. In Halbleinenband M 20.—
Nicht nur die Wissenschaft der Ästhetik, sondern die deutsche Literatur wird mit diesem Buche um einen Denker und Schriftsteller seltener Art bereichert. Bis zu seiner Tiefe hat wohl niemand bisher die Schönheiten der ersten Züricherseestrophe Klopstocks oder von Goethes „Euphrosyne“ und „Auf Miedings Tod“ ausgekostet und von diesen Erlebnissen im Reiche des Schönen Kunde gegeben. Lippold war eine Persönlichkeit in der Art F. Th. Vischers und Wilh. Diltheys und wird in unserer traurigen Gegenwart wie ein Klang aus dem alten Deutschland vor 1870 wirken, das der Welt so viele Denker und Lehrer gegeben hat.
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München
Soeben ist erschienen:
ERNST DROEM
GESÄNGE
EINGEFÜHRT VON
OSWALD SPENGLER
Geheftet M 10.— Gebunden M 14.—
In Oswald Spenglers Werk „Der Untergang des Abendlandes“ 3.–15. Auflage Seite 331 ist in bedeutungsvoller Weise auf den Dichter hingewiesen mit den Worten:
„Die moderne Poesie der welkenden Alleen, der endlosen Straßenzüge unserer Weltstädte, der Pfeilerreihen eines Domes, der Gipfel einer fernen Gebirgskette ..... Baudelaire, Verlaine und X haben diese Gefühle in Verse gebracht.“
Mit der Veröffentlichung der „GESÄNGE“ von ERNST DROEM wird der literarischen Welt dieses X nun aufgelöst. Eine bedeutende Dichterpersönlichkeit, von kosmischen Visionen gleich Goya und Daumier bestürmt, ein Meister der Sprache und der modernsten Form, tritt hier — was bei Dichtern sonst selten ist — aus sorgsam gehüteter Verborgenheit hervor mit der reifen Frucht ihres Geistes und ihrer Kunst.
OSWALD SPENGLER hat der ersten Gabe dieses Dichters eine Einleitung über die Lyrik der Gegenwart vorangeschickt, die ganz neue Gedanken und Gesichtspunkte bietet.
C. H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung Oskar Beck in München
C. H. Beck’sche Buchdruckerei in Nördlingen